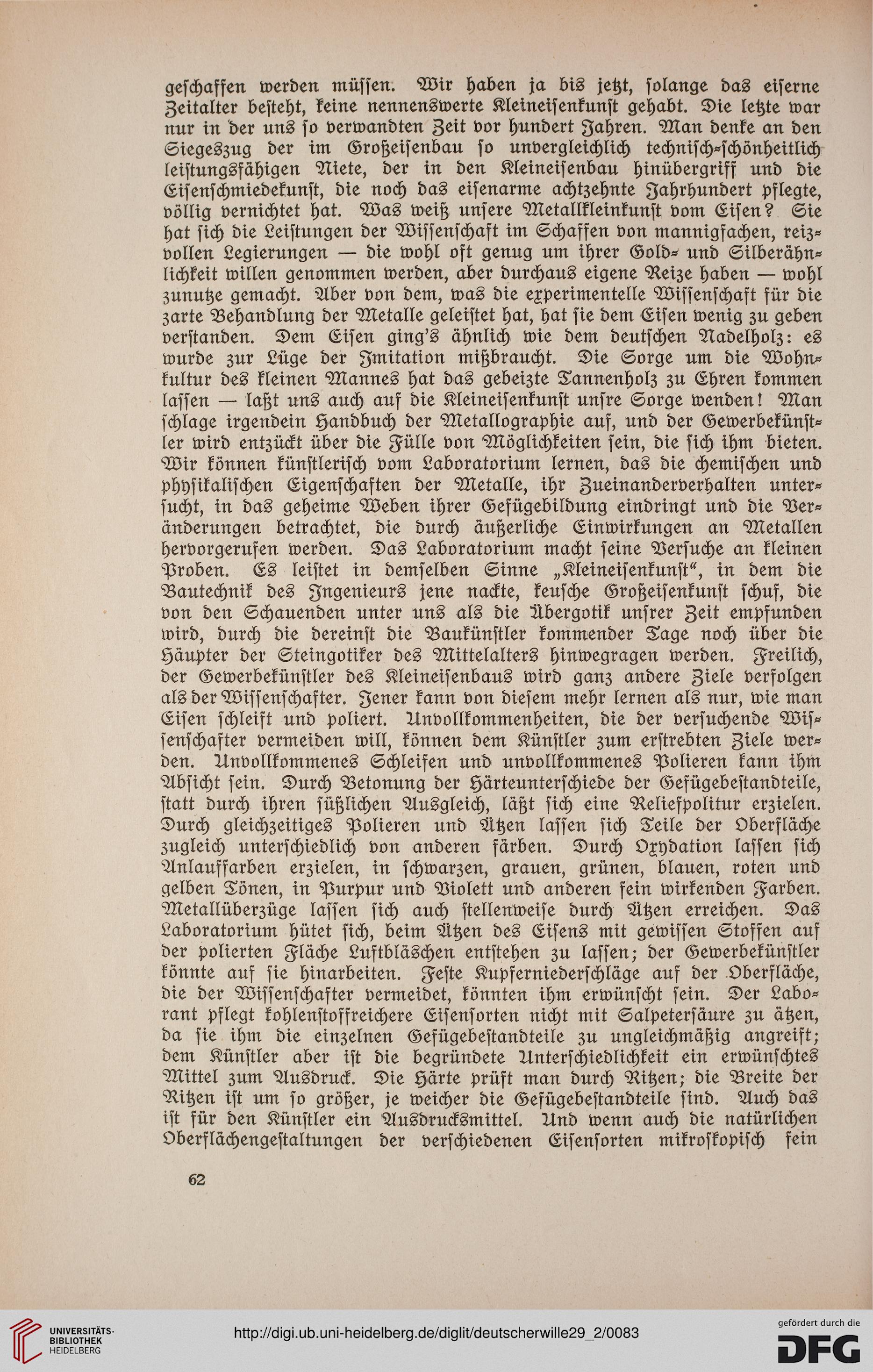geschaffen werden müssen. Wir haben ja bis jetzt, solange das eiserne
Zeitalter besteht, keine nennenswerte Kleineisenkunst gehabt. Die letzte war
nur in der uns so verwandten Zeit vor hundert Iahren. Man denke an den
Siegeszug der im Großeisenbau so unvergleichlich technisch-schönheitlich
leistungsfähigen Niete, der in den Kleineisenbau hinübergrisf und die
Eisenschmiedekunst, die noch das eisenarme achtzehnte Iahrhundert pflegte,
völlig vernichtet hat. Was weiß unsere Metallkleinkunst vom Eisen? Sie
hat sich die Leistungen der Wissenschaft im Schaffen von mannigfachen, reiz«
vollen Legierungen — die wohl oft genug um ihrer Gold- und Silberahn--
lichkeit willen genommen werden, aber durchaus eigene Reize haben — wohl
zunutze gemacht. Aber von dem, was die experimentelle Wissenschaft für die
zarte Behandlung der Metalle geleistet hat, hat sie dem Eisen wenig zu geben
verstanden. Dem Lisen ging's ähnlich wie dem deutschen Badelholz: es
wurde zur Lüge der Imitation mißbraucht. Die Sorge um die Wohw-
kultur des kleinen Mannes hat das gebeizte Tannenholz zu Ehren kommen
lassen — laßt uns auch auf die Kleineisenkunst unsre Sorge wenden! Man
schlage irgendein Handbuch der Metallographie auf, und der Gewerbekünst«
ler wird entzückt über die Fülle von Möglichkeiten sein, die sich ihm bieten.
Wir können künstlerisch vom Laboratorium lernen, das die chemischen und
physikalischen Eigenschaften der Metalle, ihr Zueinanderverhalten unter«
sucht, in das geheime Weben ihrer Gefügebildung eindringt und die Ver-
änderungen betrachtet, die durch äußerliche Einwirkungen an Metallen
hervorgerufen werden. Das Laboratorium macht seine Versuche an kleinen
Proben. Ls leistet in demselben Sinne „Kleineisenkunst", in dem die
Bautechnik des Ingenieurs jene nackte, keusche Großeisenkunst schuf, die
von den Schauenden unter uns als die Äbergotik unsrer Zeit empfunden
wird, durch die dereinst die Baukünstler kommender Tage noch über die
tzäupter der Steingotiker des Mittelalters hinwegragen werden. Freilich,
der Gewerbekünstler des Kleineisenbaus wird ganz andere Ziele verfolgen
als der Wissenschafter. Iener kann von diesem mehr lernen als nur, wie man
Eisen schleift und poliert. Anvollkommenheiten, die der versuchende Wis-
senschafter vermeiden will, können dem Künstler zum erstrebten Ziele wer--
den. Anvollkommenes Schleifen und unvollkommenes Polieren kann ihm
Absicht sein. Durch Betonung der tzärteunterschiede der Gefügebestandteile,
statt durch ihren süßlichen Ausgleich, läßt sich eine Reliefpolitur erzielen.
Durch gleichzeitiges Polieren und Atzen lassen sich Teile der Oberfläche
zugleich unterschiedlich von anderen färben. Durch Oxydation lassen sich
Anlauffarben erzielen, in schwarzen, grauen, grünen, blauen, roten und
gelben Tönen, in Purpur und Violett und anderen fein wirkenden Farben.
Metallüberzüge lassen sich auch stellenweise durch Atzen erreichen. Das
Laboratorium hütet sich, beim Atzen des Eisens mit gewissen Stoffen auf
der polierten Fläche Luftbläschen entstehen zu lassen; der Gewerbekünstler
könnte auf sie hinarbeiten. Feste Kupferniederschläge auf der Oberfläche,
die der Wissenschafter vermeidet, könnten ihm erwünscht sein. Der Labo-
rant pflegt kohlenstoffreichere Eisensorten nicht mit Salpetersäure zu ätzen,
da sie ihm die einzelnen Gefügebestandteile zu ungleichmäßig angreift;
dem Künstler aber ist die begründete Anterschiedlichkeit ein erwünschtes
Mittel zum Ausdruck. Die tzärte prüft man durch Ritzen; die Breite der
Ritzen ist um so größer, je weicher die Gefügebestandteile sind. Auch das
ist für den Künstler ein Ausdrucksmittel. And wenn auch die natürlichen
Oberflächengestaltungen der verschiedenen Eisensorten mikroskopisch fein
62
Zeitalter besteht, keine nennenswerte Kleineisenkunst gehabt. Die letzte war
nur in der uns so verwandten Zeit vor hundert Iahren. Man denke an den
Siegeszug der im Großeisenbau so unvergleichlich technisch-schönheitlich
leistungsfähigen Niete, der in den Kleineisenbau hinübergrisf und die
Eisenschmiedekunst, die noch das eisenarme achtzehnte Iahrhundert pflegte,
völlig vernichtet hat. Was weiß unsere Metallkleinkunst vom Eisen? Sie
hat sich die Leistungen der Wissenschaft im Schaffen von mannigfachen, reiz«
vollen Legierungen — die wohl oft genug um ihrer Gold- und Silberahn--
lichkeit willen genommen werden, aber durchaus eigene Reize haben — wohl
zunutze gemacht. Aber von dem, was die experimentelle Wissenschaft für die
zarte Behandlung der Metalle geleistet hat, hat sie dem Eisen wenig zu geben
verstanden. Dem Lisen ging's ähnlich wie dem deutschen Badelholz: es
wurde zur Lüge der Imitation mißbraucht. Die Sorge um die Wohw-
kultur des kleinen Mannes hat das gebeizte Tannenholz zu Ehren kommen
lassen — laßt uns auch auf die Kleineisenkunst unsre Sorge wenden! Man
schlage irgendein Handbuch der Metallographie auf, und der Gewerbekünst«
ler wird entzückt über die Fülle von Möglichkeiten sein, die sich ihm bieten.
Wir können künstlerisch vom Laboratorium lernen, das die chemischen und
physikalischen Eigenschaften der Metalle, ihr Zueinanderverhalten unter«
sucht, in das geheime Weben ihrer Gefügebildung eindringt und die Ver-
änderungen betrachtet, die durch äußerliche Einwirkungen an Metallen
hervorgerufen werden. Das Laboratorium macht seine Versuche an kleinen
Proben. Ls leistet in demselben Sinne „Kleineisenkunst", in dem die
Bautechnik des Ingenieurs jene nackte, keusche Großeisenkunst schuf, die
von den Schauenden unter uns als die Äbergotik unsrer Zeit empfunden
wird, durch die dereinst die Baukünstler kommender Tage noch über die
tzäupter der Steingotiker des Mittelalters hinwegragen werden. Freilich,
der Gewerbekünstler des Kleineisenbaus wird ganz andere Ziele verfolgen
als der Wissenschafter. Iener kann von diesem mehr lernen als nur, wie man
Eisen schleift und poliert. Anvollkommenheiten, die der versuchende Wis-
senschafter vermeiden will, können dem Künstler zum erstrebten Ziele wer--
den. Anvollkommenes Schleifen und unvollkommenes Polieren kann ihm
Absicht sein. Durch Betonung der tzärteunterschiede der Gefügebestandteile,
statt durch ihren süßlichen Ausgleich, läßt sich eine Reliefpolitur erzielen.
Durch gleichzeitiges Polieren und Atzen lassen sich Teile der Oberfläche
zugleich unterschiedlich von anderen färben. Durch Oxydation lassen sich
Anlauffarben erzielen, in schwarzen, grauen, grünen, blauen, roten und
gelben Tönen, in Purpur und Violett und anderen fein wirkenden Farben.
Metallüberzüge lassen sich auch stellenweise durch Atzen erreichen. Das
Laboratorium hütet sich, beim Atzen des Eisens mit gewissen Stoffen auf
der polierten Fläche Luftbläschen entstehen zu lassen; der Gewerbekünstler
könnte auf sie hinarbeiten. Feste Kupferniederschläge auf der Oberfläche,
die der Wissenschafter vermeidet, könnten ihm erwünscht sein. Der Labo-
rant pflegt kohlenstoffreichere Eisensorten nicht mit Salpetersäure zu ätzen,
da sie ihm die einzelnen Gefügebestandteile zu ungleichmäßig angreift;
dem Künstler aber ist die begründete Anterschiedlichkeit ein erwünschtes
Mittel zum Ausdruck. Die tzärte prüft man durch Ritzen; die Breite der
Ritzen ist um so größer, je weicher die Gefügebestandteile sind. Auch das
ist für den Künstler ein Ausdrucksmittel. And wenn auch die natürlichen
Oberflächengestaltungen der verschiedenen Eisensorten mikroskopisch fein
62