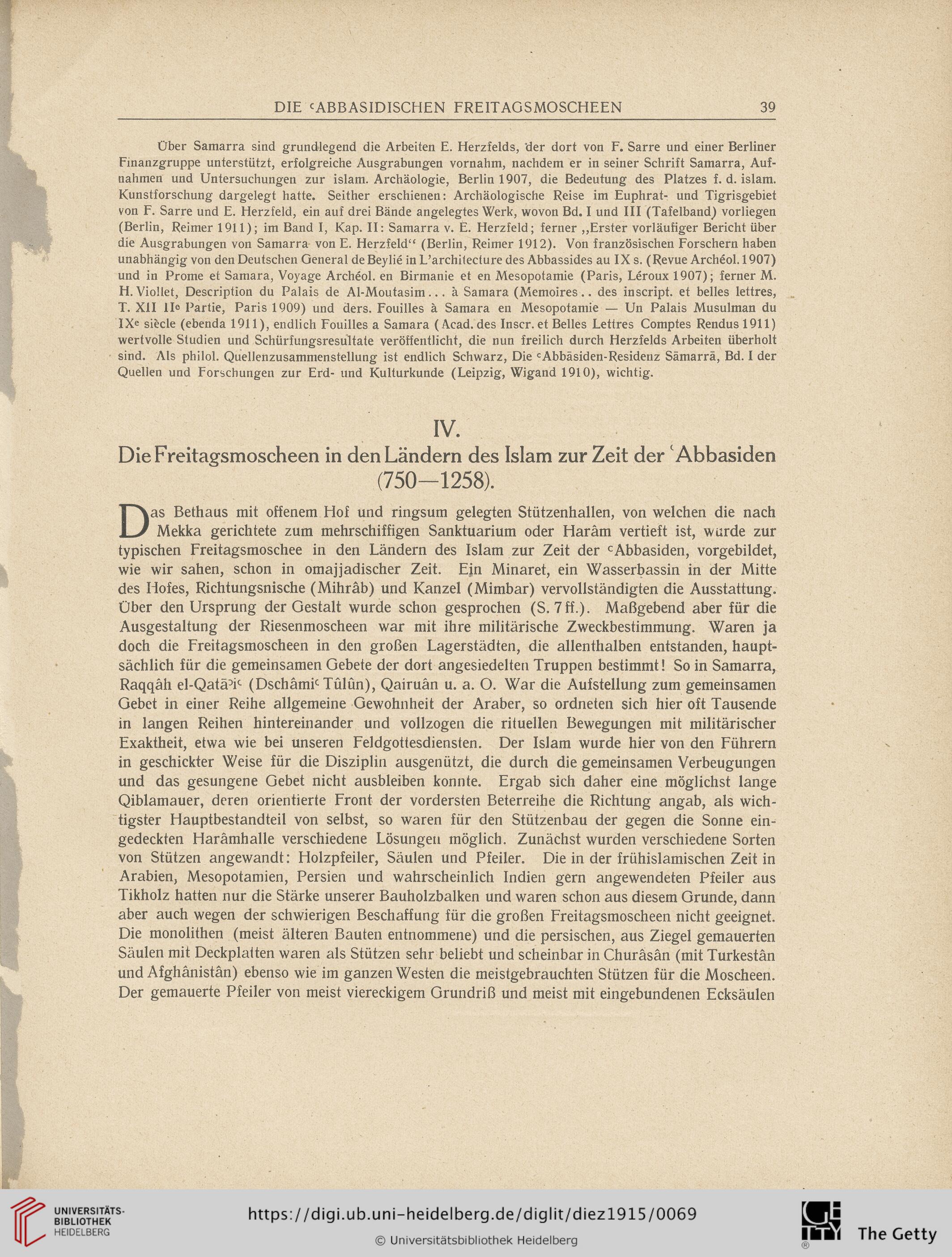DIE cABBASIDISCHEN FREITAGSMOSCHEEN
39
Über Samarra sind grundlegend die Arbeiten E. Herzfelds, ‘der dort von F. Sarre und einer Berliner
Finanzgruppe unterstützt, erfolgreiche Ausgrabungen vornahm, nachdem er in seiner Schrift Samarra, Auf-
nahmen und Untersuchungen zur islam. Archäologie, Berlin 1907, die Bedeutung des Platzes f. d. islam.
Kunstforschung dargelegt hatte. Seither erschienen: Archäologische Reise im Euphrat- und Tigrisgebiet
von F. Sarre und E. Herzfeld, ein auf drei Bände angelegtes Werk, wovon Bd. I und III (Tafelband) vorliegen
(Berlin, Reimer 1911); im Band I, Kap. II: Samarra v. E. Herzfeld; ferner „Erster vorläufiger Bericht über
die Ausgrabungen von Samarra von E. Herzfeld“ (Berlin, Reimer 1912). Von französischen Forschern haben
unabhängig von den Deutschen General deBeylie inL’architecture des Abbassides au IX s. (Revue Archeol.1907)
und in Prome et Samara, Voyage Archeol. en Birmanie et en Mesopotamie (Paris, Leroux 1907); ferner M.
H.Viollet, Description du Palais de Al-Moutasim... ä Samara (Memoires.. des inscript. et beiles lettres,
T. XII He Partie, Paris 1909) und ders. Fouilles ä Samara en Mesopotamie — Un Palais Musulman du
IXe siede (ebenda 1911), endlich Fouilles a Samara (Acad. des Inscr. et Beiles Lettres Comptes Rendusl911)
wertvolle Studien und Schürfungsresultate veröffentlicht, die nun freilich durch Herzfelds Arbeiten überholt
sind. Als philol. Quellenzusammenstellung ist endlich Schwarz, Die cAbbäsiden-Residenz Sämarrä, Bd. I der
Quellen und Forschungen zur Erd- und Kulturkunde (Leipzig, Wigand 1910), wichtig.
IV.
Die Freitagsmoscheen in den Ländern des Islam zurZeit der ‘Abbasiden
(750-1258).
Das Bethaus mit offenem Hof und ringsum gelegten Stützenhallen, von welchen die nach
Mekka gerichtete zum mehrschiffigen Sanktuarium oder Haram vertieft ist, wurde zur
typischen Freitagsmoschee in den Ländern des Islam zur Zeit der cAbbasiden, vorgebildet,
wie wir sahen, schon in omajjadischer Zeit. Ein Minaret, ein Wasserbassin in der Mitte
des Hofes, Richtungsnische (Mihräb) und Kanzel (Mimbar) vervollständigten die Ausstattung.
Über den Ursprung der Gestalt wurde schon gesprochen (S. 7ff.). Maßgebend aber für die
Ausgestaltung der Riesenmoscheen war mit ihre militärische Zweckbestimmung. Waren ja
doch die Freitagsmoscheen in den großen Lagerstädten, die allenthalben entstanden, haupt-
sächlich für die gemeinsamen Gebete der dort angesiedelten Truppen bestimmt! So in Samarra,
Raqqäh el-Qatä3ic (Dschämic Tulun), Qairuän u. a. O. War die Aufstellung zum gemeinsamen
Gebet in einer Reihe allgemeine Gewohnheit der Araber, so ordneten sich hier oft Tausende
in langen Reihen hintereinander und vollzogen die rituellen Bewegungen mit militärischer
Exaktheit, etwa wie bei unseren Feldgottesdiensten. Der Islam wurde hier von den Führern
in geschickter Weise für die Disziplin ausgenützt, die durch die gemeinsamen Verbeugungen
und das gesungene Gebet nicht ausbleiben konnte. Ergab sich daher eine möglichst lange
Qiblamauer, deren orientierte Front der vordersten Beterreihe die Richtung angab, als wich-
tigster Hauptbestandteil von selbst, so waren für den Stützenbau der gegen die Sonne ein-
gedeckten Harämhalle verschiedene Lösungen möglich. Zunächst wurden verschiedene Sorten
von Stützen angewandt: Holzpfeiler, Säulen und Pfeiler. Die in der frühislamischen Zeit in
Arabien, Mesopotamien, Persien und wahrscheinlich Indien gern angewendeten Pfeiler aus
Tikholz hatten nur die Stärke unserer Bauholzbalken und waren schon aus diesem Grunde, dann
aber auch wegen der schwierigen Beschaffung für die großen Freitagsmoscheen nicht geeignet.
Die monolithen (meist älteren Bauten entnommene) und die persischen, aus Ziegel gemauerten
Säulen mit Deckplatten waren als Stützen sehr beliebt und scheinbar in Churäsän (mit Turkestan
und Afghanistan) ebenso wie im ganzen Westen die meistgebrauchten Stützen für die Moscheen.
Der gemauerte Pfeiler von meist viereckigem Grundriß und meist mit eingebundenen Ecksäulen
39
Über Samarra sind grundlegend die Arbeiten E. Herzfelds, ‘der dort von F. Sarre und einer Berliner
Finanzgruppe unterstützt, erfolgreiche Ausgrabungen vornahm, nachdem er in seiner Schrift Samarra, Auf-
nahmen und Untersuchungen zur islam. Archäologie, Berlin 1907, die Bedeutung des Platzes f. d. islam.
Kunstforschung dargelegt hatte. Seither erschienen: Archäologische Reise im Euphrat- und Tigrisgebiet
von F. Sarre und E. Herzfeld, ein auf drei Bände angelegtes Werk, wovon Bd. I und III (Tafelband) vorliegen
(Berlin, Reimer 1911); im Band I, Kap. II: Samarra v. E. Herzfeld; ferner „Erster vorläufiger Bericht über
die Ausgrabungen von Samarra von E. Herzfeld“ (Berlin, Reimer 1912). Von französischen Forschern haben
unabhängig von den Deutschen General deBeylie inL’architecture des Abbassides au IX s. (Revue Archeol.1907)
und in Prome et Samara, Voyage Archeol. en Birmanie et en Mesopotamie (Paris, Leroux 1907); ferner M.
H.Viollet, Description du Palais de Al-Moutasim... ä Samara (Memoires.. des inscript. et beiles lettres,
T. XII He Partie, Paris 1909) und ders. Fouilles ä Samara en Mesopotamie — Un Palais Musulman du
IXe siede (ebenda 1911), endlich Fouilles a Samara (Acad. des Inscr. et Beiles Lettres Comptes Rendusl911)
wertvolle Studien und Schürfungsresultate veröffentlicht, die nun freilich durch Herzfelds Arbeiten überholt
sind. Als philol. Quellenzusammenstellung ist endlich Schwarz, Die cAbbäsiden-Residenz Sämarrä, Bd. I der
Quellen und Forschungen zur Erd- und Kulturkunde (Leipzig, Wigand 1910), wichtig.
IV.
Die Freitagsmoscheen in den Ländern des Islam zurZeit der ‘Abbasiden
(750-1258).
Das Bethaus mit offenem Hof und ringsum gelegten Stützenhallen, von welchen die nach
Mekka gerichtete zum mehrschiffigen Sanktuarium oder Haram vertieft ist, wurde zur
typischen Freitagsmoschee in den Ländern des Islam zur Zeit der cAbbasiden, vorgebildet,
wie wir sahen, schon in omajjadischer Zeit. Ein Minaret, ein Wasserbassin in der Mitte
des Hofes, Richtungsnische (Mihräb) und Kanzel (Mimbar) vervollständigten die Ausstattung.
Über den Ursprung der Gestalt wurde schon gesprochen (S. 7ff.). Maßgebend aber für die
Ausgestaltung der Riesenmoscheen war mit ihre militärische Zweckbestimmung. Waren ja
doch die Freitagsmoscheen in den großen Lagerstädten, die allenthalben entstanden, haupt-
sächlich für die gemeinsamen Gebete der dort angesiedelten Truppen bestimmt! So in Samarra,
Raqqäh el-Qatä3ic (Dschämic Tulun), Qairuän u. a. O. War die Aufstellung zum gemeinsamen
Gebet in einer Reihe allgemeine Gewohnheit der Araber, so ordneten sich hier oft Tausende
in langen Reihen hintereinander und vollzogen die rituellen Bewegungen mit militärischer
Exaktheit, etwa wie bei unseren Feldgottesdiensten. Der Islam wurde hier von den Führern
in geschickter Weise für die Disziplin ausgenützt, die durch die gemeinsamen Verbeugungen
und das gesungene Gebet nicht ausbleiben konnte. Ergab sich daher eine möglichst lange
Qiblamauer, deren orientierte Front der vordersten Beterreihe die Richtung angab, als wich-
tigster Hauptbestandteil von selbst, so waren für den Stützenbau der gegen die Sonne ein-
gedeckten Harämhalle verschiedene Lösungen möglich. Zunächst wurden verschiedene Sorten
von Stützen angewandt: Holzpfeiler, Säulen und Pfeiler. Die in der frühislamischen Zeit in
Arabien, Mesopotamien, Persien und wahrscheinlich Indien gern angewendeten Pfeiler aus
Tikholz hatten nur die Stärke unserer Bauholzbalken und waren schon aus diesem Grunde, dann
aber auch wegen der schwierigen Beschaffung für die großen Freitagsmoscheen nicht geeignet.
Die monolithen (meist älteren Bauten entnommene) und die persischen, aus Ziegel gemauerten
Säulen mit Deckplatten waren als Stützen sehr beliebt und scheinbar in Churäsän (mit Turkestan
und Afghanistan) ebenso wie im ganzen Westen die meistgebrauchten Stützen für die Moscheen.
Der gemauerte Pfeiler von meist viereckigem Grundriß und meist mit eingebundenen Ecksäulen