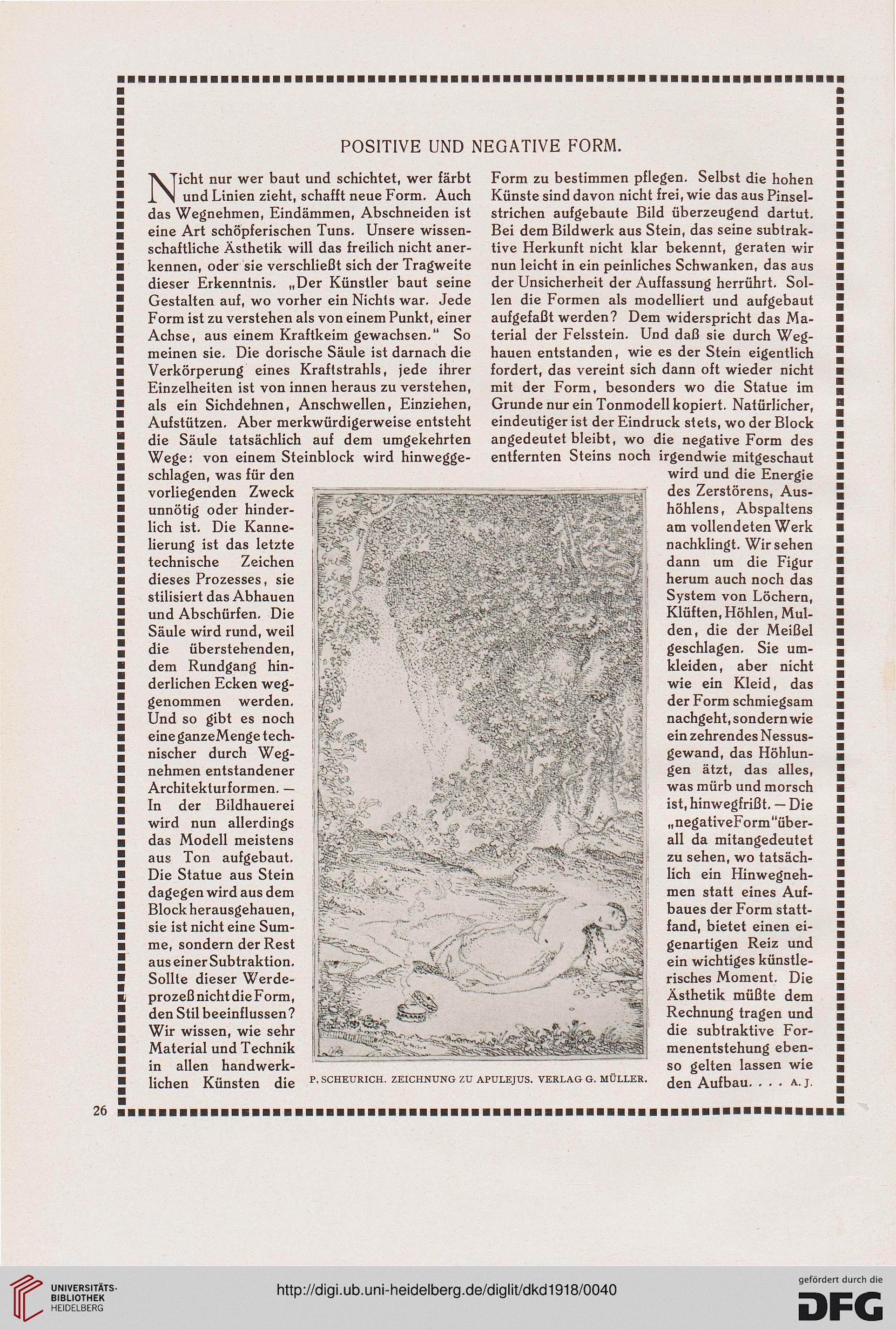POSITIVE UND NEGATIVE FORM.
Nicht nur wer baut und schichtet, wer färbt
und Linien zieht, schafft neue Form. Auch
das Wegnehmen, Eindämmen, Abschneiden ist
eine Art schöpferischen Tuns. Unsere wissen-
schaftliche Ästhetik will das freilich nicht aner-
kennen, oder sie verschließt sich der Tragweite
dieser Erkenntnis. „Der Künstler baut seine
Gestalten auf, wo vorher ein Nichts war. Jede
Form ist zu verstehen als von einem Punkt, einer
Achse, aus einem Kraftkeim gewachsen." So
meinen sie. Die dorische Säule ist darnach die
Verkörperung eines Kraftstrahls, jede ihrer
Einzelheiten ist von innen heraus zu verstehen,
als ein Sichdehnen, Anschwellen, Einziehen,
Aufstützen. Aber merkwürdigerweise entsteht
die Säule tatsächlich auf dem umgekehrten
Wege: von einem Steinblock wird hinwegge-
schlagen, was für den
vorliegenden Zweck
unnötig oder hinder-
lich ist. Die Kanne-
lierung ist das letzte
technische Zeichen
dieses Prozesses, sie
stilisiert das Abhauen
und Abschürfen. Die
Säule wird rund, weil
die überstehenden,
dem Rundgang hin-
derlichen Ecken weg-
genommen werden.
Und so gibt es noch
eine ganzeMenge tech-
nischer durch Weg-
nehmen entstandener
Architekturformen. —
In der Bildhauerei
wird nun allerdings
das Modell meistens
aus Ton aufgebaut.
Die Statue aus Stein
dagegen wird aus dem
Block herausgehauen,
sie ist nicht eine Sum-
me, sondern der Rest
aus einerSubtraktion.
Sollte dieser Werde-
prozeß nicht die Form,
den Stil beeinflussen?
Wir wissen, wie sehr
Material und Technik
in allen handwerk-
lichen Künsten die Pi scheurich. Zeichnung zu apulejus. verlag g. Müller.
Form zu bestimmen pflegen. Selbst die hohen
Künste sind davon nicht frei, wie das aus Pinsel-
strichen aufgebaute Bild überzeugend dartut.
Bei dem Bildwerk aus Stein, das seine subtrak-
tive Herkunft nicht klar bekennt, geraten wir
nun leicht in ein peinliches Schwanken, das aus
der Unsicherheit der Auffassung herrührt. Sol-
len die Formen als modelliert und aufgebaut
aufgefaßt werden? Dem widerspricht das Ma-
terial der Felsstein. Und daß sie durch Weg-
hauen entstanden, wie es der Stein eigentlich
fordert, das vereint sich dann oft wieder nicht
mit der Form, besonders wo die Statue im
Grunde nur ein Tonmodell kopiert. Natürlicher,
eindeutiger ist der Eindruck stets, wo der Block
angedeutet bleibt, wo die negative Form des
entfernten Steins noch irgendwie mitgeschaut
wird und die Energie
des Zerstörens, Aus-
höhlens, Abspaltens
am vollendeten Werk
nachklingt. Wir sehen
dann um die Figur
herum auch noch das
System von Löchern,
Klüften, Höhlen, Mul-
den, die der Meißel
geschlagen. Sie um-
kleiden , aber nicht
wie ein Kleid, das
der Form schmiegsam
nachgeht, sondern wie
ein zehrendes Nessus-
gewand, das Höhlun-
gen ätzt, das alles,
was mürb und morsch
ist, hinwegfrißt. — Die
„negativeForm'uber-
all da mitangedeutet
zu sehen, wo tatsäch-
lich ein Hinwegneh-
men statt eines Auf-
baues der Form statt-
fand, bietet einen ei-
genartigen Reiz und
ein wichtiges künstle-
risches Moment. Die
Ästhetik müßte dem
Rechnung tragen und
die subtraktive For-
menentstehung eben-
so gelten lassen wie
den Aufbau. ... a. j.
Nicht nur wer baut und schichtet, wer färbt
und Linien zieht, schafft neue Form. Auch
das Wegnehmen, Eindämmen, Abschneiden ist
eine Art schöpferischen Tuns. Unsere wissen-
schaftliche Ästhetik will das freilich nicht aner-
kennen, oder sie verschließt sich der Tragweite
dieser Erkenntnis. „Der Künstler baut seine
Gestalten auf, wo vorher ein Nichts war. Jede
Form ist zu verstehen als von einem Punkt, einer
Achse, aus einem Kraftkeim gewachsen." So
meinen sie. Die dorische Säule ist darnach die
Verkörperung eines Kraftstrahls, jede ihrer
Einzelheiten ist von innen heraus zu verstehen,
als ein Sichdehnen, Anschwellen, Einziehen,
Aufstützen. Aber merkwürdigerweise entsteht
die Säule tatsächlich auf dem umgekehrten
Wege: von einem Steinblock wird hinwegge-
schlagen, was für den
vorliegenden Zweck
unnötig oder hinder-
lich ist. Die Kanne-
lierung ist das letzte
technische Zeichen
dieses Prozesses, sie
stilisiert das Abhauen
und Abschürfen. Die
Säule wird rund, weil
die überstehenden,
dem Rundgang hin-
derlichen Ecken weg-
genommen werden.
Und so gibt es noch
eine ganzeMenge tech-
nischer durch Weg-
nehmen entstandener
Architekturformen. —
In der Bildhauerei
wird nun allerdings
das Modell meistens
aus Ton aufgebaut.
Die Statue aus Stein
dagegen wird aus dem
Block herausgehauen,
sie ist nicht eine Sum-
me, sondern der Rest
aus einerSubtraktion.
Sollte dieser Werde-
prozeß nicht die Form,
den Stil beeinflussen?
Wir wissen, wie sehr
Material und Technik
in allen handwerk-
lichen Künsten die Pi scheurich. Zeichnung zu apulejus. verlag g. Müller.
Form zu bestimmen pflegen. Selbst die hohen
Künste sind davon nicht frei, wie das aus Pinsel-
strichen aufgebaute Bild überzeugend dartut.
Bei dem Bildwerk aus Stein, das seine subtrak-
tive Herkunft nicht klar bekennt, geraten wir
nun leicht in ein peinliches Schwanken, das aus
der Unsicherheit der Auffassung herrührt. Sol-
len die Formen als modelliert und aufgebaut
aufgefaßt werden? Dem widerspricht das Ma-
terial der Felsstein. Und daß sie durch Weg-
hauen entstanden, wie es der Stein eigentlich
fordert, das vereint sich dann oft wieder nicht
mit der Form, besonders wo die Statue im
Grunde nur ein Tonmodell kopiert. Natürlicher,
eindeutiger ist der Eindruck stets, wo der Block
angedeutet bleibt, wo die negative Form des
entfernten Steins noch irgendwie mitgeschaut
wird und die Energie
des Zerstörens, Aus-
höhlens, Abspaltens
am vollendeten Werk
nachklingt. Wir sehen
dann um die Figur
herum auch noch das
System von Löchern,
Klüften, Höhlen, Mul-
den, die der Meißel
geschlagen. Sie um-
kleiden , aber nicht
wie ein Kleid, das
der Form schmiegsam
nachgeht, sondern wie
ein zehrendes Nessus-
gewand, das Höhlun-
gen ätzt, das alles,
was mürb und morsch
ist, hinwegfrißt. — Die
„negativeForm'uber-
all da mitangedeutet
zu sehen, wo tatsäch-
lich ein Hinwegneh-
men statt eines Auf-
baues der Form statt-
fand, bietet einen ei-
genartigen Reiz und
ein wichtiges künstle-
risches Moment. Die
Ästhetik müßte dem
Rechnung tragen und
die subtraktive For-
menentstehung eben-
so gelten lassen wie
den Aufbau. ... a. j.