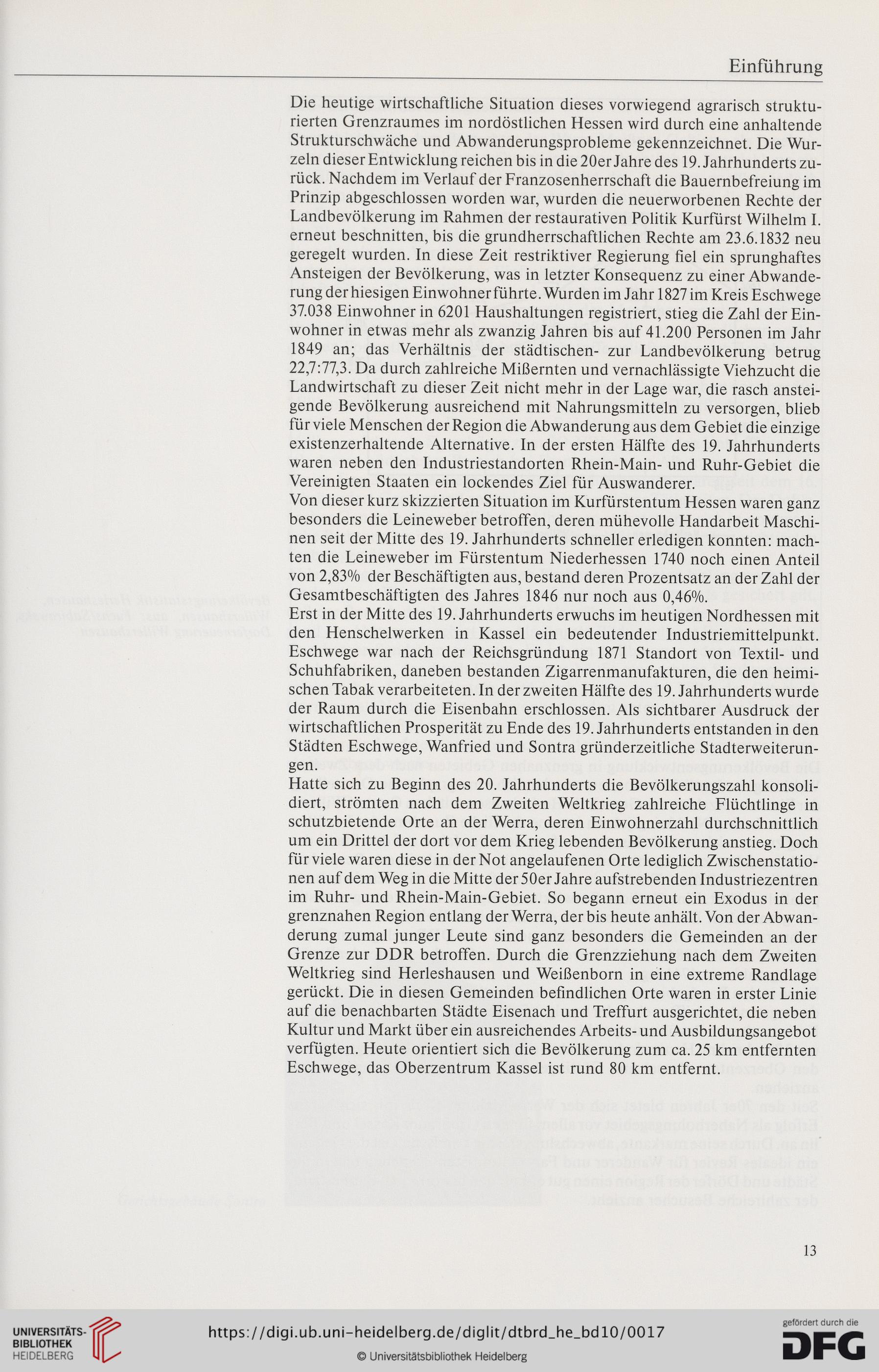Einführung
Die heutige wirtschaftliche Situation dieses vorwiegend agrarisch struktu-
rierten Grenzraumes im nordöstlichen Hessen wird durch eine anhaltende
Strukturschwäche und Abwanderungsprobleme gekennzeichnet. Die Wur-
zeln dieser Entwicklung reichen bis in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts zu-
rück. Nachdem im Verlauf der Franzosenherrschaft die Bauernbefreiung im
Prinzip abgeschlossen worden war, wurden die neuerworbenen Rechte der
Landbevölkerung im Rahmen der restaurativen Politik Kurfürst Wilhelm I.
erneut beschnitten, bis die grundherrschaftlichen Rechte am 23.6.1832 neu
geregelt wurden. In diese Zeit restriktiver Regierung fiel ein sprunghaftes
Ansteigen der Bevölkerung, was in letzter Konsequenz zu einer Abwande-
rung der hiesigen Einwohner führte. Wurden im Jahr 1827 im Kreis Eschwege
37.038 Einwohner in 6201 Haushaltungen registriert, stieg die Zahl der Ein-
wohner in etwas mehr als zwanzig Jahren bis auf 41.200 Personen im Jahr
1849 an; das Verhältnis der städtischen- zur Landbevölkerung betrug
22,7:77,3. Da durch zahlreiche Mißernten und vernachlässigte Viehzucht die
Landwirtschaft zu dieser Zeit nicht mehr in der Lage war, die rasch anstei-
gende Bevölkerung ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen, blieb
für viele Menschen der Region die Abwanderung aus dem Gebiet die einzige
existenzerhaltende Alternative. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
waren neben den Industriestandorten Rhein-Main- und Ruhr-Gebiet die
Vereinigten Staaten ein lockendes Ziel für Auswanderer.
Von dieser kurz skizzierten Situation im Kurfürstentum Hessen waren ganz
besonders die Leineweber betroffen, deren mühevolle Handarbeit Maschi-
nen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts schneller erledigen konnten: mach-
ten die Leineweber im Fürstentum Niederhessen 1740 noch einen Anteil
von 2,83% der Beschäftigten aus, bestand deren Prozentsatz an der Zahl der
Gesamtbeschäftigten des Jahres 1846 nur noch aus 0,46%.
Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts erwuchs im heutigen Nordhessen mit
den Henschelwerken in Kassel ein bedeutender Industriemittelpunkt.
Eschwege war nach der Reichsgründung 1871 Standort von Textil- und
Schuhfabriken, daneben bestanden Zigarrenmanufakturen, die den heimi-
schen Tabak verarbeiteten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde
der Raum durch die Eisenbahn erschlossen. Als sichtbarer Ausdruck der
wirtschaftlichen Prosperität zu Ende des 19. Jahrhunderts entstanden in den
Städten Eschwege, Wanfried und Sontra gründerzeitliche Stadterweiterun-
gen.
Hatte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Bevölkerungszahl konsoli-
diert, strömten nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Flüchtlinge in
schutzbietende Orte an der Werra, deren Einwohnerzahl durchschnittlich
um ein Drittel der dort vor dem Krieg lebenden Bevölkerung anstieg. Doch
für viele waren diese in der Not angelaufenen Orte lediglich Zwischenstatio-
nen auf dem Weg in die Mitte der 50er Jahre aufstrebenden Industriezentren
im Ruhr- und Rhein-Main-Gebiet. So begann erneut ein Exodus in der
grenznahen Region entlang der Werra, der bis heute anhält. Von der Abwan-
derung zumal junger Leute sind ganz besonders die Gemeinden an der
Grenze zur DDR betroffen. Durch die Grenzziehung nach dem Zweiten
Weltkrieg sind Herleshausen und Weißenborn in eine extreme Randlage
gerückt. Die in diesen Gemeinden befindlichen Orte waren in erster Linie
auf die benachbarten Städte Eisenach und Treffurt ausgerichtet, die neben
Kultur und Markt über ein ausreichendes Arbeits- und Ausbildungsangebot
verfügten. Heute orientiert sich die Bevölkerung zum ca. 25 km entfernten
Eschwege, das Oberzentrum Kassel ist rund 80 km entfernt.
13
Die heutige wirtschaftliche Situation dieses vorwiegend agrarisch struktu-
rierten Grenzraumes im nordöstlichen Hessen wird durch eine anhaltende
Strukturschwäche und Abwanderungsprobleme gekennzeichnet. Die Wur-
zeln dieser Entwicklung reichen bis in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts zu-
rück. Nachdem im Verlauf der Franzosenherrschaft die Bauernbefreiung im
Prinzip abgeschlossen worden war, wurden die neuerworbenen Rechte der
Landbevölkerung im Rahmen der restaurativen Politik Kurfürst Wilhelm I.
erneut beschnitten, bis die grundherrschaftlichen Rechte am 23.6.1832 neu
geregelt wurden. In diese Zeit restriktiver Regierung fiel ein sprunghaftes
Ansteigen der Bevölkerung, was in letzter Konsequenz zu einer Abwande-
rung der hiesigen Einwohner führte. Wurden im Jahr 1827 im Kreis Eschwege
37.038 Einwohner in 6201 Haushaltungen registriert, stieg die Zahl der Ein-
wohner in etwas mehr als zwanzig Jahren bis auf 41.200 Personen im Jahr
1849 an; das Verhältnis der städtischen- zur Landbevölkerung betrug
22,7:77,3. Da durch zahlreiche Mißernten und vernachlässigte Viehzucht die
Landwirtschaft zu dieser Zeit nicht mehr in der Lage war, die rasch anstei-
gende Bevölkerung ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen, blieb
für viele Menschen der Region die Abwanderung aus dem Gebiet die einzige
existenzerhaltende Alternative. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
waren neben den Industriestandorten Rhein-Main- und Ruhr-Gebiet die
Vereinigten Staaten ein lockendes Ziel für Auswanderer.
Von dieser kurz skizzierten Situation im Kurfürstentum Hessen waren ganz
besonders die Leineweber betroffen, deren mühevolle Handarbeit Maschi-
nen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts schneller erledigen konnten: mach-
ten die Leineweber im Fürstentum Niederhessen 1740 noch einen Anteil
von 2,83% der Beschäftigten aus, bestand deren Prozentsatz an der Zahl der
Gesamtbeschäftigten des Jahres 1846 nur noch aus 0,46%.
Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts erwuchs im heutigen Nordhessen mit
den Henschelwerken in Kassel ein bedeutender Industriemittelpunkt.
Eschwege war nach der Reichsgründung 1871 Standort von Textil- und
Schuhfabriken, daneben bestanden Zigarrenmanufakturen, die den heimi-
schen Tabak verarbeiteten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde
der Raum durch die Eisenbahn erschlossen. Als sichtbarer Ausdruck der
wirtschaftlichen Prosperität zu Ende des 19. Jahrhunderts entstanden in den
Städten Eschwege, Wanfried und Sontra gründerzeitliche Stadterweiterun-
gen.
Hatte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Bevölkerungszahl konsoli-
diert, strömten nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Flüchtlinge in
schutzbietende Orte an der Werra, deren Einwohnerzahl durchschnittlich
um ein Drittel der dort vor dem Krieg lebenden Bevölkerung anstieg. Doch
für viele waren diese in der Not angelaufenen Orte lediglich Zwischenstatio-
nen auf dem Weg in die Mitte der 50er Jahre aufstrebenden Industriezentren
im Ruhr- und Rhein-Main-Gebiet. So begann erneut ein Exodus in der
grenznahen Region entlang der Werra, der bis heute anhält. Von der Abwan-
derung zumal junger Leute sind ganz besonders die Gemeinden an der
Grenze zur DDR betroffen. Durch die Grenzziehung nach dem Zweiten
Weltkrieg sind Herleshausen und Weißenborn in eine extreme Randlage
gerückt. Die in diesen Gemeinden befindlichen Orte waren in erster Linie
auf die benachbarten Städte Eisenach und Treffurt ausgerichtet, die neben
Kultur und Markt über ein ausreichendes Arbeits- und Ausbildungsangebot
verfügten. Heute orientiert sich die Bevölkerung zum ca. 25 km entfernten
Eschwege, das Oberzentrum Kassel ist rund 80 km entfernt.
13