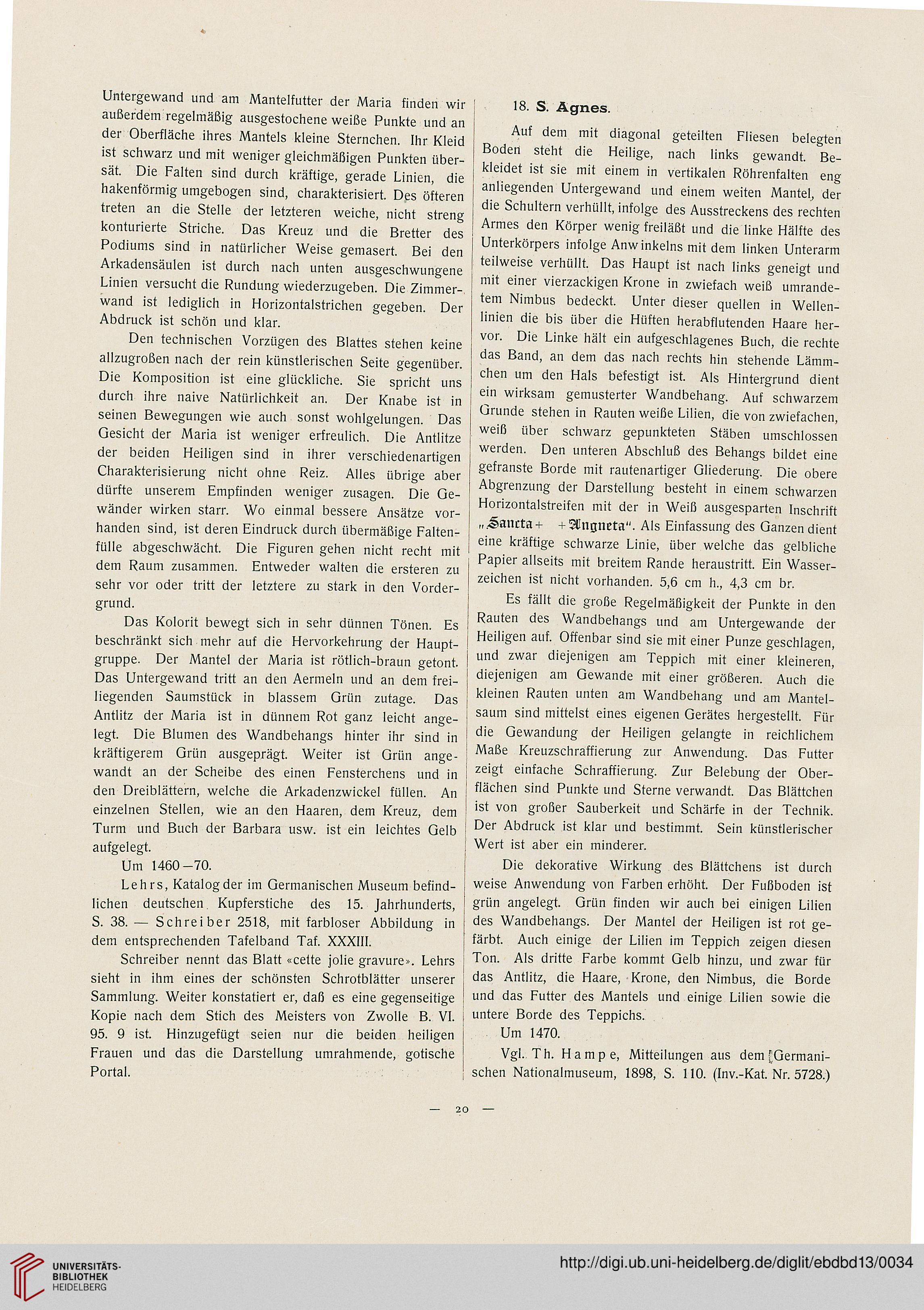Untergewand und am Mantelfutter der Maria finden wir
außerdem regelmäßig ausgestochene weiße Punkte und an
der Oberfläche ihres Mantels kleine Sternchen. Ihr Kleid
ist schwarz und mit weniger gleichmäßigen Punkten über-
sät. Die Falten sind durch kräftige, gerade Linien, die
hakenförmig umgebogen sind, charakterisiert. Des öfteren
treten an die Stelle der letzteren weiche, nicht streng
konturierte Striche. Das Kreuz und die Bretter des
Podiums sind in natürlicher Weise gemasert. Bei den
Arkadensäulen ist durch nach unten ausgeschwungene
Linien versucht die Rundung wiederzugeben. Die Zimmer-
wand ist lediglich in Horizontalstrichen gegeben. Der
Abdruck ist schön und klar.
Den technischen Vorzügen des Blattes stehen keine
allzugroßen nach der rein künstlerischen Seite gegenüber.
Die Komposition ist eine glückliche. Sie spricht uns
durch ihre naive Natürlichkeit an. Der Knabe ist in
seinen Bewegungen wie auch sonst wohlgelungen. Das
Gesicht der Maria ist weniger erfreulich. Die Antlitze
der beiden Heiligen sind in ihrer verschiedenartigen
Charakterisierung nicht ohne Reiz. Alles übrige aber
dürfte unserem Empfinden weniger zusagen. Die Ge-
wänder wirken starr. Wo einmal bessere Ansätze vor-
handen sind, ist deren Eindruck durch übermäßige Falten-
fülle abgeschwächt. Die Figuren gehen nicht recht mit
dem Raum zusammen. Entweder walten die ersteren zu
sehr vor oder tritt der letztere zu stark in den Vorder-
grund.
Das Kolorit bewegt sich in sehr dünnen Tönen. Es
beschränkt sich mehr auf die Hervorkehrung der Haupt-
gruppe. Der Mantel der Maria ist rötlich-braun getont.
Das Untergewand tritt an den Aermeln und an dem frei-
liegenden Saumstück in blassem Grün zutage. Das
Antlitz der Maria ist in dünnem Rot ganz leicht ange-
legt. Die Blumen des Wandbehangs hinter ihr sind in
kräftigerem Grün ausgeprägt. Weiter ist Grün ange-
wandt an der Scheibe des einen Fensterchens und in
den Dreiblättern, welche die Arkadenzwickel füllen. An
einzelnen Stellen, wie an den Haaren, dem Kreuz, dem
Turm und Buch der Barbara usw. ist ein leichtes Gelb
aufgelegt.
Um 1460-70.
Lehrs, Katalog der im Germanischen Museum befind-
lichen deutschen Kupferstiche des 15. Jahrhunderts,
S. 38. — Schreiber 2518, mit farbloser Abbildung in
dem entsprechenden Tafelband Taf. XXXIII.
Schreiber nennt das Blatt «cette jolie gravure». Lehrs
sieht in ihm eines der schönsten Schrotblätter unserer
Sammlung. Weiter konstatiert er, daß es eine gegenseitige
Kopie nach dem Stich des Meisters von Zwolle B. VI.
95. 9 ist. Hinzugefügt seien nur die beiden heiligen
Frauen und das die Darstellung umrahmende, gotische
Portal.
18. S. Agnes.
Auf dem mit diagonal geteilten Fliesen belegten
Boden steht die Heilige, nach links gewandt. Be-
kleidet ist sie mit einem in vertikalen Röhrenfalten eng
anliegenden Untergewand und einem weiten Mantel, der
die Schultern verhüllt, infolge des Ausstreckens des rechten
J Armes den Körper wenig freiläßt und die linke Hälfte des
Unterkörpers infolge Anwinkeins mit dem linken Unterarm
teilweise verhüllt. Das Haupt ist nach links geneigt und
mit einer vierzackigen Krone in zwiefach weiß umrande-
tem Nimbus bedeckt. Unter dieser quellen in Wellen-
linien die bis über die Hüften herabflutenden Haare her-
vor. Die Linke hält ein aufgeschlagenes Buch, die rechte
das Band, an dem das nach rechts hin stehende Lämm-
chen um den Hals befestigt ist. Als Hintergrund dient
ein wirksam gemusterter Wandbehang. Auf schwarzem
Grunde stehen in Rauten weiße Lilien, die von zwiefachen,
weiß über schwarz gepunkteten Stäben umschlossen
werden. Den unteren Abschluß des Behangs bildet eine
gefranste Borde mit rautenartiger Gliederung. Die obere
j Abgrenzung der Darstellung besteht in einem schwarzen
Horizontalstreifen mit der in Weiß ausgesparten Inschrift
,,.4»ancta+ +5Cngneta". Als Einfassung des Ganzen dient
eine kräftige schwarze Linie, über welche das gelbliche
Papier allseits mit breitem Rande heraustritt. Ein Wasser-
zeichen ist nicht vorhanden. 5,6 cm h., 4,3 cm br.
Es fällt die große Regelmäßigkeit der Punkte in den
Rauten des Wandbehangs und am Untergewande der
j Heiligen auf. Offenbar sind sie mit einer Punze geschlagen,
j und zwar diejenigen am Teppich mit einer kleineren,
diejenigen am Gewände mit einer größeren. Auch die
l kleinen Rauten unten am Wandbehang und am Mantel-
! saum sind mittelst eines eigenen Gerätes hergestellt. Für
die Gewandung der Heiligen gelangte in reichlichem
Maße Kreuzschraffierung zur Anwendung. Das Futter
j zeigt einfache Schraffierung. Zur Belebung der Ober-
! flächen sind Punkte und Sterne verwandt. Das Blättchen
ist von großer Sauberkeit und Schärfe in der Technik.
Der Abdruck ist klar und bestimmt. Sein künstlerischer
Wert ist aber ein minderer.
Die dekorative Wirkung des Blättchens ist durch
weise Anwendung von Farben erhöht. Der Fußboden ist
! grün angelegt. Grün finden wir auch bei einigen Lilien
des Wandbehangs. Der Mantel der Heiligen ist rot ge-
färbt. Auch einige der Lilien im Teppich zeigen diesen
Ton. Als dritte Farbe kommt Gelb hinzu, und zwar für
das Antlitz, die Haare, Krone, den Nimbus, die Borde
und das Futter des Mantels und einige Lilien sowie die
untere Borde des Teppichs.
Um 1470.
Vgl. Th. Hampe, Mitteilungen aus dem [Germani-
schen Nationalmuseum, 1898, S. 110. (Inv.-Kat. Nr. 5728.)
20 —
außerdem regelmäßig ausgestochene weiße Punkte und an
der Oberfläche ihres Mantels kleine Sternchen. Ihr Kleid
ist schwarz und mit weniger gleichmäßigen Punkten über-
sät. Die Falten sind durch kräftige, gerade Linien, die
hakenförmig umgebogen sind, charakterisiert. Des öfteren
treten an die Stelle der letzteren weiche, nicht streng
konturierte Striche. Das Kreuz und die Bretter des
Podiums sind in natürlicher Weise gemasert. Bei den
Arkadensäulen ist durch nach unten ausgeschwungene
Linien versucht die Rundung wiederzugeben. Die Zimmer-
wand ist lediglich in Horizontalstrichen gegeben. Der
Abdruck ist schön und klar.
Den technischen Vorzügen des Blattes stehen keine
allzugroßen nach der rein künstlerischen Seite gegenüber.
Die Komposition ist eine glückliche. Sie spricht uns
durch ihre naive Natürlichkeit an. Der Knabe ist in
seinen Bewegungen wie auch sonst wohlgelungen. Das
Gesicht der Maria ist weniger erfreulich. Die Antlitze
der beiden Heiligen sind in ihrer verschiedenartigen
Charakterisierung nicht ohne Reiz. Alles übrige aber
dürfte unserem Empfinden weniger zusagen. Die Ge-
wänder wirken starr. Wo einmal bessere Ansätze vor-
handen sind, ist deren Eindruck durch übermäßige Falten-
fülle abgeschwächt. Die Figuren gehen nicht recht mit
dem Raum zusammen. Entweder walten die ersteren zu
sehr vor oder tritt der letztere zu stark in den Vorder-
grund.
Das Kolorit bewegt sich in sehr dünnen Tönen. Es
beschränkt sich mehr auf die Hervorkehrung der Haupt-
gruppe. Der Mantel der Maria ist rötlich-braun getont.
Das Untergewand tritt an den Aermeln und an dem frei-
liegenden Saumstück in blassem Grün zutage. Das
Antlitz der Maria ist in dünnem Rot ganz leicht ange-
legt. Die Blumen des Wandbehangs hinter ihr sind in
kräftigerem Grün ausgeprägt. Weiter ist Grün ange-
wandt an der Scheibe des einen Fensterchens und in
den Dreiblättern, welche die Arkadenzwickel füllen. An
einzelnen Stellen, wie an den Haaren, dem Kreuz, dem
Turm und Buch der Barbara usw. ist ein leichtes Gelb
aufgelegt.
Um 1460-70.
Lehrs, Katalog der im Germanischen Museum befind-
lichen deutschen Kupferstiche des 15. Jahrhunderts,
S. 38. — Schreiber 2518, mit farbloser Abbildung in
dem entsprechenden Tafelband Taf. XXXIII.
Schreiber nennt das Blatt «cette jolie gravure». Lehrs
sieht in ihm eines der schönsten Schrotblätter unserer
Sammlung. Weiter konstatiert er, daß es eine gegenseitige
Kopie nach dem Stich des Meisters von Zwolle B. VI.
95. 9 ist. Hinzugefügt seien nur die beiden heiligen
Frauen und das die Darstellung umrahmende, gotische
Portal.
18. S. Agnes.
Auf dem mit diagonal geteilten Fliesen belegten
Boden steht die Heilige, nach links gewandt. Be-
kleidet ist sie mit einem in vertikalen Röhrenfalten eng
anliegenden Untergewand und einem weiten Mantel, der
die Schultern verhüllt, infolge des Ausstreckens des rechten
J Armes den Körper wenig freiläßt und die linke Hälfte des
Unterkörpers infolge Anwinkeins mit dem linken Unterarm
teilweise verhüllt. Das Haupt ist nach links geneigt und
mit einer vierzackigen Krone in zwiefach weiß umrande-
tem Nimbus bedeckt. Unter dieser quellen in Wellen-
linien die bis über die Hüften herabflutenden Haare her-
vor. Die Linke hält ein aufgeschlagenes Buch, die rechte
das Band, an dem das nach rechts hin stehende Lämm-
chen um den Hals befestigt ist. Als Hintergrund dient
ein wirksam gemusterter Wandbehang. Auf schwarzem
Grunde stehen in Rauten weiße Lilien, die von zwiefachen,
weiß über schwarz gepunkteten Stäben umschlossen
werden. Den unteren Abschluß des Behangs bildet eine
gefranste Borde mit rautenartiger Gliederung. Die obere
j Abgrenzung der Darstellung besteht in einem schwarzen
Horizontalstreifen mit der in Weiß ausgesparten Inschrift
,,.4»ancta+ +5Cngneta". Als Einfassung des Ganzen dient
eine kräftige schwarze Linie, über welche das gelbliche
Papier allseits mit breitem Rande heraustritt. Ein Wasser-
zeichen ist nicht vorhanden. 5,6 cm h., 4,3 cm br.
Es fällt die große Regelmäßigkeit der Punkte in den
Rauten des Wandbehangs und am Untergewande der
j Heiligen auf. Offenbar sind sie mit einer Punze geschlagen,
j und zwar diejenigen am Teppich mit einer kleineren,
diejenigen am Gewände mit einer größeren. Auch die
l kleinen Rauten unten am Wandbehang und am Mantel-
! saum sind mittelst eines eigenen Gerätes hergestellt. Für
die Gewandung der Heiligen gelangte in reichlichem
Maße Kreuzschraffierung zur Anwendung. Das Futter
j zeigt einfache Schraffierung. Zur Belebung der Ober-
! flächen sind Punkte und Sterne verwandt. Das Blättchen
ist von großer Sauberkeit und Schärfe in der Technik.
Der Abdruck ist klar und bestimmt. Sein künstlerischer
Wert ist aber ein minderer.
Die dekorative Wirkung des Blättchens ist durch
weise Anwendung von Farben erhöht. Der Fußboden ist
! grün angelegt. Grün finden wir auch bei einigen Lilien
des Wandbehangs. Der Mantel der Heiligen ist rot ge-
färbt. Auch einige der Lilien im Teppich zeigen diesen
Ton. Als dritte Farbe kommt Gelb hinzu, und zwar für
das Antlitz, die Haare, Krone, den Nimbus, die Borde
und das Futter des Mantels und einige Lilien sowie die
untere Borde des Teppichs.
Um 1470.
Vgl. Th. Hampe, Mitteilungen aus dem [Germani-
schen Nationalmuseum, 1898, S. 110. (Inv.-Kat. Nr. 5728.)
20 —