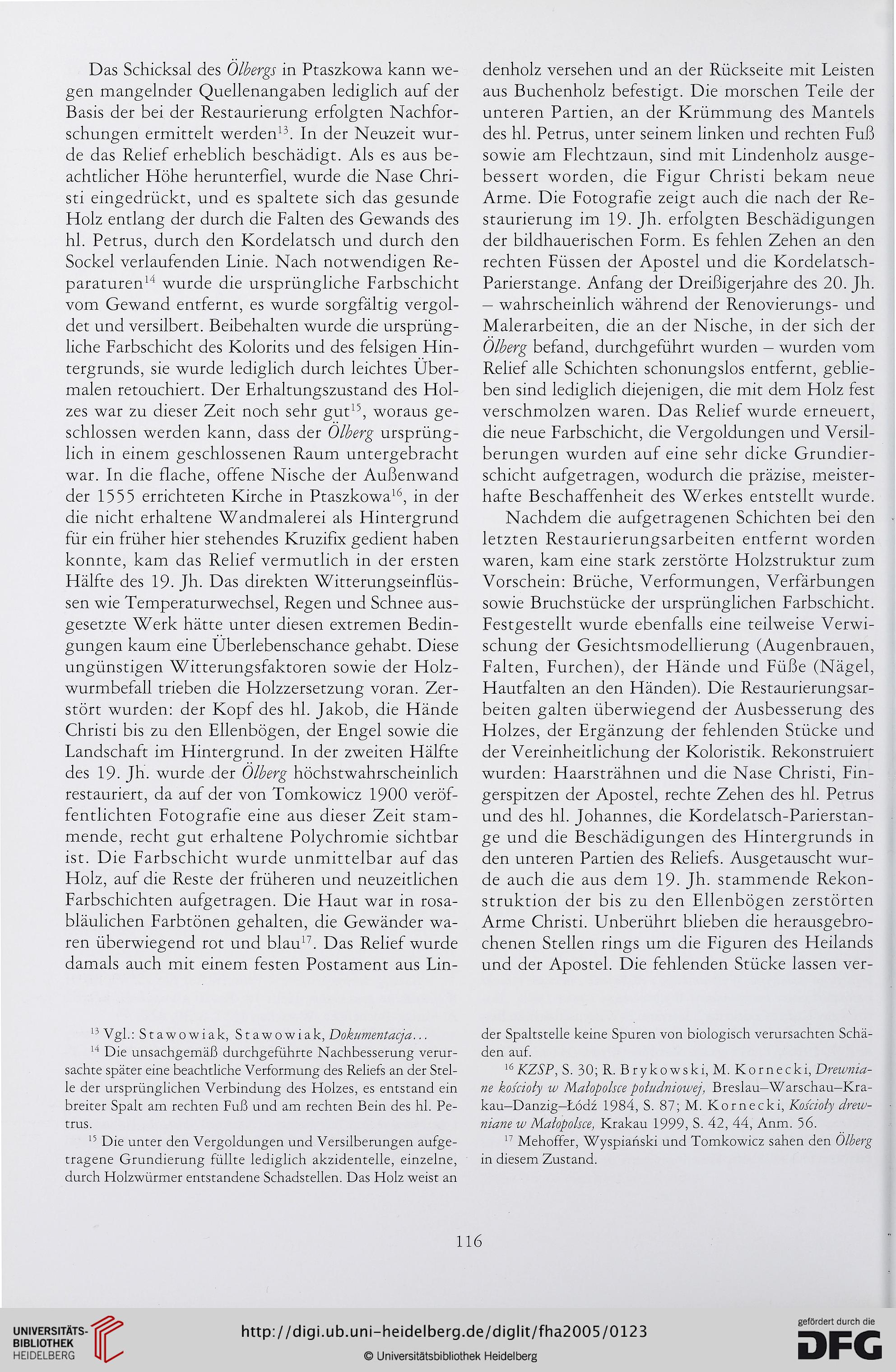Das Schicksal des Olbergs in Ptaszkowa kann we-
gen mangelnder Quellenangaben lediglich auf der
Basis der bei der Restaurierung erfolgten Nachfor-
schungen ermittelt werden13. In der Neuzeit wur-
de das Relief erheblich beschadigt. Ais es aus be-
achtlicher Hohe herunterfiel, wurde die Nase Chri-
sti eingedriickt, und es spaltete sich das gesunde
Holz entlang der durch die Falten des Gewands des
hl. Petrus, durch den Kordelatsch und durch den
Sockel verlaufenden Linie. Nach notwendigen Re-
paraturen14 wurde die urspriingliche Farbschicht
vom Gewand entfernt, es wurde sorgfaltig yergol-
det und yersilbert. Beibehalten wurde die ursprung-
liche Farbschicht des Kolorits und des felsigen Hin-
tergrunds, sie wurde lediglich durch leichtes Uber-
malen retouchiert. Der Erhaltungszustand des Hol-
zes war zu dieser Zeit noch sehr gut15, woraus ge-
schlossen werden kann, dass der Olberg urspriing-
lich in einem geschlossenen Raum untergebracht
war. In die flachę, offene Nische der AuBenwand
der 1555 errichteten Kirche in Ptaszkowa16, in der
die nicht erhaltene Wandmalerei ais Hintergrund
fur ein friiher hier stehendes Kruzifht gedient haben
konnte, kam das Relief yermutlich in der ersten
Halfte des 19- Jh. Das direkten Witterungseinfliis-
sen wie Temperaturwechsel, Regen und Schnee aus-
gesetzte Werk hatte unter diesen extremen Bedin-
gungen kaum eine Uberlebenschance gehabt. Diese
unglinstigen Witterungsfaktoren sowie der Holz-
wurmbefall trieben die Holzzersetzung voran. Zer-
stort wurden: der Kopf des hl. Jakob, die Hande
Christi bis zu den Ellenbogen, der Engel sowie die
Landschaft im Elintergrund. In der zweiten Halfte
des 19- Jh. wurde der Olberg hochstwahrscheinlich
restauriert, da auf der von Tomkowicz 1900 verof-
fentlichten Fotografie eine aus dieser Zeit stam-
mende, recht gut erhaltene Polychromie sichtbar
ist. Die Farbschicht wurde unmittelbar auf das
Holz, auf die Reste der friiheren und neuzeitlichen
Farbschichten aufgetragen. Die Haut war in rosa-
blaulichen Farbtonen gehalten, die Gewander wa-
ren uberwiegend rot und blau17. Das Relief wurde
damals auch mit einem festen Postament aus Fin-
13 Vgl.: Stawowiak, Stawowiak, Dokumentacja...
14 Die unsachgemaB durchgefiihrte Nachbesserung verur-
sachte spater eine beachtliche Verformung des Reliefs an der Stel-
le der urspriinglichen Verbindung des Holzes, es entstand ein
breiter Spalt am rechten FuB und am rechten Bein des hl. Pe-
trus.
15 Die unter den Vergoldungen und Versilberungen aufge-
tragene Grundierung fullte lediglich akzidentelle, einzelne,
durch Holzwiirmer entstandene Schadstellen. Das Holz weist an
denholz yersehen und an der Riickseite mit Feisten
aus Buchenholz befestigt. Die morschen Teile der
unteren Partien, an der Kriimmung des Mantels
des hl. Petrus, unter seinem linken und rechten FuB
sowie am Flechtzaun, sind mit Findenholz ausge-
bessert worden, die Figur Christi bekam neue
Arme. Die Fotografie zeigt auch die nach der Re-
staurierung im 19. Jh. erfolgten Beschadigungen
der bildhauerischen Form. Es fehlen Zehen an den
rechten Fiissen der Apostel und die Kordelatsch-
Parierstange. Anfang der DreiBigerjahre des 20. Jh.
— wahrscheinlich wahrend der Renovierungs- und
Malerarbeiten, die an der Nische, in der sich der
Olberg befand, durchgefuhrt wurden — wurden vom
Relief alle Schichten schonungslos entfernt, geblie-
ben sind lediglich diejenigen, die mit dem Holz fest
yerschmolzen waren. Das Relief wurde erneuert,
die neue Farbschicht, die Vergoldungen und Versil-
berungen wurden auf eine sehr dicke Grundier-
schicht aufgetragen, wodurch die prazise, meister-
hafte Beschaffenheit des Werkes entstellt wurde.
Nachdem die aufgetragenen Schichten bei den
letzten Restaurierungsarbeiten entfernt worden
waren, kam eine stark zerstórte Holzstruktur zum
Vorschein: Briiche, Verformungen, Verfarbungen
sowie Bruchstiicke der urspriinglichen Farbschicht.
Festgestellt wurde ebenfalls eine teilweise Verwi-
schung der Gesichtsmodellierung (Augenbrauen,
Falten, Furchen), der Hande und FiiBe (Nagel,
Hautfalten an den Handen). Die Restaurierungsar-
beiten galten uberwiegend der Ausbesserung des
Holzes, der Erganzung der fehlenden Stiicke und
der Vereinheitlichung der Koloristik. Rekonstruiert
wurden: Haarstrahnen und die Nase Christi, Fin-
gerspitzen der Apostel, rechte Zehen des hl. Petrus
und des hl. Johannes, die Kordelatsch-Parierstan-
ge und die Beschadigungen des Hintergrunds in
den unteren Partien des Reliefs. Ausgetauscht wur-
de auch die aus dem 19. Jh. stammende Rekon-
struktion der bis zu den Ellenbogen zerstórten
Arme Christi. Unberiihrt blieben die herausgebro-
chenen Stellen rings um die Figuren des Heilands
und der Apostel. Die fehlenden Stiicke lassen ver-
der Spaltstelle keine Spuren von biologisch verursachten Scha-
den auf.
16 KZSP, S. 30; R. B rykowski, M. Kornecki, Drewnia-
ne kościoły w Małopolsce południowej, Breslau-Warschau-Kra-
kau—Danzig—Łódź 1984, S. 87; M. Kornecki, Kościoły drew-
niane w Małopołsce, Krakau 1999, S. 42, 44, Anm. 56.
17 Mehoffer, Wyspiański und Tomkowicz sahen den Ołberg
in diesem Zustand.
116
gen mangelnder Quellenangaben lediglich auf der
Basis der bei der Restaurierung erfolgten Nachfor-
schungen ermittelt werden13. In der Neuzeit wur-
de das Relief erheblich beschadigt. Ais es aus be-
achtlicher Hohe herunterfiel, wurde die Nase Chri-
sti eingedriickt, und es spaltete sich das gesunde
Holz entlang der durch die Falten des Gewands des
hl. Petrus, durch den Kordelatsch und durch den
Sockel verlaufenden Linie. Nach notwendigen Re-
paraturen14 wurde die urspriingliche Farbschicht
vom Gewand entfernt, es wurde sorgfaltig yergol-
det und yersilbert. Beibehalten wurde die ursprung-
liche Farbschicht des Kolorits und des felsigen Hin-
tergrunds, sie wurde lediglich durch leichtes Uber-
malen retouchiert. Der Erhaltungszustand des Hol-
zes war zu dieser Zeit noch sehr gut15, woraus ge-
schlossen werden kann, dass der Olberg urspriing-
lich in einem geschlossenen Raum untergebracht
war. In die flachę, offene Nische der AuBenwand
der 1555 errichteten Kirche in Ptaszkowa16, in der
die nicht erhaltene Wandmalerei ais Hintergrund
fur ein friiher hier stehendes Kruzifht gedient haben
konnte, kam das Relief yermutlich in der ersten
Halfte des 19- Jh. Das direkten Witterungseinfliis-
sen wie Temperaturwechsel, Regen und Schnee aus-
gesetzte Werk hatte unter diesen extremen Bedin-
gungen kaum eine Uberlebenschance gehabt. Diese
unglinstigen Witterungsfaktoren sowie der Holz-
wurmbefall trieben die Holzzersetzung voran. Zer-
stort wurden: der Kopf des hl. Jakob, die Hande
Christi bis zu den Ellenbogen, der Engel sowie die
Landschaft im Elintergrund. In der zweiten Halfte
des 19- Jh. wurde der Olberg hochstwahrscheinlich
restauriert, da auf der von Tomkowicz 1900 verof-
fentlichten Fotografie eine aus dieser Zeit stam-
mende, recht gut erhaltene Polychromie sichtbar
ist. Die Farbschicht wurde unmittelbar auf das
Holz, auf die Reste der friiheren und neuzeitlichen
Farbschichten aufgetragen. Die Haut war in rosa-
blaulichen Farbtonen gehalten, die Gewander wa-
ren uberwiegend rot und blau17. Das Relief wurde
damals auch mit einem festen Postament aus Fin-
13 Vgl.: Stawowiak, Stawowiak, Dokumentacja...
14 Die unsachgemaB durchgefiihrte Nachbesserung verur-
sachte spater eine beachtliche Verformung des Reliefs an der Stel-
le der urspriinglichen Verbindung des Holzes, es entstand ein
breiter Spalt am rechten FuB und am rechten Bein des hl. Pe-
trus.
15 Die unter den Vergoldungen und Versilberungen aufge-
tragene Grundierung fullte lediglich akzidentelle, einzelne,
durch Holzwiirmer entstandene Schadstellen. Das Holz weist an
denholz yersehen und an der Riickseite mit Feisten
aus Buchenholz befestigt. Die morschen Teile der
unteren Partien, an der Kriimmung des Mantels
des hl. Petrus, unter seinem linken und rechten FuB
sowie am Flechtzaun, sind mit Findenholz ausge-
bessert worden, die Figur Christi bekam neue
Arme. Die Fotografie zeigt auch die nach der Re-
staurierung im 19. Jh. erfolgten Beschadigungen
der bildhauerischen Form. Es fehlen Zehen an den
rechten Fiissen der Apostel und die Kordelatsch-
Parierstange. Anfang der DreiBigerjahre des 20. Jh.
— wahrscheinlich wahrend der Renovierungs- und
Malerarbeiten, die an der Nische, in der sich der
Olberg befand, durchgefuhrt wurden — wurden vom
Relief alle Schichten schonungslos entfernt, geblie-
ben sind lediglich diejenigen, die mit dem Holz fest
yerschmolzen waren. Das Relief wurde erneuert,
die neue Farbschicht, die Vergoldungen und Versil-
berungen wurden auf eine sehr dicke Grundier-
schicht aufgetragen, wodurch die prazise, meister-
hafte Beschaffenheit des Werkes entstellt wurde.
Nachdem die aufgetragenen Schichten bei den
letzten Restaurierungsarbeiten entfernt worden
waren, kam eine stark zerstórte Holzstruktur zum
Vorschein: Briiche, Verformungen, Verfarbungen
sowie Bruchstiicke der urspriinglichen Farbschicht.
Festgestellt wurde ebenfalls eine teilweise Verwi-
schung der Gesichtsmodellierung (Augenbrauen,
Falten, Furchen), der Hande und FiiBe (Nagel,
Hautfalten an den Handen). Die Restaurierungsar-
beiten galten uberwiegend der Ausbesserung des
Holzes, der Erganzung der fehlenden Stiicke und
der Vereinheitlichung der Koloristik. Rekonstruiert
wurden: Haarstrahnen und die Nase Christi, Fin-
gerspitzen der Apostel, rechte Zehen des hl. Petrus
und des hl. Johannes, die Kordelatsch-Parierstan-
ge und die Beschadigungen des Hintergrunds in
den unteren Partien des Reliefs. Ausgetauscht wur-
de auch die aus dem 19. Jh. stammende Rekon-
struktion der bis zu den Ellenbogen zerstórten
Arme Christi. Unberiihrt blieben die herausgebro-
chenen Stellen rings um die Figuren des Heilands
und der Apostel. Die fehlenden Stiicke lassen ver-
der Spaltstelle keine Spuren von biologisch verursachten Scha-
den auf.
16 KZSP, S. 30; R. B rykowski, M. Kornecki, Drewnia-
ne kościoły w Małopolsce południowej, Breslau-Warschau-Kra-
kau—Danzig—Łódź 1984, S. 87; M. Kornecki, Kościoły drew-
niane w Małopołsce, Krakau 1999, S. 42, 44, Anm. 56.
17 Mehoffer, Wyspiański und Tomkowicz sahen den Ołberg
in diesem Zustand.
116