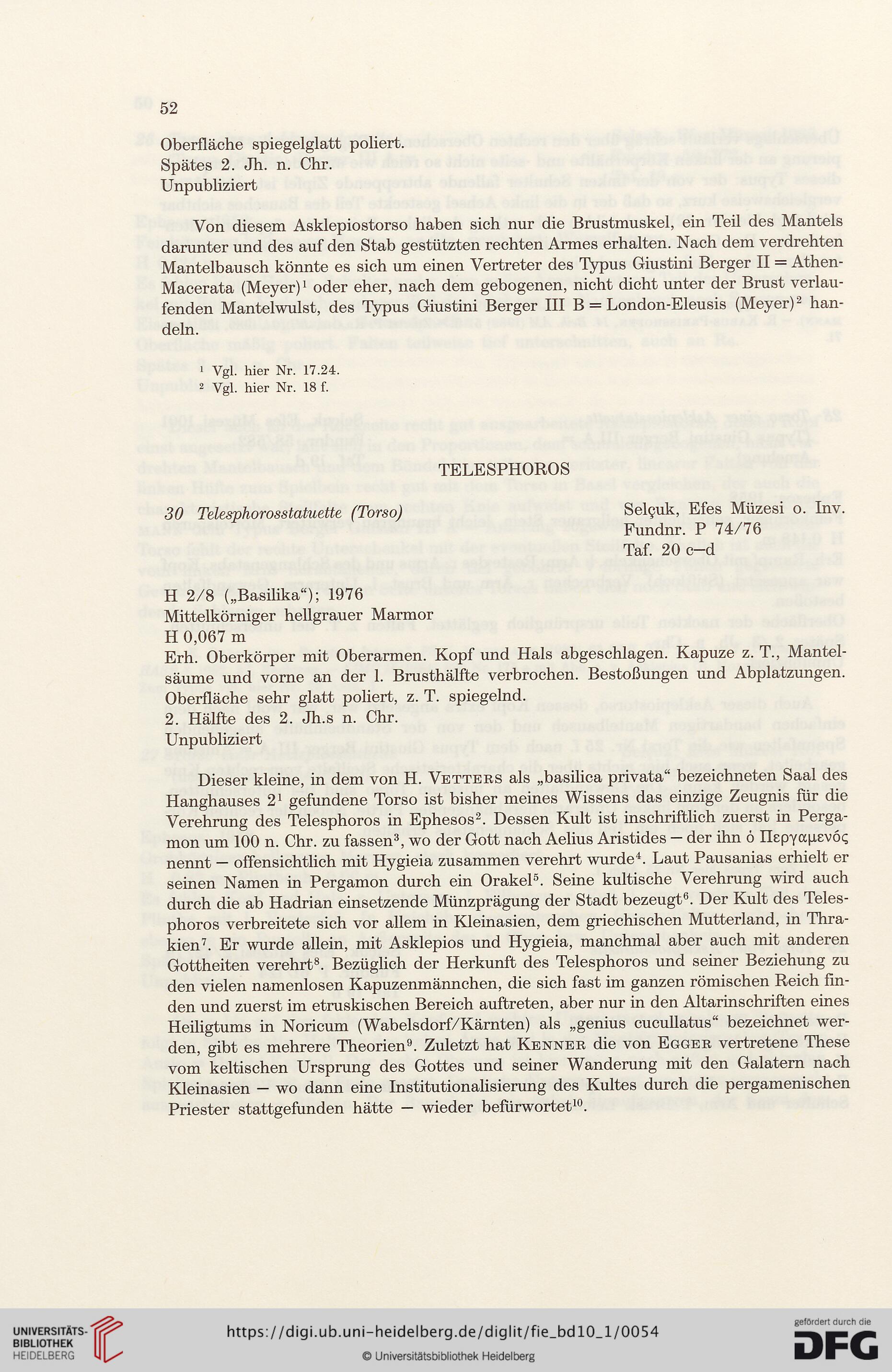52
Oberfläche spiegelglatt poliert.
Spätes 2. Jh. n. Chr.
Unpubliziert
Von diesem Asklepiostorso haben sich nur die Brustmuskel, ein Teil des Mantels
darunter und des auf den Stab gestützten rechten Armes erhalten. Nach dem verdrehten
Mantelbausch könnte es sich um einen Vertreter des Typus Giustini Berger II = Athen-
Macerata (Meyer)1 oder eher, nach dem gebogenen, nicht dicht unter der Brust verlau-
fenden Mantelwulst, des Typus Giustini Berger III B = London-Eleusis (Meyer)2 han-
deln.
1 Vgl. hier Nr. 17.24.
2 Vgl. hier Nr. 18 f.
TELESPHOROS
30 Telesphorosstatuette, (Torso) Selyuk, Efes Müzesi o. Inv.
Fundnr. P 74/76
Taf. 20 c—d
H 2/8 („Basilika“); 1976
Mittelkörniger hellgrauer Marmor
H 0,067 m
Erh. Oberkörper mit Oberarmen. Kopf und Hals abgeschlagen. Kapuze z. T., Mantel-
säume und vorne an der 1. Brusthälfte verbrochen. Bestoßungen und Abplatzungen.
Oberfläche sehr glatt poliert, z. T. spiegelnd.
2. Hälfte des 2. Jh.s n. Chr.
Unpubliziert
Dieser kleine, in dem von H. Vetters als „basilica privata“ bezeichneten Saal des
Hanghauses 21 gefundene Torso ist bisher meines Wissens das einzige Zeugnis für die
Verehrung des Telesphoros in Ephesos2. Dessen Kult ist inschriftlich zuerst in Perga-
mon um 100 n. Chr. zu fassen3, wo der Gott nach Aelius Aristides — der ihn ö nepYapevoy
nennt — offensichtlich mit Hygieia zusammen verehrt wurde4. Laut Pausanias erhielt er
seinen Namen in Pergamon durch ein Orakel5. Seine kultische Verehrung wird auch
durch die ab Hadrian einsetzende Münzprägung der Stadt bezeugt6. Der Kult des Teles-
phoros verbreitete sich vor allem in Kleinasien, dem griechischen Mutterland, in Thra-
kien7. Er wurde allein, mit Asklepios und Hygieia, manchmal aber auch mit anderen
Gottheiten verehrt8. Bezüglich der Herkunft des Telesphoros und seiner Beziehung zu
den vielen namenlosen Kapuzenmännchen, die sich fast im ganzen römischen Reich fin-
den und zuerst im etruskischen Bereich auftreten, aber nur in den Altarinschriften eines
Heiligtums in Noricum (Wabelsdorf/Kärnten) als „genius cucullatus“ bezeichnet wer-
den, gibt es mehrere Theorien9. Zuletzt hat Kenner die von Egger vertretene These
vom keltischen Ursprung des Gottes und seiner Wanderung mit den Galatern nach
Kleinasien — wo dann eine Institutionalisierung des Kultes durch die pergamenischen
Priester stattgefunden hätte — wieder befürwortet10.
Oberfläche spiegelglatt poliert.
Spätes 2. Jh. n. Chr.
Unpubliziert
Von diesem Asklepiostorso haben sich nur die Brustmuskel, ein Teil des Mantels
darunter und des auf den Stab gestützten rechten Armes erhalten. Nach dem verdrehten
Mantelbausch könnte es sich um einen Vertreter des Typus Giustini Berger II = Athen-
Macerata (Meyer)1 oder eher, nach dem gebogenen, nicht dicht unter der Brust verlau-
fenden Mantelwulst, des Typus Giustini Berger III B = London-Eleusis (Meyer)2 han-
deln.
1 Vgl. hier Nr. 17.24.
2 Vgl. hier Nr. 18 f.
TELESPHOROS
30 Telesphorosstatuette, (Torso) Selyuk, Efes Müzesi o. Inv.
Fundnr. P 74/76
Taf. 20 c—d
H 2/8 („Basilika“); 1976
Mittelkörniger hellgrauer Marmor
H 0,067 m
Erh. Oberkörper mit Oberarmen. Kopf und Hals abgeschlagen. Kapuze z. T., Mantel-
säume und vorne an der 1. Brusthälfte verbrochen. Bestoßungen und Abplatzungen.
Oberfläche sehr glatt poliert, z. T. spiegelnd.
2. Hälfte des 2. Jh.s n. Chr.
Unpubliziert
Dieser kleine, in dem von H. Vetters als „basilica privata“ bezeichneten Saal des
Hanghauses 21 gefundene Torso ist bisher meines Wissens das einzige Zeugnis für die
Verehrung des Telesphoros in Ephesos2. Dessen Kult ist inschriftlich zuerst in Perga-
mon um 100 n. Chr. zu fassen3, wo der Gott nach Aelius Aristides — der ihn ö nepYapevoy
nennt — offensichtlich mit Hygieia zusammen verehrt wurde4. Laut Pausanias erhielt er
seinen Namen in Pergamon durch ein Orakel5. Seine kultische Verehrung wird auch
durch die ab Hadrian einsetzende Münzprägung der Stadt bezeugt6. Der Kult des Teles-
phoros verbreitete sich vor allem in Kleinasien, dem griechischen Mutterland, in Thra-
kien7. Er wurde allein, mit Asklepios und Hygieia, manchmal aber auch mit anderen
Gottheiten verehrt8. Bezüglich der Herkunft des Telesphoros und seiner Beziehung zu
den vielen namenlosen Kapuzenmännchen, die sich fast im ganzen römischen Reich fin-
den und zuerst im etruskischen Bereich auftreten, aber nur in den Altarinschriften eines
Heiligtums in Noricum (Wabelsdorf/Kärnten) als „genius cucullatus“ bezeichnet wer-
den, gibt es mehrere Theorien9. Zuletzt hat Kenner die von Egger vertretene These
vom keltischen Ursprung des Gottes und seiner Wanderung mit den Galatern nach
Kleinasien — wo dann eine Institutionalisierung des Kultes durch die pergamenischen
Priester stattgefunden hätte — wieder befürwortet10.