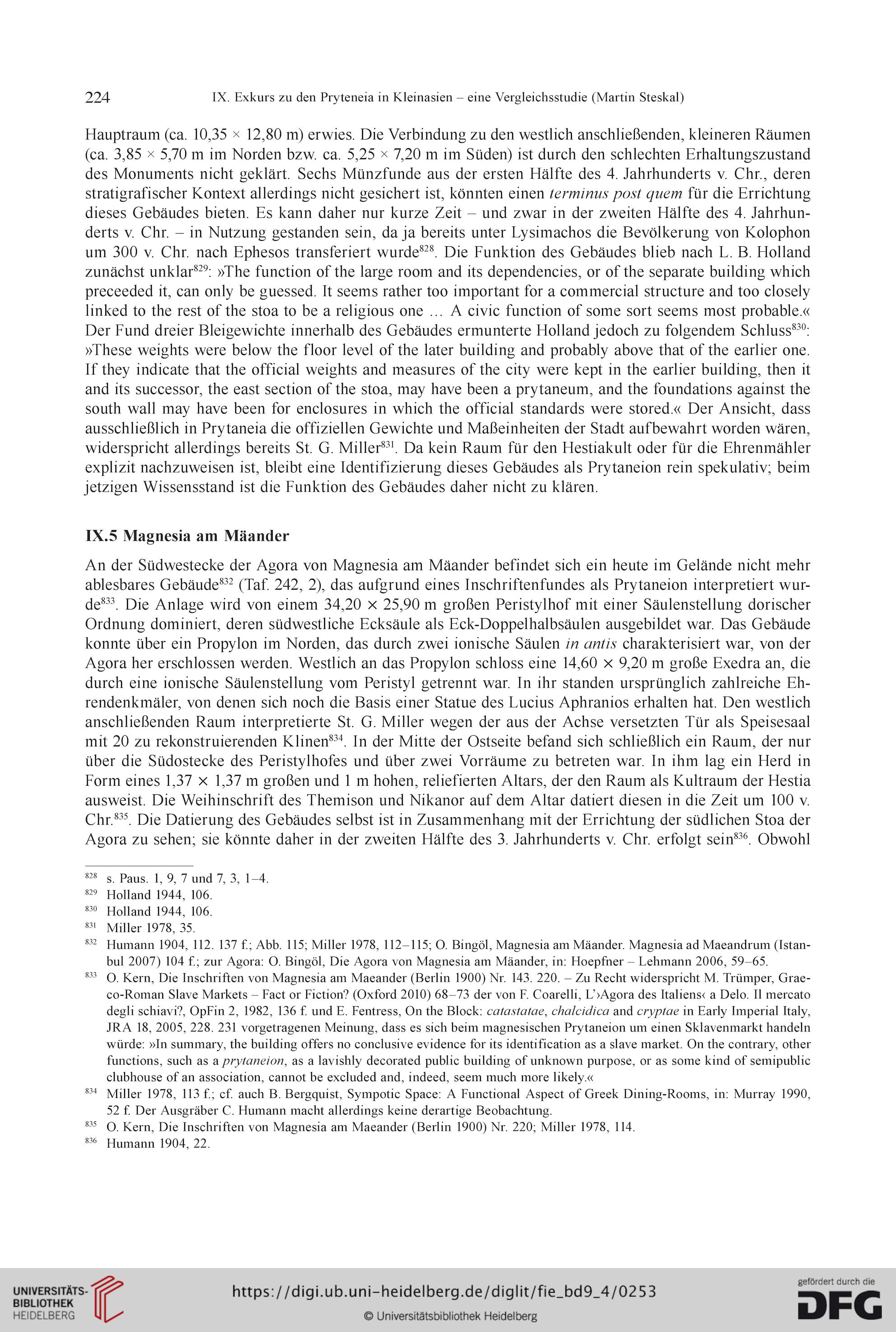224
IX. Exkurs zu den Pryteneia in Kleinasien - eine Vergleichsstudie (Martin Steskal)
Hauptraum (ca. 10,35 x 12,80 m) erwies. Die Verbindung zu den westlich anschließenden, kleineren Räumen
(ca. 3,85 x 5,70 m im Norden bzw. ca. 5,25 x 7,20 m im Süden) ist durch den schlechten Erhaltungszustand
des Monuments nicht geklärt. Sechs Münzfunde aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr., deren
stratigrafi scher Kontext allerdings nicht gesichert ist, könnten einen terminus post quem für die Errichtung
dieses Gebäudes bieten. Es kann daher nur kurze Zeit - und zwar in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhun-
derts v. Chr. - in Nutzung gestanden sein, da ja bereits unter Lysimachos die Bevölkerung von Kolophon
um 300 v. Chr. nach Ephesos transferiert wurde828. Die Funktion des Gebäudes blieb nach L. B. Holland
zunächst unklar829: »The function of the large room and its dependencies, or of the separate building which
preceeded it, can only be guessed. It seems rather too important for a commercial structure and too closely
linked to the rest of the stoa to be a religious one ... A civic function of some sort seems most probable.«
Der Fund dreier Bleigewichte innerhalb des Gebäudes ermunterte Holland jedoch zu folgendem Schluss830:
»These weights were below the floor level of the later building and probably above that of the earlier one.
If they indicate that the official weights and measures of the city were kept in the earlier building, then it
and its successor, the east section of the stoa, may have been a prytaneum, and the foundations against the
south wall may have been for enclosures in which the official Standards were stored.« Der Ansicht, dass
ausschließlich in Prytaneia die offiziellen Gewichte und Maßeinheiten der Stadt aufbewahrt worden wären,
widerspricht allerdings bereits St. G. Miller831. Da kein Raum für den Hestiakult oder für die Ehrenmähler
explizit nachzuweisen ist, bleibt eine Identifizierung dieses Gebäudes als Prytaneion rein spekulativ; beim
jetzigen Wissensstand ist die Funktion des Gebäudes daher nicht zu klären.
IX.5 Magnesia am Mäander
An der Südwestecke der Agora von Magnesia am Mäander befindet sich ein heute im Gelände nicht mehr
ablesbares Gebäude832 (Taf. 242, 2), das aufgrund eines Inschriftenfundes als Prytaneion interpretiert wur-
de833. Die Anlage wird von einem 34,20 x 25,90 m großen Peristylhof mit einer Säulenstellung dorischer
Ordnung dominiert, deren südwestliche Ecksäule als Eck-Doppelhalbsäulen ausgebildet war. Das Gebäude
konnte über ein Propylon im Norden, das durch zwei ionische Säulen in antis charakterisiert war, von der
Agora her erschlossen werden. Westlich an das Propylon schloss eine 14,60 x 9,20 m große Exedra an, die
durch eine ionische Säulenstellung vom Peristyl getrennt war. In ihr standen ursprünglich zahlreiche Eh-
rendenkmäler, von denen sich noch die Basis einer Statue des Lucius Aphranios erhalten hat. Den westlich
anschließenden Raum interpretierte St. G. Miller wegen der aus der Achse versetzten Tür als Speisesaal
mit 20 zu rekonstruierenden Klinen834. In der Mitte der Ostseite befand sich schließlich ein Raum, der nur
über die Südostecke des Peristylhofes und über zwei Vorräume zu betreten war. In ihm lag ein Herd in
Form eines 1,37 x 1,37 m großen und 1 m hohen, reliefierten Altars, der den Raum als Kultraum der Hestia
ausweist. Die Weihinschrift des Themison und Nikanor auf dem Altar datiert diesen in die Zeit um 100 v.
Chr.835. Die Datierung des Gebäudes selbst ist in Zusammenhang mit der Errichtung der südlichen Stoa der
Agora zu sehen; sie könnte daher in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr. erfolgt sein836. Obwohl
828 s. Paus. 1, 9, 7 und 7, 3, 1-4.
829 Holland 1944, 106.
830 Holland 1944, 106.
831 Miller 1978, 35.
832 Humann 1904, 112. 137 f.; Abb. 115; Miller 1978, 112-115; O. Bingöl, Magnesia am Mäander. Magnesia ad Maeandrum (Istan-
bul 2007) 104 f.; zur Agora: O. Bingöl, Die Agora von Magnesia am Mäander, in: Hoepfner - Lehmann 2006, 59-65.
833 O. Kern, Die Inschriften von Magnesia am Maeander (Berlin 1900) Nr. 143. 220. - Zu Recht widerspricht Μ. Trümper, Grae-
co-Roman Slave Markets - Fact or Fiction? (Oxford 2010) 68-73 der von F. Coarelli, LbAgora des Italiens< a Delo. II mercato
degli schiavi?, OpFin 2, 1982, 136 f. und E. Fentress, On the Block: catastatae, chalcidica and cryptae in Early Imperial Italy,
JRA 18, 2005, 228. 231 vorgetragenen Meinung, dass es sich beim magnesischen Prytaneion um einen Sklavenmarkt handeln
würde: »In summary, the building offers no conclusive evidence for its Identification as a slave market. On the contrary, other
functions, such as a prytaneion, as a lavishly decorated public building of unknown purpose, or as some kind of semipublic
clubhouse of an association, cannot be excluded and, indeed, seem much more likely.«
834 Miller 1978, 113 f.; cf. auch B. Bergquist, Sympotic Space: A Functional Aspect of Greek Dining-Rooms, in: Murray 1990,
52 f. Der Ausgräber C. Humann macht allerdings keine derartige Beobachtung.
835 O. Kern, Die Inschriften von Magnesia am Maeander (Berlin 1900) Nr. 220; Miller 1978, 114.
836 Humann 1904, 22.
IX. Exkurs zu den Pryteneia in Kleinasien - eine Vergleichsstudie (Martin Steskal)
Hauptraum (ca. 10,35 x 12,80 m) erwies. Die Verbindung zu den westlich anschließenden, kleineren Räumen
(ca. 3,85 x 5,70 m im Norden bzw. ca. 5,25 x 7,20 m im Süden) ist durch den schlechten Erhaltungszustand
des Monuments nicht geklärt. Sechs Münzfunde aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr., deren
stratigrafi scher Kontext allerdings nicht gesichert ist, könnten einen terminus post quem für die Errichtung
dieses Gebäudes bieten. Es kann daher nur kurze Zeit - und zwar in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhun-
derts v. Chr. - in Nutzung gestanden sein, da ja bereits unter Lysimachos die Bevölkerung von Kolophon
um 300 v. Chr. nach Ephesos transferiert wurde828. Die Funktion des Gebäudes blieb nach L. B. Holland
zunächst unklar829: »The function of the large room and its dependencies, or of the separate building which
preceeded it, can only be guessed. It seems rather too important for a commercial structure and too closely
linked to the rest of the stoa to be a religious one ... A civic function of some sort seems most probable.«
Der Fund dreier Bleigewichte innerhalb des Gebäudes ermunterte Holland jedoch zu folgendem Schluss830:
»These weights were below the floor level of the later building and probably above that of the earlier one.
If they indicate that the official weights and measures of the city were kept in the earlier building, then it
and its successor, the east section of the stoa, may have been a prytaneum, and the foundations against the
south wall may have been for enclosures in which the official Standards were stored.« Der Ansicht, dass
ausschließlich in Prytaneia die offiziellen Gewichte und Maßeinheiten der Stadt aufbewahrt worden wären,
widerspricht allerdings bereits St. G. Miller831. Da kein Raum für den Hestiakult oder für die Ehrenmähler
explizit nachzuweisen ist, bleibt eine Identifizierung dieses Gebäudes als Prytaneion rein spekulativ; beim
jetzigen Wissensstand ist die Funktion des Gebäudes daher nicht zu klären.
IX.5 Magnesia am Mäander
An der Südwestecke der Agora von Magnesia am Mäander befindet sich ein heute im Gelände nicht mehr
ablesbares Gebäude832 (Taf. 242, 2), das aufgrund eines Inschriftenfundes als Prytaneion interpretiert wur-
de833. Die Anlage wird von einem 34,20 x 25,90 m großen Peristylhof mit einer Säulenstellung dorischer
Ordnung dominiert, deren südwestliche Ecksäule als Eck-Doppelhalbsäulen ausgebildet war. Das Gebäude
konnte über ein Propylon im Norden, das durch zwei ionische Säulen in antis charakterisiert war, von der
Agora her erschlossen werden. Westlich an das Propylon schloss eine 14,60 x 9,20 m große Exedra an, die
durch eine ionische Säulenstellung vom Peristyl getrennt war. In ihr standen ursprünglich zahlreiche Eh-
rendenkmäler, von denen sich noch die Basis einer Statue des Lucius Aphranios erhalten hat. Den westlich
anschließenden Raum interpretierte St. G. Miller wegen der aus der Achse versetzten Tür als Speisesaal
mit 20 zu rekonstruierenden Klinen834. In der Mitte der Ostseite befand sich schließlich ein Raum, der nur
über die Südostecke des Peristylhofes und über zwei Vorräume zu betreten war. In ihm lag ein Herd in
Form eines 1,37 x 1,37 m großen und 1 m hohen, reliefierten Altars, der den Raum als Kultraum der Hestia
ausweist. Die Weihinschrift des Themison und Nikanor auf dem Altar datiert diesen in die Zeit um 100 v.
Chr.835. Die Datierung des Gebäudes selbst ist in Zusammenhang mit der Errichtung der südlichen Stoa der
Agora zu sehen; sie könnte daher in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr. erfolgt sein836. Obwohl
828 s. Paus. 1, 9, 7 und 7, 3, 1-4.
829 Holland 1944, 106.
830 Holland 1944, 106.
831 Miller 1978, 35.
832 Humann 1904, 112. 137 f.; Abb. 115; Miller 1978, 112-115; O. Bingöl, Magnesia am Mäander. Magnesia ad Maeandrum (Istan-
bul 2007) 104 f.; zur Agora: O. Bingöl, Die Agora von Magnesia am Mäander, in: Hoepfner - Lehmann 2006, 59-65.
833 O. Kern, Die Inschriften von Magnesia am Maeander (Berlin 1900) Nr. 143. 220. - Zu Recht widerspricht Μ. Trümper, Grae-
co-Roman Slave Markets - Fact or Fiction? (Oxford 2010) 68-73 der von F. Coarelli, LbAgora des Italiens< a Delo. II mercato
degli schiavi?, OpFin 2, 1982, 136 f. und E. Fentress, On the Block: catastatae, chalcidica and cryptae in Early Imperial Italy,
JRA 18, 2005, 228. 231 vorgetragenen Meinung, dass es sich beim magnesischen Prytaneion um einen Sklavenmarkt handeln
würde: »In summary, the building offers no conclusive evidence for its Identification as a slave market. On the contrary, other
functions, such as a prytaneion, as a lavishly decorated public building of unknown purpose, or as some kind of semipublic
clubhouse of an association, cannot be excluded and, indeed, seem much more likely.«
834 Miller 1978, 113 f.; cf. auch B. Bergquist, Sympotic Space: A Functional Aspect of Greek Dining-Rooms, in: Murray 1990,
52 f. Der Ausgräber C. Humann macht allerdings keine derartige Beobachtung.
835 O. Kern, Die Inschriften von Magnesia am Maeander (Berlin 1900) Nr. 220; Miller 1978, 114.
836 Humann 1904, 22.