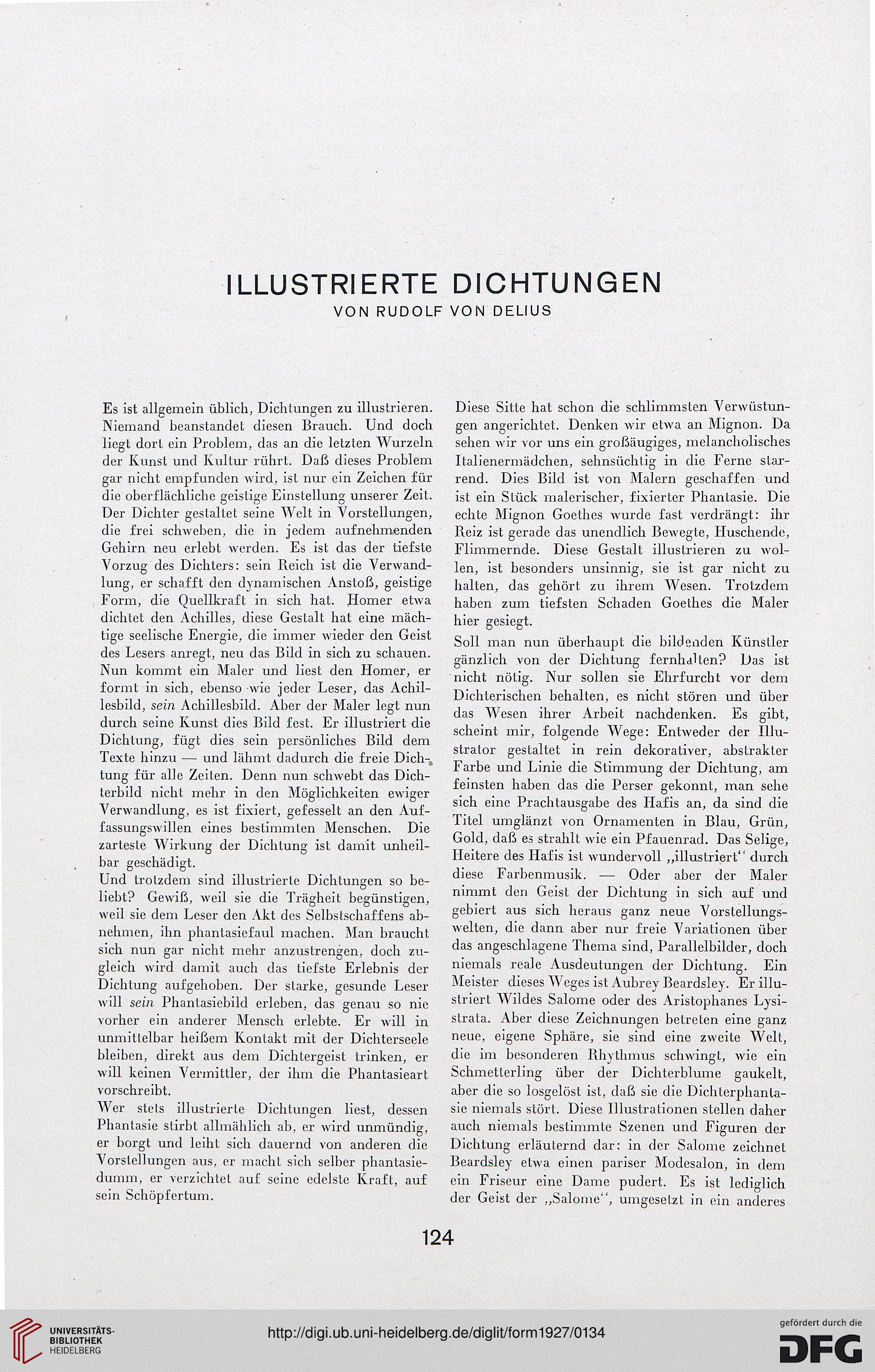ILLUSTRIERTE DICHTUNGEN
VON RUDOLF VON DELIUS
Es ist allgemein üblich, Dichtungen zu illustrieren.
Niemand beanstandet diesen Brauch. Und doch
liegt dort ein Problem, das an die letzten Wurzeln
der Kunst und Kultur rührt. Daß dieses Problem
gar nicht empfunden wird, ist nur ein Zeichen für
die oberflächliche geistige Einstellung unserer Zeil.
Der Dichter gestaltet seine Welt in Vorstellungen,
die frei schweben, die in jedem aufnehmenden
Gehirn neu erlebt werden. Es ist das der tiefste
Vorzug des Dichters: sein Reich ist die Verwand-
lung, er schafft den dynamischen Anstoß, geistige
Form, die Quellkraft in sich hat. Homer etwa
dichtet den Achilles, diese Gestalt hat eine mäch-
tige seelische Energie, die immer wieder den Geist
des Lesers anregt, neu das Bild in sich zu schauen.
Nun kommt ein Maler und liest den Homer, er
formt in sich, ebenso wie jeder Leser, das Achil-
lesbild, sein Achillesbild. Aber der Maler legt nun
durch seine Kunst dies Bild fest. Er illustriert die
Dichtung, fügt dies sein persönliches Bild dem
Texte hinzu — und lähmt dadurch die freie Dich-,
tung für alle Zeilen. Denn nun schwebt das Dich-
terbild nicht mehr in den Möglichkeiten ewiger
Verwandlung, es ist fixiert, gefesselt an den Auf-
fassungswillen eines bestimmten Menschen. Die
zarteste Wirkung der Dichtung ist damit unheil-
bar geschädigt.
Und trotzdem sind illustrierte Dichtungen so be-
liebt? Gewiß, weil sie die Trägheit begünstigen,
weil sie dem Leser den Akt des Selbstschaffens ab-
nehmen, ihn phantasiefaul machen. Man braucht
sich nun gar nicht mehr anzustrengen, doch zu-
gleich wird damit auch das tiefste Erlebnis der
Dichtung aufgehoben. Der starke, gesunde Leser
will sein Phantasiebild erleben, das genau so nie
vorher ein anderer Mensch erlebte. Er will in
unmittelbar heißem Kontakt mit der Dichterseele
bleiben, direkt aus dem Dichtergeisl trinken, er
will keinen Vermittler, der ihm die Phantasieart
vorschreibt.
Wer stets illustrierte Dichtungen liest, dessen
Phantasie stirbt allmählich ab, er wird unmündig,
er borgt und leiht sich dauernd von anderen die
Vorstellungen aus, er macht sich selber phantasie-
dumm, er verzichtet auf seine edelste Kraft, auf
sein Schöpfertum.
Diese Sitte hat schon die schlimmsten Verwüstun-
gen angerichtet. Denken wir etwa an Mignon. Da
sehen wir vor uns ein großäugiges, melancholisches
Ilalienermädchen, sehnsüchtig in die Ferne star-
rend. Dies Bild ist von Malern geschaffen und
ist ein Slück malerischer, fixierter Phantasie. Die
echte Mignon Goethes wurde fast verdrängt: ihr
Reiz ist gerade das unendlich Bewegte, Huschende,
Flimmernde. Diese Gestalt illustrieren zu wol-
len, ist besonders unsinnig, sie ist gar nicht zu
halten, das gehört zu ihrem Wesen. Trotzdem
haben zum tiefsten Schaden Goethes die Maler
hier gesiegt.
Soll man nun überhaupt die bildenden Künstler
gänzlich von der Dichtung fernhalten? Das ist
nicht nötig. Nur sollen sie Ehrfurcht vor dem
Dichterischen behalten, es nicht stören und über
das Wesen ihrer Arbeit nachdenken. Es gibt,
scheint mir, folgende Wege: Entweder der Illu-
strator gestaltet in rein dekorativer, abstrakter
Farbe und Linie die Stimmung der Dichtung, am
feinsten haben das die Perser gekonnt, man sehe
sich eine Prachtausgabe des Hafis an, da sind die
Titel umglänzt von Ornamenten in Blau, Grün,
Gold, daß es strahlt wie ein Pfauenrad. Das Selige,
Heitere des Hafis ist wundervoll „illustriert" durch
diese Farbenniusik. — Oder aber der Maler
nimmt den Geist der Dichtung in sich auf und
gebiert aus sich heraus ganz neue Vorslellungs-
welten, die dann aber nur freie Variationen über
das angeschlagene Thema sind, Parallelbilder, doch
niemals reale Ausdeutungen der Dichtung. Ein
Meister dieses Weges ist Aubrey Beardsley. Er illu-
striert Wildes Salome oder des Arislophanes Lysi-
slrala. Aber diese Zeichnungen betreten eine ganz
neue, eigene Sphäre, sie sind eine zweite Welt,
die im besonderen Rhythmus schwingt, wie ein
Schmetterling über der Dichterblume gaukelt,
aber die so losgelöst ist, daß sie die Dichterphanla-
sie niemals stört. Diese Illustrationen stellen daher
auch niemals bestimmte Szenen und Figuren der
Dichtung erläuternd dar: in der Salome zeichnet
Beardsley etwa einen pariser Modesalon, in dem
ein Friseur eine Dame pudert. Es ist lediglich
der Geist der „Salome", umgesetzt in ein anderes
124
VON RUDOLF VON DELIUS
Es ist allgemein üblich, Dichtungen zu illustrieren.
Niemand beanstandet diesen Brauch. Und doch
liegt dort ein Problem, das an die letzten Wurzeln
der Kunst und Kultur rührt. Daß dieses Problem
gar nicht empfunden wird, ist nur ein Zeichen für
die oberflächliche geistige Einstellung unserer Zeil.
Der Dichter gestaltet seine Welt in Vorstellungen,
die frei schweben, die in jedem aufnehmenden
Gehirn neu erlebt werden. Es ist das der tiefste
Vorzug des Dichters: sein Reich ist die Verwand-
lung, er schafft den dynamischen Anstoß, geistige
Form, die Quellkraft in sich hat. Homer etwa
dichtet den Achilles, diese Gestalt hat eine mäch-
tige seelische Energie, die immer wieder den Geist
des Lesers anregt, neu das Bild in sich zu schauen.
Nun kommt ein Maler und liest den Homer, er
formt in sich, ebenso wie jeder Leser, das Achil-
lesbild, sein Achillesbild. Aber der Maler legt nun
durch seine Kunst dies Bild fest. Er illustriert die
Dichtung, fügt dies sein persönliches Bild dem
Texte hinzu — und lähmt dadurch die freie Dich-,
tung für alle Zeilen. Denn nun schwebt das Dich-
terbild nicht mehr in den Möglichkeiten ewiger
Verwandlung, es ist fixiert, gefesselt an den Auf-
fassungswillen eines bestimmten Menschen. Die
zarteste Wirkung der Dichtung ist damit unheil-
bar geschädigt.
Und trotzdem sind illustrierte Dichtungen so be-
liebt? Gewiß, weil sie die Trägheit begünstigen,
weil sie dem Leser den Akt des Selbstschaffens ab-
nehmen, ihn phantasiefaul machen. Man braucht
sich nun gar nicht mehr anzustrengen, doch zu-
gleich wird damit auch das tiefste Erlebnis der
Dichtung aufgehoben. Der starke, gesunde Leser
will sein Phantasiebild erleben, das genau so nie
vorher ein anderer Mensch erlebte. Er will in
unmittelbar heißem Kontakt mit der Dichterseele
bleiben, direkt aus dem Dichtergeisl trinken, er
will keinen Vermittler, der ihm die Phantasieart
vorschreibt.
Wer stets illustrierte Dichtungen liest, dessen
Phantasie stirbt allmählich ab, er wird unmündig,
er borgt und leiht sich dauernd von anderen die
Vorstellungen aus, er macht sich selber phantasie-
dumm, er verzichtet auf seine edelste Kraft, auf
sein Schöpfertum.
Diese Sitte hat schon die schlimmsten Verwüstun-
gen angerichtet. Denken wir etwa an Mignon. Da
sehen wir vor uns ein großäugiges, melancholisches
Ilalienermädchen, sehnsüchtig in die Ferne star-
rend. Dies Bild ist von Malern geschaffen und
ist ein Slück malerischer, fixierter Phantasie. Die
echte Mignon Goethes wurde fast verdrängt: ihr
Reiz ist gerade das unendlich Bewegte, Huschende,
Flimmernde. Diese Gestalt illustrieren zu wol-
len, ist besonders unsinnig, sie ist gar nicht zu
halten, das gehört zu ihrem Wesen. Trotzdem
haben zum tiefsten Schaden Goethes die Maler
hier gesiegt.
Soll man nun überhaupt die bildenden Künstler
gänzlich von der Dichtung fernhalten? Das ist
nicht nötig. Nur sollen sie Ehrfurcht vor dem
Dichterischen behalten, es nicht stören und über
das Wesen ihrer Arbeit nachdenken. Es gibt,
scheint mir, folgende Wege: Entweder der Illu-
strator gestaltet in rein dekorativer, abstrakter
Farbe und Linie die Stimmung der Dichtung, am
feinsten haben das die Perser gekonnt, man sehe
sich eine Prachtausgabe des Hafis an, da sind die
Titel umglänzt von Ornamenten in Blau, Grün,
Gold, daß es strahlt wie ein Pfauenrad. Das Selige,
Heitere des Hafis ist wundervoll „illustriert" durch
diese Farbenniusik. — Oder aber der Maler
nimmt den Geist der Dichtung in sich auf und
gebiert aus sich heraus ganz neue Vorslellungs-
welten, die dann aber nur freie Variationen über
das angeschlagene Thema sind, Parallelbilder, doch
niemals reale Ausdeutungen der Dichtung. Ein
Meister dieses Weges ist Aubrey Beardsley. Er illu-
striert Wildes Salome oder des Arislophanes Lysi-
slrala. Aber diese Zeichnungen betreten eine ganz
neue, eigene Sphäre, sie sind eine zweite Welt,
die im besonderen Rhythmus schwingt, wie ein
Schmetterling über der Dichterblume gaukelt,
aber die so losgelöst ist, daß sie die Dichterphanla-
sie niemals stört. Diese Illustrationen stellen daher
auch niemals bestimmte Szenen und Figuren der
Dichtung erläuternd dar: in der Salome zeichnet
Beardsley etwa einen pariser Modesalon, in dem
ein Friseur eine Dame pudert. Es ist lediglich
der Geist der „Salome", umgesetzt in ein anderes
124