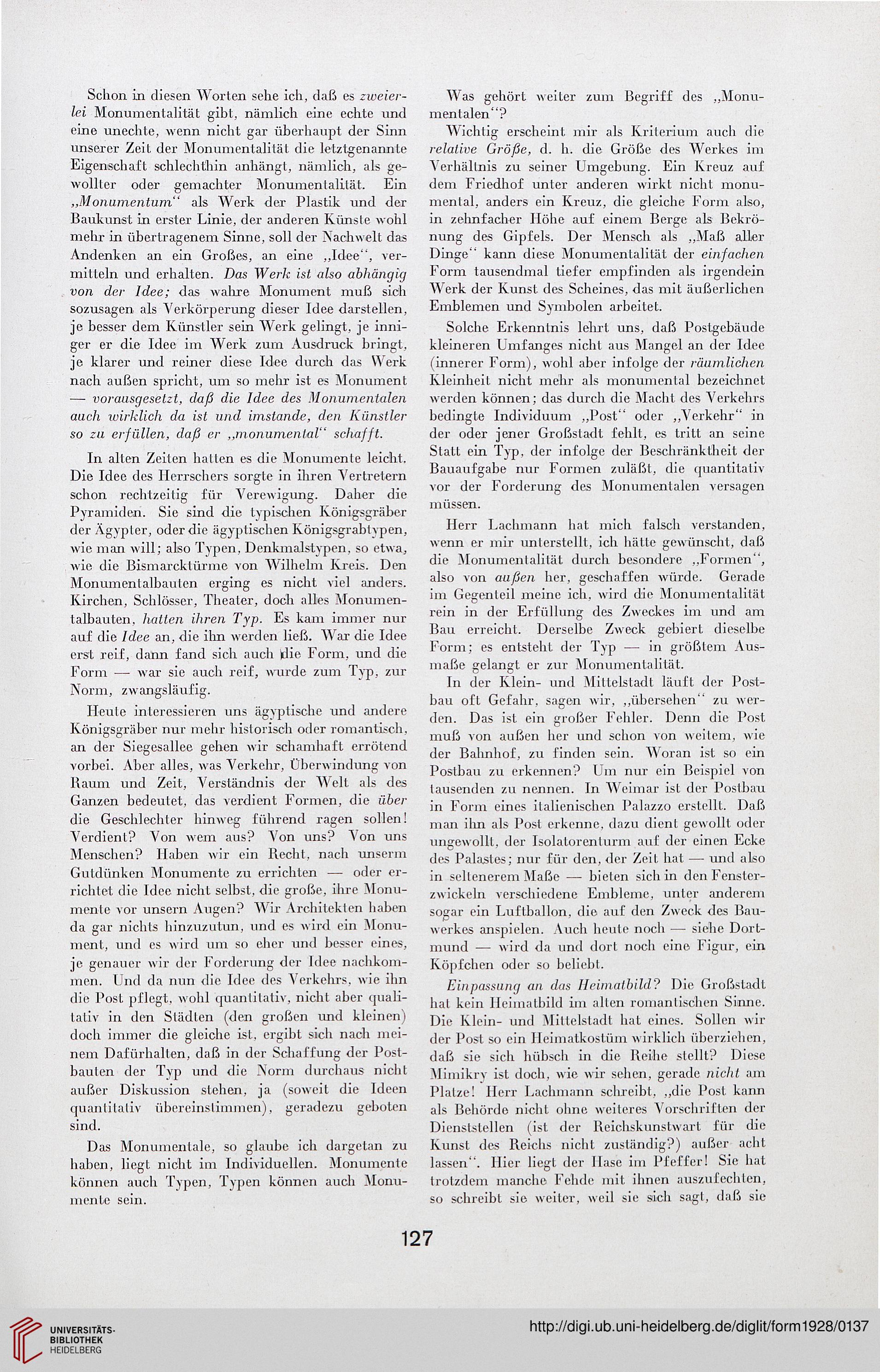Schon in diesen Worten sehe ich, daß es zweier-
lei Monumentalität gibt, nämlich eine echte und
eine unechte, wenn nicht gar überhaupt der Sinn
unserer Zeit der Monumentalität die letztgenannte
Eigenschaft schlechthin anhängt, nämlich, als ge-
wollter oder gemachter Monumentalität. Ein
„Monumentum" als Werk der Plastik und der
Baukunst in erster Linie, der anderen Künste wohl
mehr in übertragenem Sinne, soll der Nachwelt das
Andenken an ein Großes, an eine „Idee", ver-
mitteln und erhalten. Das Werk ist also abhängig
von der Idee; das walire Monument muß sich
sozusagen als Verkörperung dieser Idee darstellen,
je besser dem Künstler sein Werk gelingt, je inni-
ger er die Idee im Werk zum Ausdruck bringt,
je klarer und reiner diese Idee durch das Werk
nach außen spricht, um so mehr ist es Monument
— vorausgesetzt, daß die Idee des Monumentalen
auch wirklich da ist und imstande, den Künstler
so zu erfüllen, daß er ,,monumental" schafft.
In allen Zeiten hallen es die Monumente leicht.
Die Idee des Herrschers sorgte in ihren Vertretern
schon rechtzeitig für Verewigung. Daher die
Pyramiden. Sie sind die typischen Königsgräber
der Ägypter, oder die ägyptischen Königsgrabtvpen,
wie man will; also Typen, Denkmalstypen, so etwa,
wie die Bismarcktürme von Wilhelm Kreis. Den
Monumentalbauten erging es nicht viel anders.
Kirchen, Schlösser, Thealer, doch alles Monumen-
talbauten, hatten ihren Typ. Es kam immer nur
auf die Idee an, die ihn werden ließ. War die Idee
erst reif, dann fand sich auch (die Form, und die
Form — war sie auch reif, wurde zum Typ, zur
Norm, zwangsläufig.
Heule inleressieren uns ägyptische und andere
Königsgräber nur mehr historisch oder romantisch,
an der Siegesallee gehen wir schamhaft errötend
vorbei. Aber alles, was Verkehr, Überwindung von
Baum und Zeit, Verständnis der Well als des
Ganzen bedeutet, das verdient Formen, die über
die Geschlechter hinweg führend ragen sollen!
Verdient? Von wem aus? Von uns? Von uns
Menschen? Haben wir ein Recht, nach unserm
Guidünken Monumente zu errichten — oder er-
richtet die Idee nicht selbst, die große, ihre Monu-
mente vor unsern Augen? Wir Architekten haben
da gar nichts hinzuzutun, und es wird ein Monu-
ment, und es wird um so eher und besser eines,
je genauer wir der Forderung der Idee nachkom-
men. Und da nun die Idee des Verkehrs, wie ihn
die Post pflegt, wohl quantitativ, nicht aber quali-
tativ in den Städten (den großen und kleinen)
doch immer die gleiche ist. ergibt sicli nach mei-
nem Dafürhalten, daß in der Schaffung der Post-
baulen der Typ und die Norm durchaus nicht
außer Diskussion stehen, ja (soweit die Ideen
quantitativ übereinstimmen), geradezu geboten
sind.
Das Monumentale, so glaube ich dargetan zu
haben, liegt nicht im Individuellen. Monumente
können auch Typen, Typen können auch Monu-
mente sein.
Was gehört weiter zum Begriff des „Monu-
mentalen"?
Wichtig erscheint mir als Kriterium auch die
relative Größe, d. h. die Größe des Werkes im
A erhällnis zu seiner Umgebung. Ein Kreuz auf
dem Friedhof unter anderen wirkt nicht monu-
mental, anders ein Kreuz, die gleiche Form also,
in zehnfacher Höhe auf einem Berge als Bekrö-
nung des Gipfels. Der Mensch als „Maß aller
Dinge" kann diese Monumentalität der einfachen
Form tausendmal tiefer empfinden als irgendein
Werk der Kunst des Scheines, das mit äußerlichen
Emblemen und Symbolen arbeilet.
Solche Erkenntnis lehrt uns, daß Postgebäude
kleineren Umfanges nicht aus Mangel an der Idee
(innerer Form), wohl aber infolge der räumlichen
Kleinheil nicht mehr als monumental bezeichnel
werden können; das durch die Macht des Verkehrs
bedingte Individuum „Post" oder „Verkehr" in
der oder jener Großstadt fehlt, es tritt an seine
Statt ein Typ, der infolge der Beschränktheit der
Bauaufgabe nur Formen zuläßt, die quantitativ
vor der Forderung des Monumentalen versagen
müssen.
Herr Lachmann hat mich falsch verstanden,
wenn er mir unterstellt, ich hätte gewünscht, daß
die Monumentalität durch besondere „Formen",
also von außen her, geschaffen würde. Gerade
im Gegenteil meine ich, wird die Monumentalität
rein in der Erfüllung des Zweckes im und am
Bau erreicht. Derselbe Zweck gebiert dieselbe
Form; es entsteht der Typ — in größtem Aus-
maße gelangt er zur Monumentalität.
In der Klein- und Millelsladl läuft der l'osl-
bau oft Gefahr, sagen wir, „übersehen" zu wer-
den. Das ist ein großer Fehler. Denn die Post
muß von außen her und schon von weitem, wie
der Bahnhof, zu finden sein. Woran ist so ein
Postbau zu erkennen? Um nur ein Beispiel von
lausenden zu nennen. In Weimar ist der Postbau
in Form eines italienischen Palazzo erstellt. Daß
man ilm als Post erkenne, dazu dient gewollt oder
ungewollt, der Isolalorenturm auf der einen Ecke
des Palastes; nur für den, der Zeil hat — und also
in seltenerem Maße — bieten sich in den Fenster-
zuickeln verschiedene Embleme, unter anderem
sogar ein Luftballon, die auf den Zweck des Bau-
werkes anspielen. Auch heute noch — siehe Dort-
mund — wird da und dort noch eine Figur, ein
Köpfchen oder so beliebt.
Einpassung an das Heimatbild? Die Großstadt
hat kein Heimatbild im alten romantischen Sinne.
Die klein- und Mittelstadt hat eines. Sollen wir
der Post so ein 1 leimatkostüm wirklich überziehen,
daß sie sich hübsch in die Reihe stellt? Diese
Mimikry ist doch, wie wir sehen, gerade nicht am
Platze! Herr Lachmann schreibt, „die Post kann
als Behörde nicht ohne weiteres Vorschriften der
Dienststellen (ist der Reichskunstwart für die
Kunst des Reichs nicht zuständig?) außer acht
lassen". Hier liegt der Hase im Pfeffer! Sie hat
trotzdem manche Fehde mit ihnen auszufechlen,
so schreibt sie weiter, weil sie sich sagt, daß sie
127
lei Monumentalität gibt, nämlich eine echte und
eine unechte, wenn nicht gar überhaupt der Sinn
unserer Zeit der Monumentalität die letztgenannte
Eigenschaft schlechthin anhängt, nämlich, als ge-
wollter oder gemachter Monumentalität. Ein
„Monumentum" als Werk der Plastik und der
Baukunst in erster Linie, der anderen Künste wohl
mehr in übertragenem Sinne, soll der Nachwelt das
Andenken an ein Großes, an eine „Idee", ver-
mitteln und erhalten. Das Werk ist also abhängig
von der Idee; das walire Monument muß sich
sozusagen als Verkörperung dieser Idee darstellen,
je besser dem Künstler sein Werk gelingt, je inni-
ger er die Idee im Werk zum Ausdruck bringt,
je klarer und reiner diese Idee durch das Werk
nach außen spricht, um so mehr ist es Monument
— vorausgesetzt, daß die Idee des Monumentalen
auch wirklich da ist und imstande, den Künstler
so zu erfüllen, daß er ,,monumental" schafft.
In allen Zeiten hallen es die Monumente leicht.
Die Idee des Herrschers sorgte in ihren Vertretern
schon rechtzeitig für Verewigung. Daher die
Pyramiden. Sie sind die typischen Königsgräber
der Ägypter, oder die ägyptischen Königsgrabtvpen,
wie man will; also Typen, Denkmalstypen, so etwa,
wie die Bismarcktürme von Wilhelm Kreis. Den
Monumentalbauten erging es nicht viel anders.
Kirchen, Schlösser, Thealer, doch alles Monumen-
talbauten, hatten ihren Typ. Es kam immer nur
auf die Idee an, die ihn werden ließ. War die Idee
erst reif, dann fand sich auch (die Form, und die
Form — war sie auch reif, wurde zum Typ, zur
Norm, zwangsläufig.
Heule inleressieren uns ägyptische und andere
Königsgräber nur mehr historisch oder romantisch,
an der Siegesallee gehen wir schamhaft errötend
vorbei. Aber alles, was Verkehr, Überwindung von
Baum und Zeit, Verständnis der Well als des
Ganzen bedeutet, das verdient Formen, die über
die Geschlechter hinweg führend ragen sollen!
Verdient? Von wem aus? Von uns? Von uns
Menschen? Haben wir ein Recht, nach unserm
Guidünken Monumente zu errichten — oder er-
richtet die Idee nicht selbst, die große, ihre Monu-
mente vor unsern Augen? Wir Architekten haben
da gar nichts hinzuzutun, und es wird ein Monu-
ment, und es wird um so eher und besser eines,
je genauer wir der Forderung der Idee nachkom-
men. Und da nun die Idee des Verkehrs, wie ihn
die Post pflegt, wohl quantitativ, nicht aber quali-
tativ in den Städten (den großen und kleinen)
doch immer die gleiche ist. ergibt sicli nach mei-
nem Dafürhalten, daß in der Schaffung der Post-
baulen der Typ und die Norm durchaus nicht
außer Diskussion stehen, ja (soweit die Ideen
quantitativ übereinstimmen), geradezu geboten
sind.
Das Monumentale, so glaube ich dargetan zu
haben, liegt nicht im Individuellen. Monumente
können auch Typen, Typen können auch Monu-
mente sein.
Was gehört weiter zum Begriff des „Monu-
mentalen"?
Wichtig erscheint mir als Kriterium auch die
relative Größe, d. h. die Größe des Werkes im
A erhällnis zu seiner Umgebung. Ein Kreuz auf
dem Friedhof unter anderen wirkt nicht monu-
mental, anders ein Kreuz, die gleiche Form also,
in zehnfacher Höhe auf einem Berge als Bekrö-
nung des Gipfels. Der Mensch als „Maß aller
Dinge" kann diese Monumentalität der einfachen
Form tausendmal tiefer empfinden als irgendein
Werk der Kunst des Scheines, das mit äußerlichen
Emblemen und Symbolen arbeilet.
Solche Erkenntnis lehrt uns, daß Postgebäude
kleineren Umfanges nicht aus Mangel an der Idee
(innerer Form), wohl aber infolge der räumlichen
Kleinheil nicht mehr als monumental bezeichnel
werden können; das durch die Macht des Verkehrs
bedingte Individuum „Post" oder „Verkehr" in
der oder jener Großstadt fehlt, es tritt an seine
Statt ein Typ, der infolge der Beschränktheit der
Bauaufgabe nur Formen zuläßt, die quantitativ
vor der Forderung des Monumentalen versagen
müssen.
Herr Lachmann hat mich falsch verstanden,
wenn er mir unterstellt, ich hätte gewünscht, daß
die Monumentalität durch besondere „Formen",
also von außen her, geschaffen würde. Gerade
im Gegenteil meine ich, wird die Monumentalität
rein in der Erfüllung des Zweckes im und am
Bau erreicht. Derselbe Zweck gebiert dieselbe
Form; es entsteht der Typ — in größtem Aus-
maße gelangt er zur Monumentalität.
In der Klein- und Millelsladl läuft der l'osl-
bau oft Gefahr, sagen wir, „übersehen" zu wer-
den. Das ist ein großer Fehler. Denn die Post
muß von außen her und schon von weitem, wie
der Bahnhof, zu finden sein. Woran ist so ein
Postbau zu erkennen? Um nur ein Beispiel von
lausenden zu nennen. In Weimar ist der Postbau
in Form eines italienischen Palazzo erstellt. Daß
man ilm als Post erkenne, dazu dient gewollt oder
ungewollt, der Isolalorenturm auf der einen Ecke
des Palastes; nur für den, der Zeil hat — und also
in seltenerem Maße — bieten sich in den Fenster-
zuickeln verschiedene Embleme, unter anderem
sogar ein Luftballon, die auf den Zweck des Bau-
werkes anspielen. Auch heute noch — siehe Dort-
mund — wird da und dort noch eine Figur, ein
Köpfchen oder so beliebt.
Einpassung an das Heimatbild? Die Großstadt
hat kein Heimatbild im alten romantischen Sinne.
Die klein- und Mittelstadt hat eines. Sollen wir
der Post so ein 1 leimatkostüm wirklich überziehen,
daß sie sich hübsch in die Reihe stellt? Diese
Mimikry ist doch, wie wir sehen, gerade nicht am
Platze! Herr Lachmann schreibt, „die Post kann
als Behörde nicht ohne weiteres Vorschriften der
Dienststellen (ist der Reichskunstwart für die
Kunst des Reichs nicht zuständig?) außer acht
lassen". Hier liegt der Hase im Pfeffer! Sie hat
trotzdem manche Fehde mit ihnen auszufechlen,
so schreibt sie weiter, weil sie sich sagt, daß sie
127