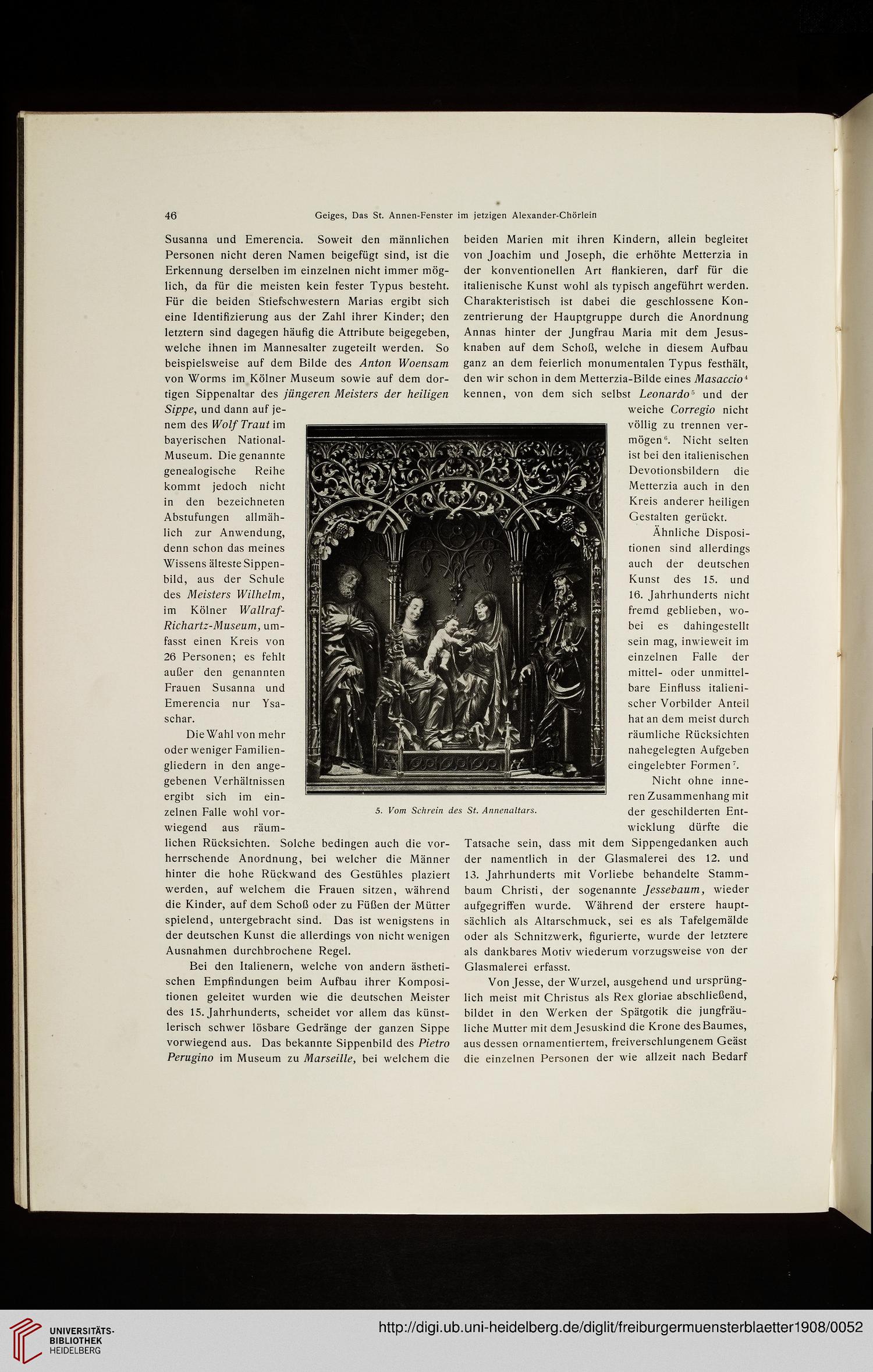46
Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein
Susanna und Emerencia. Soweit den männlichen
Personen nicht deren Namen beigefügt sind, ist die
Erkennung derselben im einzelnen nicht immer mög-
lich, da für die meisten kein fester Typus besteht.
Für die beiden Stiefschwestern Marias ergibt sich
eine Identifizierung aus der Zahl ihrer Kinder; den
letztern sind dagegen häufig die Attribute beigegeben,
welche ihnen im Mannesalter zugeteilt werden. So
beispielsweise auf dem Bilde des Anton Woensam
von Worms im Kölner Museum sowie auf dem dor-
tigen Sippenaltar des jüngeren Meisters der heiligen
Sippe, und dann auf je-
nem des Wolf Trautim
bayerischen National-
Museum. Die genannte
genealogische Reihe
kommt jedoch nicht
in den bezeichneten
Abstufungen allmäh-
lich zur Anwendung,
denn schon das meines
Wissens älteste Sippen-
bild, aus der Schule
des Meisters Wilhelm,
im Kölner Wallraf-
Richartz-Museum, um-
fasst einen Kreis von
26 Personen; es fehlt
außer den genannten
Frauen Susanna und
Emerencia nur Ysa-
schar.
Die Wahl von mehr
oder weniger Familien-
gliedern in den ange-
gebenen Verhältnissen
ergibt sich im ein-
zelnen Falle wohl vor-
wiegend aus räum-
lichen Rücksichten. Solche bedingen auch die vor-
herrschende Anordnung, bei welcher die Männer
hinter die hohe Rückwand des Gestühles plaziert
werden, auf welchem die Frauen sitzen, während
die Kinder, auf dem Schoß oder zu Füßen der Mütter
spielend, untergebracht sind. Das ist wenigstens in
der deutschen Kunst die allerdings von nicht wenigen
Ausnahmen durchbrochene Regel.
Bei den Italienern, welche von andern ästheti-
schen Empfindungen beim Aufbau ihrer Komposi-
tionen geleitet wurden wie die deutschen Meister
des 15. Jahrhunderts, scheidet vor allem das künst-
lerisch schwer lösbare Gedränge der ganzen Sippe
vorwiegend aus. Das bekannte Sippenbild des Pietro
Perugino im Museum zu Marseille, bei welchem die
5. Vom Schrein des St. Annenaltars.
beiden Marien mit ihren Kindern, allein begleitet
von Joachim und Joseph, die erhöhte Metterzia in
der konventionellen Art flankieren, darf für die
italienische Kunst wohl als typisch angeführt werden.
Charakteristisch ist dabei die geschlossene Kon-
zentrierung der Hauptgruppe durch die Anordnung
Annas hinter der Jungfrau Maria mit dem Jesus-
knaben auf dem Schoß, welche in diesem Aufbau
ganz an dem feierlich monumentalen Typus festhält,
den wir schon in dem Metterzia-Bilde eines Masaccio*
kennen, von dem sich selbst Leonardo5 und der
weiche Corregio nicht
völlig zu trennen ver-
mögen11. Nicht selten
ist bei den italienischen
Devotionsbildern die
Metterzia auch in den
Kreis anderer heiligen
Gestalten gerückt.
Ähnliche Disposi-
tionen sind allerdings
auch der deutschen
Kunst des 15. und
16. Jahrhunderts nicht
fremd geblieben, wo-
bei es dahingestellt
sein mag, inwieweit im
einzelnen Falle der
mittel- oder unmittel-
bare Einfluss italieni-
scher Vorbilder Anteil
hat an dem meist durch
räumliche Rücksichten
nahegelegten Aufgeben
eingelebter Formen7.
Nicht ohne inne-
ren Zusammenhang mit
der geschilderten Ent-
wicklung dürfte die
Tatsache sein, dass mit dem Sippengedanken auch
der namentlich in der Glasmalerei des 12. und
13. Jahrhunderts mit Vorliebe behandelte Stamm-
baum Christi, der sogenannte Jessebaum, wieder
aufgegriffen wurde. Während der erstere haupt-
sächlich als Altarschmuck, sei es als Tafelgemälde
oder als Schnitzwerk, figurierte, wurde der letztere
als dankbares Motiv wiederum vorzugsweise von der
Glasmalerei erfasst.
Von Jesse, der Wurzel, ausgehend und ursprüng-
lich meist mit Christus als Rex gloriae abschließend,
bildet in den Werken der Spätgotik die jungfräu-
liche Mutter mit dem Jesuskind die Krone des Baumes,
aus dessen ornamentiertem, freiverschlungenem Geäst
die einzelnen Personen der wie allzeit nach Bedarf
M
5-3SK
ms
rs&S
Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein
Susanna und Emerencia. Soweit den männlichen
Personen nicht deren Namen beigefügt sind, ist die
Erkennung derselben im einzelnen nicht immer mög-
lich, da für die meisten kein fester Typus besteht.
Für die beiden Stiefschwestern Marias ergibt sich
eine Identifizierung aus der Zahl ihrer Kinder; den
letztern sind dagegen häufig die Attribute beigegeben,
welche ihnen im Mannesalter zugeteilt werden. So
beispielsweise auf dem Bilde des Anton Woensam
von Worms im Kölner Museum sowie auf dem dor-
tigen Sippenaltar des jüngeren Meisters der heiligen
Sippe, und dann auf je-
nem des Wolf Trautim
bayerischen National-
Museum. Die genannte
genealogische Reihe
kommt jedoch nicht
in den bezeichneten
Abstufungen allmäh-
lich zur Anwendung,
denn schon das meines
Wissens älteste Sippen-
bild, aus der Schule
des Meisters Wilhelm,
im Kölner Wallraf-
Richartz-Museum, um-
fasst einen Kreis von
26 Personen; es fehlt
außer den genannten
Frauen Susanna und
Emerencia nur Ysa-
schar.
Die Wahl von mehr
oder weniger Familien-
gliedern in den ange-
gebenen Verhältnissen
ergibt sich im ein-
zelnen Falle wohl vor-
wiegend aus räum-
lichen Rücksichten. Solche bedingen auch die vor-
herrschende Anordnung, bei welcher die Männer
hinter die hohe Rückwand des Gestühles plaziert
werden, auf welchem die Frauen sitzen, während
die Kinder, auf dem Schoß oder zu Füßen der Mütter
spielend, untergebracht sind. Das ist wenigstens in
der deutschen Kunst die allerdings von nicht wenigen
Ausnahmen durchbrochene Regel.
Bei den Italienern, welche von andern ästheti-
schen Empfindungen beim Aufbau ihrer Komposi-
tionen geleitet wurden wie die deutschen Meister
des 15. Jahrhunderts, scheidet vor allem das künst-
lerisch schwer lösbare Gedränge der ganzen Sippe
vorwiegend aus. Das bekannte Sippenbild des Pietro
Perugino im Museum zu Marseille, bei welchem die
5. Vom Schrein des St. Annenaltars.
beiden Marien mit ihren Kindern, allein begleitet
von Joachim und Joseph, die erhöhte Metterzia in
der konventionellen Art flankieren, darf für die
italienische Kunst wohl als typisch angeführt werden.
Charakteristisch ist dabei die geschlossene Kon-
zentrierung der Hauptgruppe durch die Anordnung
Annas hinter der Jungfrau Maria mit dem Jesus-
knaben auf dem Schoß, welche in diesem Aufbau
ganz an dem feierlich monumentalen Typus festhält,
den wir schon in dem Metterzia-Bilde eines Masaccio*
kennen, von dem sich selbst Leonardo5 und der
weiche Corregio nicht
völlig zu trennen ver-
mögen11. Nicht selten
ist bei den italienischen
Devotionsbildern die
Metterzia auch in den
Kreis anderer heiligen
Gestalten gerückt.
Ähnliche Disposi-
tionen sind allerdings
auch der deutschen
Kunst des 15. und
16. Jahrhunderts nicht
fremd geblieben, wo-
bei es dahingestellt
sein mag, inwieweit im
einzelnen Falle der
mittel- oder unmittel-
bare Einfluss italieni-
scher Vorbilder Anteil
hat an dem meist durch
räumliche Rücksichten
nahegelegten Aufgeben
eingelebter Formen7.
Nicht ohne inne-
ren Zusammenhang mit
der geschilderten Ent-
wicklung dürfte die
Tatsache sein, dass mit dem Sippengedanken auch
der namentlich in der Glasmalerei des 12. und
13. Jahrhunderts mit Vorliebe behandelte Stamm-
baum Christi, der sogenannte Jessebaum, wieder
aufgegriffen wurde. Während der erstere haupt-
sächlich als Altarschmuck, sei es als Tafelgemälde
oder als Schnitzwerk, figurierte, wurde der letztere
als dankbares Motiv wiederum vorzugsweise von der
Glasmalerei erfasst.
Von Jesse, der Wurzel, ausgehend und ursprüng-
lich meist mit Christus als Rex gloriae abschließend,
bildet in den Werken der Spätgotik die jungfräu-
liche Mutter mit dem Jesuskind die Krone des Baumes,
aus dessen ornamentiertem, freiverschlungenem Geäst
die einzelnen Personen der wie allzeit nach Bedarf
M
5-3SK
ms
rs&S