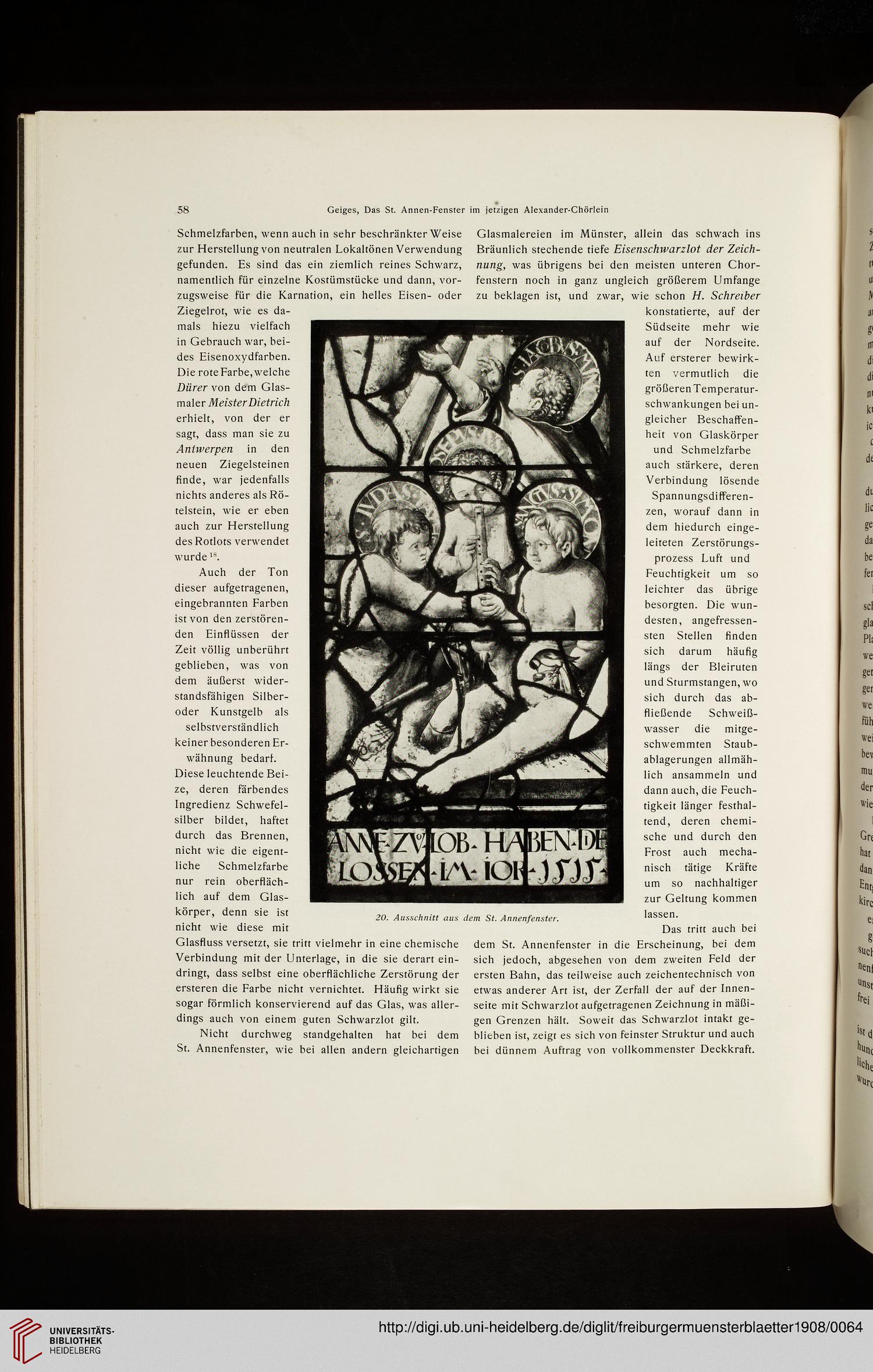58
Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein
Schmelzfarben, wenn auch in sehr beschränkter Weise
zur Herstellung von neutralen Lokaltönen Verwendung
gefunden. Es sind das ein ziemlich reines Schwarz,
namentlich für einzelne Kostümstücke und dann, vor-
zugsweise für die Karnation, ein helles Eisen- oder
Ziegelrot, wie es da-
mals hiezu vielfach
in Gebrauch war, bei-
des Eisenoxydfarben.
Die rote Farbe, welche
Dürer von dem Glas-
maler Meister Dietrich
erhielt, von der er
sagt, dass man sie zu
Antwerpen in den
neuen Ziegelsteinen
finde, war jedenfalls
nichts anderes als Rö-
telstein, wie er eben
auch zur Herstellung
des Rotlots verwendet
wurde18.
Auch der Ton
dieser aufgetragenen,
eingebrannten Farben
ist von den zerstören-
den Einflüssen der
Zeit völlig unberührt
geblieben, was von
dem äußerst wider-
standsfähigen Silber-
oder Kunstgelb als
selbstverständlich
keiner besonderen Er-
wähnung bedarf.
Diese leuchtende Bei-
ze, deren färbendes
Ingredienz Schwefel-
silber bildet, haftet
durch das Brennen,
nicht wie die eigent-
liche Schmelzfarbe
nur rein oberfläch-
lich auf dem Glas-
körper, denn sie ist
nicht wie diese mit
Glasfluss versetzt, sie tritt vielmehr in eine chemische
Verbindung mit der Unterlage, in die sie derart ein-
dringt, dass selbst eine oberflächliche Zerstörung der
ersteren die Farbe nicht vernichtet. Häufig wirkt sie
sogar förmlich konservierend auf das Glas, was aller-
dings auch von einem guten Schwarzlot gilt.
Nicht durchweg standgehalten hat bei dem
St. Annenfenster, wie bei allen andern gleichartigen
20. Ausschnitt aus dem St. Annenfenster.
Glasmalereien im Münster, allein das schwach ins
Bräunlich stechende tiefe Eisenschwarzlot der Zeich-
nung, was übrigens bei den meisten unteren Chor-
fenstern noch in ganz ungleich größerem Umfange
zu beklagen ist, und zwar, wie schon H. Schreiber
konstatierte, auf der
Südseite mehr wie
auf der Nordseite.
Auf ersterer bewirk-
ten vermutlich die
größeren Temperatur-
schwankungen bei un-
gleicher Beschaffen-
heit von Glaskörper
und Schmelzfarbe
auch stärkere, deren
Verbindung lösende
Spannungsdifferen-
zen, worauf dann in
dem hiedurch einge-
leiteten Zerstörungs-
prozess Luft und
Feuchtigkeit um so
leichter das übrige
besorgten. Die wun-
desten, angefressen-
sten Stellen finden
sich darum häufig
längs der Bleiruten
und Sturmstangen, wo
sich durch das ab-
fließende Schweiß-
wasser die mitge-
schwemmten Staub-
ablagerungen allmäh-
lich ansammeln und
dann auch, die Feuch-
tigkeit länger festhal-
tend, deren chemi-
sche und durch den
Frost auch mecha-
nisch tätige Kräfte
um so nachhaltiger
zur Geltung kommen
lassen.
Das tritt auch bei
dem St. Annenfenster in die Erscheinung, bei dem
sich jedoch, abgesehen von dem zweiten Feld der
ersten Bahn, das teilweise auch zeichentechnisch von
etwas anderer Art ist, der Zerfall der auf der Innen-
seite mit Schwarzlot aufgetragenen Zeichnung in mäßi-
gen Grenzen hält. Soweit das Schwarzlot intakt ge-
blieben ist, zeigt es sich von feinster Struktur und auch
bei dünnem Auftrag von vollkommenster Deckkraft.