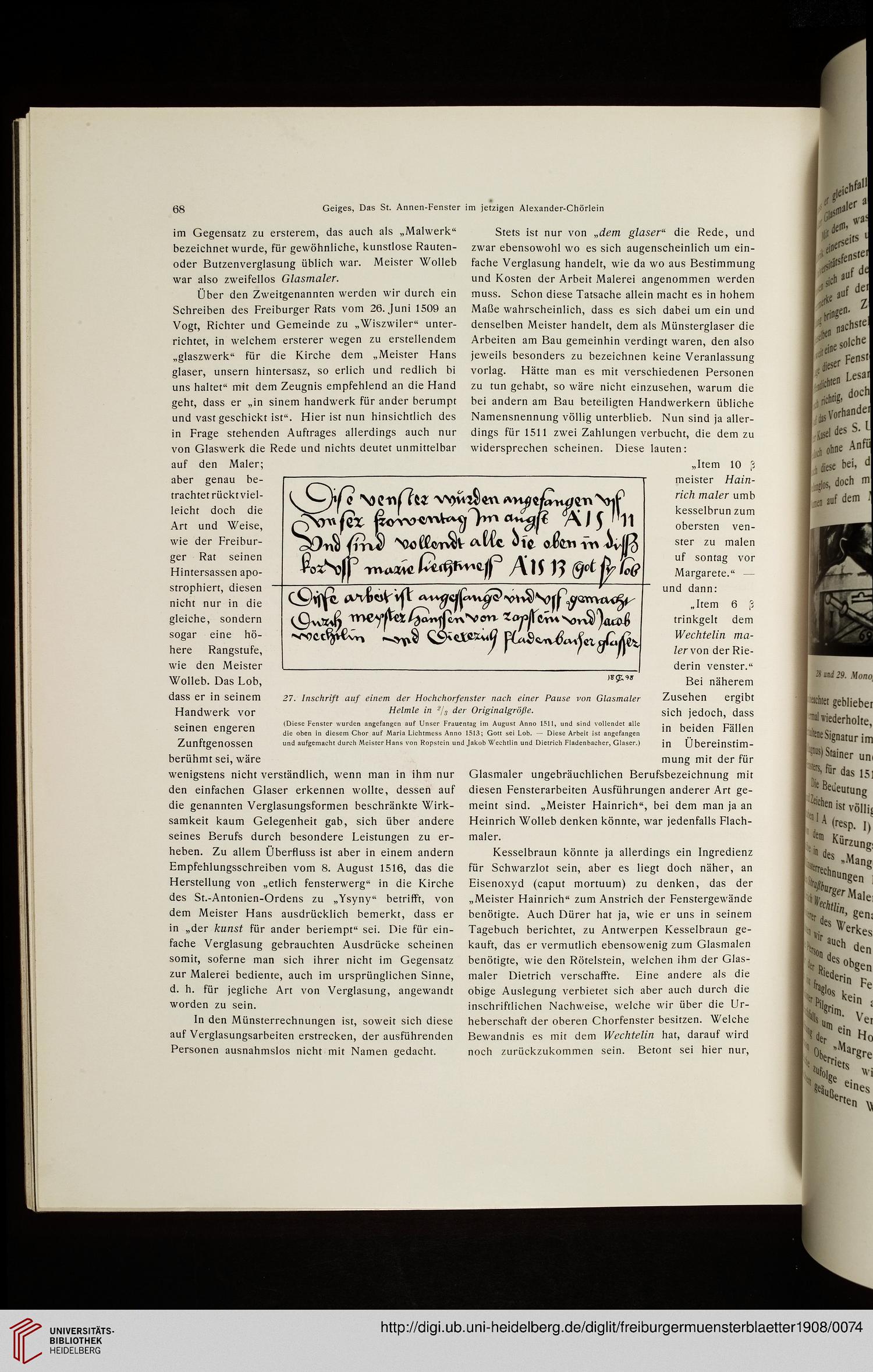68
Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein
im Gegensatz zu ersterem, das auch als „Malwerk"
bezeichnet wurde, für gewöhnliche, kunstlose Rauten-
oder Butzenverglasung üblich war. Meister Wolleb
war also zweifellos Glasmaler.
Über den Zweitgenannten werden wir durch ein
Schreiben des Freiburger Rats vom 26. Juni 1509 an
Vogt, Richter und Gemeinde zu „Wiszwiler" unter-
richtet, in welchem ersterer wegen zu erstellendem
„glaszwerk" für die Kirche dem „Meister Hans
glaser, unsern hintersasz, so erlich und redlich bi
uns haltet" mit dem Zeugnis empfehlend an die Hand
geht, dass er „in sinem handwerk für ander berumpt
und vast geschickt ist". Hier ist nun hinsichtlich des
in Frage stehenden Auftrages allerdings auch nur
von Glaswerk die Rede und nichts deutet unmittelbar
auf den Maler;
aber genau be-
trachtet rückt viel-
leicht doch die
Art und Weise,
wie der Freibur-
ger Rat seinen
Hintersassen apo-
strophiert, diesen
nicht nur in die
gleiche, sondern
sogar eine hö-
here Rangstufe,
wie den Meister
Wolleb. Das Lob,
dass er in seinem
Handwerk vor
seinen engeren
Zunftgenossen
berühmt sei, wäre
wenigstens nicht verständlich, wenn man in ihm nur
den einfachen Glaser erkennen wollte, dessen auf
die genannten Verglasungsformen beschränkte Wirk-
samkeit kaum Gelegenheit gab, sich über andere
seines Berufs durch besondere Leistungen zu er-
heben. Zu allem Überfluss ist aber in einem andern
Empfehlungsschreiben vom 8. August 1516, das die
Herstellung von „etlich fensterwerg" in die Kirche
des St.-Antonien-Ordens zu „Ysyny" betrifft, von
dem Meister Hans ausdrücklich bemerkt, dass er
in „der kunst für ander beriempt" sei. Die für ein-
fache Verglasung gebrauchten Ausdrücke scheinen
somit, soferne man sich ihrer nicht im Gegensatz
zur Malerei bediente, auch im ursprünglichen Sinne,
d. h. für jegliche Art von Verglasung, angewandt
worden zu sein.
In den Münsterrechnungen ist, soweit sich diese
auf Verglasungsarbeiten erstrecken, der ausführenden
Personen ausnahmslos nicht mit Namen gedacht.
^x?ec
27. Inschrift auf einem der Hochchorfenster nach einer Pause von Glasmaler
Heimle in ~j3 der Originalgröße.
(Diese Fenster wurden angefangen auf Unser Frauentag im August Anno 1511, und sind vollendet alle
die oben in diesem Chor auf Maria Lichtmess Anno 1513; Gott sei Lob. — Diese Arbeit ist angefangen
und aufgemacht durch Meister Hans von Ropstein und Jakob Wechtlin und Dietrich Fiadenbacher, Glaser.)
Stets ist nur von „dem glaser"- die Rede, und
zwar ebensowohl wo es sich augenscheinlich um ein-
fache Verglasung handelt, wie da wo aus Bestimmung
und Kosten der Arbeit Malerei angenommen werden
muss. Schon diese Tatsache allein macht es in hohem
Maße wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein und
denselben Meister handelt, dem als Münsterglaser die
Arbeiten am Bau gemeinhin verdingt waren, den also
jeweils besonders zu bezeichnen keine Veranlassung
vorlag. Hätte man es mit verschiedenen Personen
zu tun gehabt, so wäre nicht einzusehen, warum die
bei andern am Bau beteiligten Handwerkern übliche
Namensnennung völlig unterblieb. Nun sind ja aller-
dings für 1511 zwei Zahlungen verbucht, die dem zu
widersprechen scheinen. Diese lauten:
„Item 10 ß
meister Hain-
rich maier umb
kesselbrunzum
obersten ven-
ster zu malen
uf sontag vor
Margarete." —
und dann:
„Item 6 ß
trinkgelt dem
Wechte lin ma-
ier von der Rie-
derin venster."
Bei näherem
Zusehen ergibt
sich jedoch, dass
in beiden Fällen
in Übereinstim-
mung mit der für
Glasmaler ungebräuchlichen Berufsbezeichnung mit
diesen Fensterarbeiten Ausführungen anderer Art ge-
meint sind. „Meister Hainrich", bei dem man ja an
Heinrich Wolleb denken könnte, war jedenfalls Flach-
maler.
Kesselbraun könnte ja allerdings ein Ingredienz
für Schwarzlot sein, aber es liegt doch näher, an
Eisenoxyd (caput mortuum) zu denken, das der
„Meister Hainrich" zum Anstrich der Fenstergewände
benötigte. Auch Dürer hat ja, wie er uns in seinem
Tagebuch berichtet, zu Antwerpen Kesselbraun ge-
kauft, das er vermutlich ebensowenig zum Glasmalen
benötigte, wie den Rötelstein, welchen ihm der Glas-
maler Dietrich verschaffte. Eine andere als die
obige Auslegung verbietet sich aber auch durch die
inschriftlichen Nachweise, welche wir über die Ur-
heberschaft der oberen Chorfenster besitzen. Welche
Bewandnis es mit dem Wechtelin hat, darauf wird
noch zurückzukommen sein. Betont sei hier nur,
nächst
>H^
solche
Fenst
Lesai
doch
I rich«&
Jas Vorhand
»sei des S.
ohne
Anfü
[diese bei,
M* doch m
0 auf dem
limi29. Mono,
•*« geblieber
'Wiederholte,
Signatur im
N Steiner un,
% Tur das 15:
,Die Deutung
;Zdcl*n ist volli,
"lA(resp.,
*" Kürzung:
Chi *Mang
C ngen
k: h "' §en:
. S*e*es
fr. Vel
' »CMar8'e
Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein
im Gegensatz zu ersterem, das auch als „Malwerk"
bezeichnet wurde, für gewöhnliche, kunstlose Rauten-
oder Butzenverglasung üblich war. Meister Wolleb
war also zweifellos Glasmaler.
Über den Zweitgenannten werden wir durch ein
Schreiben des Freiburger Rats vom 26. Juni 1509 an
Vogt, Richter und Gemeinde zu „Wiszwiler" unter-
richtet, in welchem ersterer wegen zu erstellendem
„glaszwerk" für die Kirche dem „Meister Hans
glaser, unsern hintersasz, so erlich und redlich bi
uns haltet" mit dem Zeugnis empfehlend an die Hand
geht, dass er „in sinem handwerk für ander berumpt
und vast geschickt ist". Hier ist nun hinsichtlich des
in Frage stehenden Auftrages allerdings auch nur
von Glaswerk die Rede und nichts deutet unmittelbar
auf den Maler;
aber genau be-
trachtet rückt viel-
leicht doch die
Art und Weise,
wie der Freibur-
ger Rat seinen
Hintersassen apo-
strophiert, diesen
nicht nur in die
gleiche, sondern
sogar eine hö-
here Rangstufe,
wie den Meister
Wolleb. Das Lob,
dass er in seinem
Handwerk vor
seinen engeren
Zunftgenossen
berühmt sei, wäre
wenigstens nicht verständlich, wenn man in ihm nur
den einfachen Glaser erkennen wollte, dessen auf
die genannten Verglasungsformen beschränkte Wirk-
samkeit kaum Gelegenheit gab, sich über andere
seines Berufs durch besondere Leistungen zu er-
heben. Zu allem Überfluss ist aber in einem andern
Empfehlungsschreiben vom 8. August 1516, das die
Herstellung von „etlich fensterwerg" in die Kirche
des St.-Antonien-Ordens zu „Ysyny" betrifft, von
dem Meister Hans ausdrücklich bemerkt, dass er
in „der kunst für ander beriempt" sei. Die für ein-
fache Verglasung gebrauchten Ausdrücke scheinen
somit, soferne man sich ihrer nicht im Gegensatz
zur Malerei bediente, auch im ursprünglichen Sinne,
d. h. für jegliche Art von Verglasung, angewandt
worden zu sein.
In den Münsterrechnungen ist, soweit sich diese
auf Verglasungsarbeiten erstrecken, der ausführenden
Personen ausnahmslos nicht mit Namen gedacht.
^x?ec
27. Inschrift auf einem der Hochchorfenster nach einer Pause von Glasmaler
Heimle in ~j3 der Originalgröße.
(Diese Fenster wurden angefangen auf Unser Frauentag im August Anno 1511, und sind vollendet alle
die oben in diesem Chor auf Maria Lichtmess Anno 1513; Gott sei Lob. — Diese Arbeit ist angefangen
und aufgemacht durch Meister Hans von Ropstein und Jakob Wechtlin und Dietrich Fiadenbacher, Glaser.)
Stets ist nur von „dem glaser"- die Rede, und
zwar ebensowohl wo es sich augenscheinlich um ein-
fache Verglasung handelt, wie da wo aus Bestimmung
und Kosten der Arbeit Malerei angenommen werden
muss. Schon diese Tatsache allein macht es in hohem
Maße wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein und
denselben Meister handelt, dem als Münsterglaser die
Arbeiten am Bau gemeinhin verdingt waren, den also
jeweils besonders zu bezeichnen keine Veranlassung
vorlag. Hätte man es mit verschiedenen Personen
zu tun gehabt, so wäre nicht einzusehen, warum die
bei andern am Bau beteiligten Handwerkern übliche
Namensnennung völlig unterblieb. Nun sind ja aller-
dings für 1511 zwei Zahlungen verbucht, die dem zu
widersprechen scheinen. Diese lauten:
„Item 10 ß
meister Hain-
rich maier umb
kesselbrunzum
obersten ven-
ster zu malen
uf sontag vor
Margarete." —
und dann:
„Item 6 ß
trinkgelt dem
Wechte lin ma-
ier von der Rie-
derin venster."
Bei näherem
Zusehen ergibt
sich jedoch, dass
in beiden Fällen
in Übereinstim-
mung mit der für
Glasmaler ungebräuchlichen Berufsbezeichnung mit
diesen Fensterarbeiten Ausführungen anderer Art ge-
meint sind. „Meister Hainrich", bei dem man ja an
Heinrich Wolleb denken könnte, war jedenfalls Flach-
maler.
Kesselbraun könnte ja allerdings ein Ingredienz
für Schwarzlot sein, aber es liegt doch näher, an
Eisenoxyd (caput mortuum) zu denken, das der
„Meister Hainrich" zum Anstrich der Fenstergewände
benötigte. Auch Dürer hat ja, wie er uns in seinem
Tagebuch berichtet, zu Antwerpen Kesselbraun ge-
kauft, das er vermutlich ebensowenig zum Glasmalen
benötigte, wie den Rötelstein, welchen ihm der Glas-
maler Dietrich verschaffte. Eine andere als die
obige Auslegung verbietet sich aber auch durch die
inschriftlichen Nachweise, welche wir über die Ur-
heberschaft der oberen Chorfenster besitzen. Welche
Bewandnis es mit dem Wechtelin hat, darauf wird
noch zurückzukommen sein. Betont sei hier nur,
nächst
>H^
solche
Fenst
Lesai
doch
I rich«&
Jas Vorhand
»sei des S.
ohne
Anfü
[diese bei,
M* doch m
0 auf dem
limi29. Mono,
•*« geblieber
'Wiederholte,
Signatur im
N Steiner un,
% Tur das 15:
,Die Deutung
;Zdcl*n ist volli,
"lA(resp.,
*" Kürzung:
Chi *Mang
C ngen
k: h "' §en:
. S*e*es
fr. Vel
' »CMar8'e