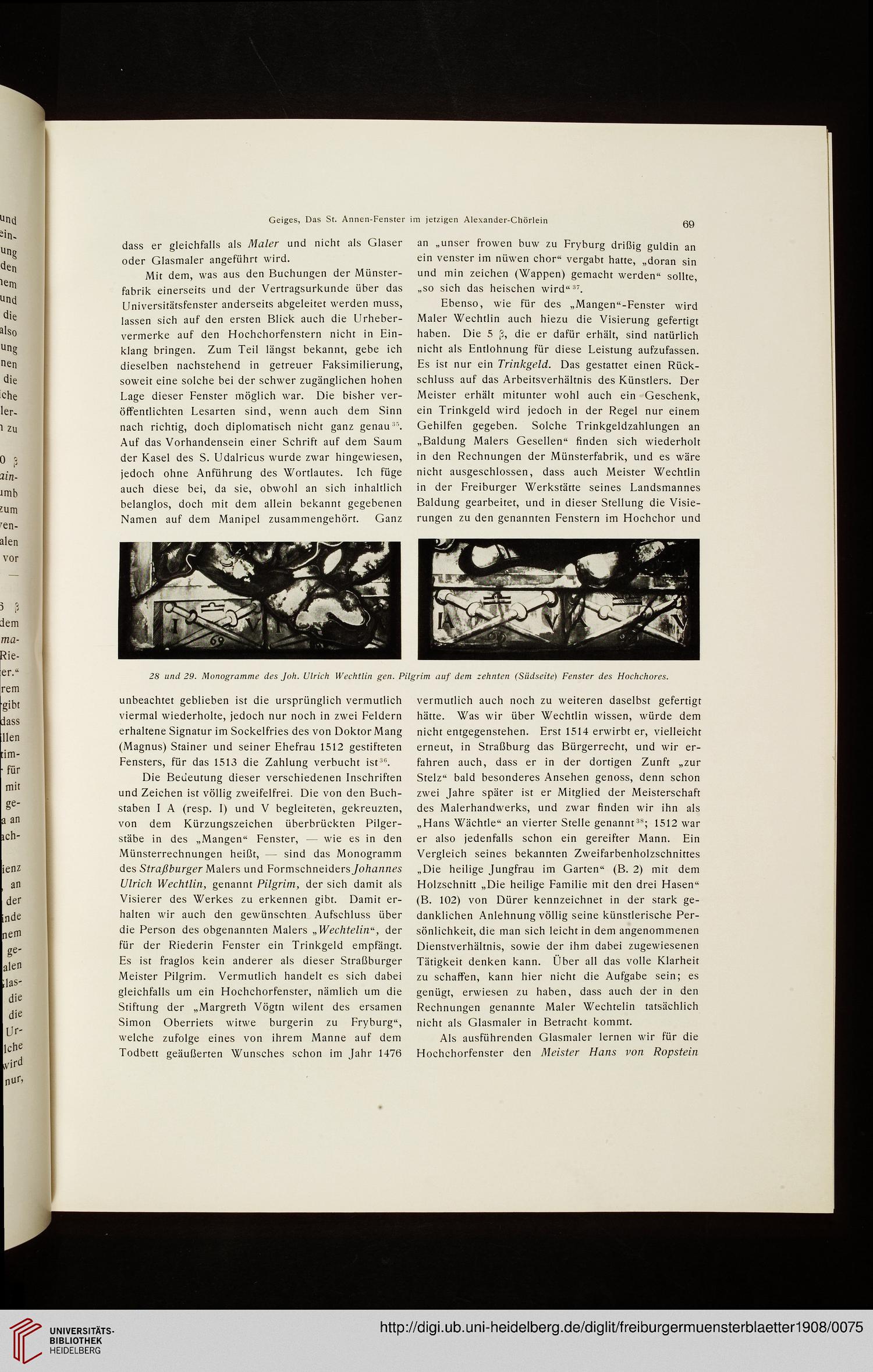Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein
69
dass er gleichfalls als Maler und nicht als Glaser
oder Glasmaler angeführt wird.
Mit dem, was aus den Buchungen der Münster-
fabrik einerseits und der Vertragsurkunde über das
Universitätsfenster anderseits abgeleitet werden muss,
lassen sich auf den ersten Blick auch die Urheber-
vermerke auf den Hochchorfenstern nicht in Ein-
klang bringen. Zum Teil längst bekannt, gebe ich
dieselben nachstehend in getreuer Faksimilierung,
soweit eine solche bei der schwer zugänglichen hohen
Lage dieser Fenster möglich war. Die bisher ver-
öffentlichten Lesarten sind, wenn auch dem Sinn
nach richtig, doch diplomatisch nicht ganz genau 36.
Auf das Vorhandensein einer Schrift auf dem Saum
der Kasel des S. Udalricus wurde zwar hingewiesen,
jedoch ohne Anführung des Wortlautes. Ich füge
auch diese bei, da sie, obwohl an sich inhaltlich
belanglos, doch mit dem allein bekannt gegebenen
Namen auf dem Manipel zusammengehört. Ganz
an „unser frowen buw zu Fryburg drißig guldin an
ein venster im nüwen chor" vergabt hatte, „doran sin
und min zeichen (Wappen) gemacht werden" sollte,
„so sich das heischen wird"37.
Ebenso, wie für des „Mangen"-Fenster wird
Maler Wechtlin auch hiezu die Visierung gefertigt
haben. Die 5 ß, die er dafür erhält, sind natürlich
nicht als Entlohnung für diese Leistung aufzufassen.
Es ist nur ein Trinkgeld. Das gestattet einen Rück-
schluss auf das Arbeitsverhältnis des Künstlers. Der
Meister erhält mitunter wohl auch ein Geschenk,
ein Trinkgeld wird jedoch in der Regel nur einem
Gehilfen gegeben. Solche Trinkgeldzahlungen an
„Baidung Malers Gesellen" finden sich wiederholt
in den Rechnungen der Münsterfabrik, und es wäre
nicht ausgeschlossen, dass auch Meister Wechtlin
in der Freiburger Werkstätte seines Landsmannes
Baidung gearbeitet, und in dieser Stellung die Visie-
rungen zu den genannten Fenstern im Hochchor und
28 und 29. Monogramme des Joh. Ulrich Wechtlin gen. Pilgrim auf dem zehnten (Südseite) Fenster des Hochchores.
unbeachtet geblieben ist die ursprünglich vermutlich
viermal wiederholte, jedoch nur noch in zwei Feldern
erhaltene Signatur im Sockelfries des von Doktor Mang
(Magnus) Stainer und seiner Ehefrau 1512 gestifteten
Fensters, für das 1513 die Zahlung verbucht ist36.
Die Bedeutung dieser verschiedenen Inschriften
und Zeichen ist völlig zweifelfrei. Die von den Buch-
staben I A (resp. I) und V begleiteten, gekreuzten,
von dem Kürzungszeichen überbrückten Pilger-
stäbe in des „Mangen" Fenster, — wie es in den
Münsterrechnungen heißt, — sind das Monogramm
des Straßburger Malers und Formschneidersjo/zanraes
Ulrich Wechtlin, genannt Pilgrim, der sich damit als
Visierer des Werkes zu erkennen gibt. Damit er-
halten wir auch den gewünschten Aufschluss über
die Person des obgenannten Malers „Wechtelin", der
für der Riederin Fenster ein Trinkgeld empfängt.
Es ist fraglos kein anderer als dieser Straßburger
Meister Pilgrim. Vermutlich handelt es sich dabei
gleichfalls um ein Hochchorfenster, nämlich um die
Stiftung der „Margreth Vögtn wilent des ersamen
Simon Oberriets witwe burgerin zu Fryburg",
welche zufolge eines von ihrem Manne auf dem
Todbett geäußerten Wunsches schon im Jahr 1476
vermutlich auch noch zu weiteren daselbst gefertigt
hätte. Was wir über Wechtlin wissen, würde dem
nicht entgegenstehen. Erst 1514 erwirbt er, vielleicht
erneut, in Straßburg das Bürgerrecht, und wir er-
fahren auch, dass er in der dortigen Zunft „zur
Stelz" bald besonderes Ansehen genoss, denn schon
zwei Jahre später ist er Mitglied der Meisterschaft
des Malerhandwerks, und zwar finden wir ihn als
„Hans Wächtle" an vierter Stelle genannt38; 1512 war
er also jedenfalls schon ein gereifter Mann. Ein
Vergleich seines bekannten Zweifarbenholzschnittes
„Die heilige Jungfrau im Garten" (B. 2) mit dem
Holzschnitt „Die heilige Familie mit den drei Hasen"
(B. 102) von Dürer kennzeichnet in der stark ge-
danklichen Anlehnung völlig seine künstlerische Per-
sönlichkeit, die man sich leicht in dem angenommenen
Dienstverhältnis, sowie der ihm dabei zugewiesenen
Tätigkeit denken kann. Über all das volle Klarheit
zu scharfen, kann hier nicht die Aufgabe sein; es
genügt, erwiesen zu haben, dass auch der in den
Rechnungen genannte Maler Wechtelin tatsächlich
nicht als Glasmaler in Betracht kommt.
Als ausführenden Glasmaler lernen wir für die
Hochchorfenster den Meister Hans von Ropstein
69
dass er gleichfalls als Maler und nicht als Glaser
oder Glasmaler angeführt wird.
Mit dem, was aus den Buchungen der Münster-
fabrik einerseits und der Vertragsurkunde über das
Universitätsfenster anderseits abgeleitet werden muss,
lassen sich auf den ersten Blick auch die Urheber-
vermerke auf den Hochchorfenstern nicht in Ein-
klang bringen. Zum Teil längst bekannt, gebe ich
dieselben nachstehend in getreuer Faksimilierung,
soweit eine solche bei der schwer zugänglichen hohen
Lage dieser Fenster möglich war. Die bisher ver-
öffentlichten Lesarten sind, wenn auch dem Sinn
nach richtig, doch diplomatisch nicht ganz genau 36.
Auf das Vorhandensein einer Schrift auf dem Saum
der Kasel des S. Udalricus wurde zwar hingewiesen,
jedoch ohne Anführung des Wortlautes. Ich füge
auch diese bei, da sie, obwohl an sich inhaltlich
belanglos, doch mit dem allein bekannt gegebenen
Namen auf dem Manipel zusammengehört. Ganz
an „unser frowen buw zu Fryburg drißig guldin an
ein venster im nüwen chor" vergabt hatte, „doran sin
und min zeichen (Wappen) gemacht werden" sollte,
„so sich das heischen wird"37.
Ebenso, wie für des „Mangen"-Fenster wird
Maler Wechtlin auch hiezu die Visierung gefertigt
haben. Die 5 ß, die er dafür erhält, sind natürlich
nicht als Entlohnung für diese Leistung aufzufassen.
Es ist nur ein Trinkgeld. Das gestattet einen Rück-
schluss auf das Arbeitsverhältnis des Künstlers. Der
Meister erhält mitunter wohl auch ein Geschenk,
ein Trinkgeld wird jedoch in der Regel nur einem
Gehilfen gegeben. Solche Trinkgeldzahlungen an
„Baidung Malers Gesellen" finden sich wiederholt
in den Rechnungen der Münsterfabrik, und es wäre
nicht ausgeschlossen, dass auch Meister Wechtlin
in der Freiburger Werkstätte seines Landsmannes
Baidung gearbeitet, und in dieser Stellung die Visie-
rungen zu den genannten Fenstern im Hochchor und
28 und 29. Monogramme des Joh. Ulrich Wechtlin gen. Pilgrim auf dem zehnten (Südseite) Fenster des Hochchores.
unbeachtet geblieben ist die ursprünglich vermutlich
viermal wiederholte, jedoch nur noch in zwei Feldern
erhaltene Signatur im Sockelfries des von Doktor Mang
(Magnus) Stainer und seiner Ehefrau 1512 gestifteten
Fensters, für das 1513 die Zahlung verbucht ist36.
Die Bedeutung dieser verschiedenen Inschriften
und Zeichen ist völlig zweifelfrei. Die von den Buch-
staben I A (resp. I) und V begleiteten, gekreuzten,
von dem Kürzungszeichen überbrückten Pilger-
stäbe in des „Mangen" Fenster, — wie es in den
Münsterrechnungen heißt, — sind das Monogramm
des Straßburger Malers und Formschneidersjo/zanraes
Ulrich Wechtlin, genannt Pilgrim, der sich damit als
Visierer des Werkes zu erkennen gibt. Damit er-
halten wir auch den gewünschten Aufschluss über
die Person des obgenannten Malers „Wechtelin", der
für der Riederin Fenster ein Trinkgeld empfängt.
Es ist fraglos kein anderer als dieser Straßburger
Meister Pilgrim. Vermutlich handelt es sich dabei
gleichfalls um ein Hochchorfenster, nämlich um die
Stiftung der „Margreth Vögtn wilent des ersamen
Simon Oberriets witwe burgerin zu Fryburg",
welche zufolge eines von ihrem Manne auf dem
Todbett geäußerten Wunsches schon im Jahr 1476
vermutlich auch noch zu weiteren daselbst gefertigt
hätte. Was wir über Wechtlin wissen, würde dem
nicht entgegenstehen. Erst 1514 erwirbt er, vielleicht
erneut, in Straßburg das Bürgerrecht, und wir er-
fahren auch, dass er in der dortigen Zunft „zur
Stelz" bald besonderes Ansehen genoss, denn schon
zwei Jahre später ist er Mitglied der Meisterschaft
des Malerhandwerks, und zwar finden wir ihn als
„Hans Wächtle" an vierter Stelle genannt38; 1512 war
er also jedenfalls schon ein gereifter Mann. Ein
Vergleich seines bekannten Zweifarbenholzschnittes
„Die heilige Jungfrau im Garten" (B. 2) mit dem
Holzschnitt „Die heilige Familie mit den drei Hasen"
(B. 102) von Dürer kennzeichnet in der stark ge-
danklichen Anlehnung völlig seine künstlerische Per-
sönlichkeit, die man sich leicht in dem angenommenen
Dienstverhältnis, sowie der ihm dabei zugewiesenen
Tätigkeit denken kann. Über all das volle Klarheit
zu scharfen, kann hier nicht die Aufgabe sein; es
genügt, erwiesen zu haben, dass auch der in den
Rechnungen genannte Maler Wechtelin tatsächlich
nicht als Glasmaler in Betracht kommt.
Als ausführenden Glasmaler lernen wir für die
Hochchorfenster den Meister Hans von Ropstein