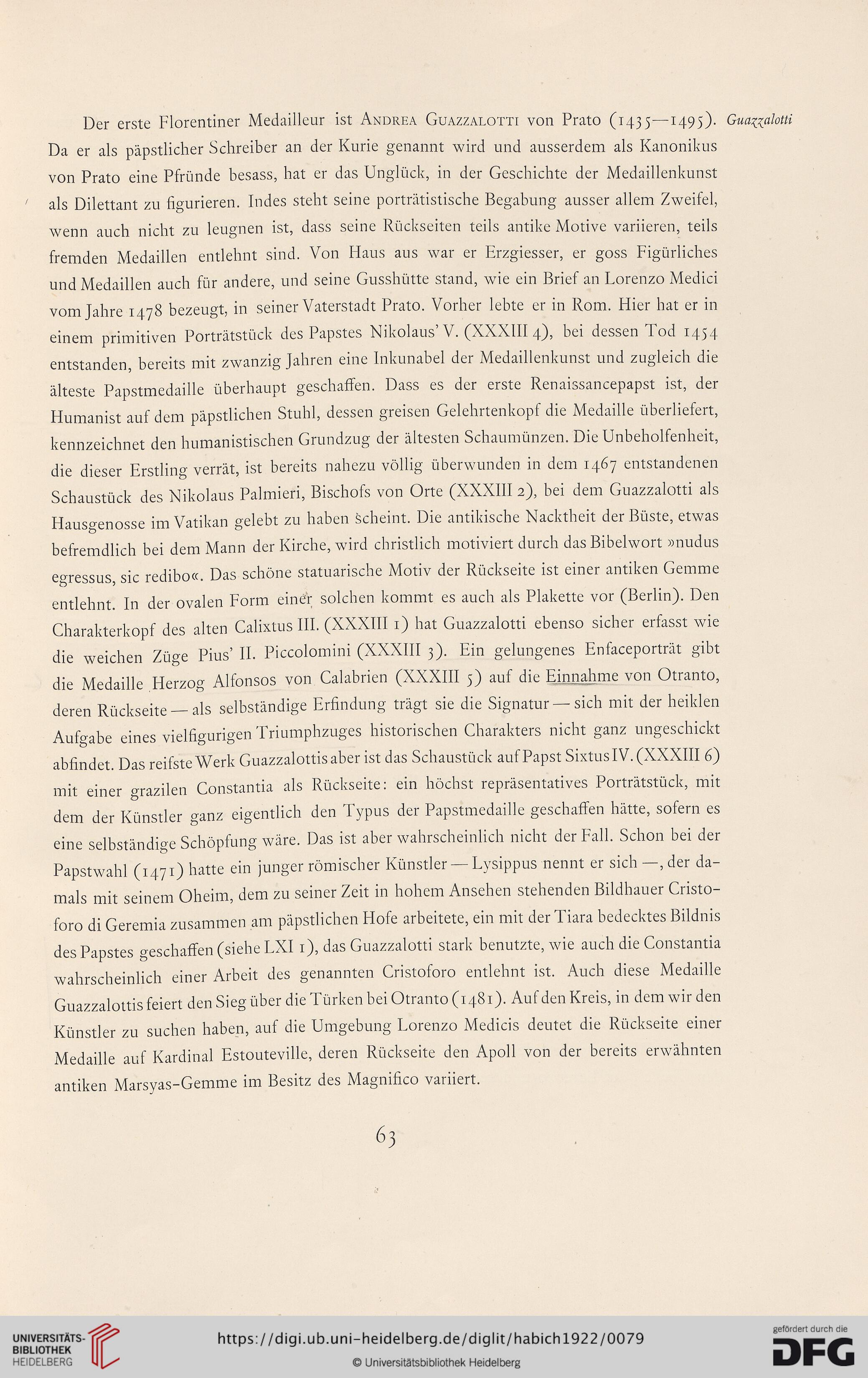Der erste Florentiner Medailleur ist Andrea Guazzalotti von Prato (1435—1495)- Gua^dlotti
Da er als päpstlicher Schreiber an der Kurie genannt wird und ausserdem als Kanonikus
von Prato eine Pfründe besass, hat er das Unglück, in der Geschichte der Medaillenkunst
als Dilettant zu figurieren. Indes steht seine porträtistische Begabung äusser allem Zweifel,
wenn auch nicht zu leugnen ist, dass seine Rückseiten teils antike Motive variieren, teils
fremden Medaillen entlehnt sind. Von Haus aus war er Erzgiesser, er goss Figürliches
und Medaillen auch für andere, und seine Gusshütte stand, wie ein Brief an Lorenzo Medici
vom Jahre 1478 bezeugt, in seinerVaterstadt Prato. Vorher lebte er in Rom. Hier hat er in
einem primitiven Porträtstück des Papstes Nikolaus’V. (XXXIII 4), bei dessen Tod 1454
entstanden bereits mit zwanzig Jahren eine Inkunabel der Medaillenkunst und zugleich die
älteste Papstmedaille überhaupt geschaffen. Dass es der erste Renaissancepapst ist, der
Humanist auf dem päpstlichen Stuhl, dessen greisen Gelehrtenkopf die Medaille überliefert,
kennzeichnet den humanistischen Grundzug der ältesten Schaumünzen. Die Unbeholfenheit,
die dieser Erstling verrät, ist bereits nahezu völlig überwunden in dem 1467 entstandenen
Schaustück des Nikolaus Palmieri, Bischofs von Orte (XXXIII 2), bei dem Guazzalotti als
Hausgenosse im Vatikan gelebt zu haben scheint. Die antikische Nacktheit der Büste, etwas
befremdlich bei dem Mann der Kirche, wird christlich motiviert durch das Bibelwort »nudus
egressus sic redibo«. Das schöne statuarische Motiv der Rückseite ist einer antiken Gemme
entlehnt. In der ovalen Form einer solchen kommt es auch als Plakette vor (Berlin). Den
Charakterkopf des alten Calixtus III. (XXXIII 1) hat Guazzalotti ebenso sicher erfasst wie
die weichen Züge Pius’ II. Piccolomini (XXXIII 3). Ein gelungenes Enfaceporträt gibt
die Medaille Herzog Alfonsos von Calabrien (XXXIII 5) auf die Einnahme von Otranto,
deren Rückseite als selbständige Erfindung trägt sie die Signatur — sich mit der heiklen
Aufgabe eines vielfigurigen Triumphzuges historischen Charakters nicht ganz ungeschickt
abfindet Das reifste Werk Guazzalottisaber ist das Schaustück auf Papst Sixtus IV. (XXXIII 6)
mit einer grazilen Constantia als Rückseite: ein höchst repräsentatives Porträtstück, mit
dem der Künstler ganz eigentlich den Typus der Papstmedaille geschaffen hätte, sofern es
eine selbständige Schöpfung wäre. Das ist aber wahrscheinlich nicht der Fall. Schon bei der
Papstwahl (1471) hatte ein junger römischer Künstler — Lysippus nennt er sich —, der da-
mals mit seinem Oheim, dem zu seiner Zeit in hohem Ansehen stehenden Bildhauer Cristo-
foro di Geremia zusammen am päpstlichen Hofe arbeitete, ein mit der Tiara bedecktes Bildnis
des Papstes geschaffen (siehe LXI 1), das Guazzalotti stark benutzte, wie auch die Constantia
wahrscheinlich einer Arbeit des genannten Cristoforo entlehnt ist. Auch diese Medaille
Guazzalottis feiert den Sieg über die Türken bei Otranto (1481). Auf den Kreis, in dem wir den
Künstler zu suchen haben, auf die Umgebung Lorenzo Medicis deutet die Rückseite einer
Medaille auf Kardinal Estouteville, deren Rückseite den Apoll von der bereits erwähnten
antiken Marsyas-Gemme im Besitz des Magnifico variiert.
63
Da er als päpstlicher Schreiber an der Kurie genannt wird und ausserdem als Kanonikus
von Prato eine Pfründe besass, hat er das Unglück, in der Geschichte der Medaillenkunst
als Dilettant zu figurieren. Indes steht seine porträtistische Begabung äusser allem Zweifel,
wenn auch nicht zu leugnen ist, dass seine Rückseiten teils antike Motive variieren, teils
fremden Medaillen entlehnt sind. Von Haus aus war er Erzgiesser, er goss Figürliches
und Medaillen auch für andere, und seine Gusshütte stand, wie ein Brief an Lorenzo Medici
vom Jahre 1478 bezeugt, in seinerVaterstadt Prato. Vorher lebte er in Rom. Hier hat er in
einem primitiven Porträtstück des Papstes Nikolaus’V. (XXXIII 4), bei dessen Tod 1454
entstanden bereits mit zwanzig Jahren eine Inkunabel der Medaillenkunst und zugleich die
älteste Papstmedaille überhaupt geschaffen. Dass es der erste Renaissancepapst ist, der
Humanist auf dem päpstlichen Stuhl, dessen greisen Gelehrtenkopf die Medaille überliefert,
kennzeichnet den humanistischen Grundzug der ältesten Schaumünzen. Die Unbeholfenheit,
die dieser Erstling verrät, ist bereits nahezu völlig überwunden in dem 1467 entstandenen
Schaustück des Nikolaus Palmieri, Bischofs von Orte (XXXIII 2), bei dem Guazzalotti als
Hausgenosse im Vatikan gelebt zu haben scheint. Die antikische Nacktheit der Büste, etwas
befremdlich bei dem Mann der Kirche, wird christlich motiviert durch das Bibelwort »nudus
egressus sic redibo«. Das schöne statuarische Motiv der Rückseite ist einer antiken Gemme
entlehnt. In der ovalen Form einer solchen kommt es auch als Plakette vor (Berlin). Den
Charakterkopf des alten Calixtus III. (XXXIII 1) hat Guazzalotti ebenso sicher erfasst wie
die weichen Züge Pius’ II. Piccolomini (XXXIII 3). Ein gelungenes Enfaceporträt gibt
die Medaille Herzog Alfonsos von Calabrien (XXXIII 5) auf die Einnahme von Otranto,
deren Rückseite als selbständige Erfindung trägt sie die Signatur — sich mit der heiklen
Aufgabe eines vielfigurigen Triumphzuges historischen Charakters nicht ganz ungeschickt
abfindet Das reifste Werk Guazzalottisaber ist das Schaustück auf Papst Sixtus IV. (XXXIII 6)
mit einer grazilen Constantia als Rückseite: ein höchst repräsentatives Porträtstück, mit
dem der Künstler ganz eigentlich den Typus der Papstmedaille geschaffen hätte, sofern es
eine selbständige Schöpfung wäre. Das ist aber wahrscheinlich nicht der Fall. Schon bei der
Papstwahl (1471) hatte ein junger römischer Künstler — Lysippus nennt er sich —, der da-
mals mit seinem Oheim, dem zu seiner Zeit in hohem Ansehen stehenden Bildhauer Cristo-
foro di Geremia zusammen am päpstlichen Hofe arbeitete, ein mit der Tiara bedecktes Bildnis
des Papstes geschaffen (siehe LXI 1), das Guazzalotti stark benutzte, wie auch die Constantia
wahrscheinlich einer Arbeit des genannten Cristoforo entlehnt ist. Auch diese Medaille
Guazzalottis feiert den Sieg über die Türken bei Otranto (1481). Auf den Kreis, in dem wir den
Künstler zu suchen haben, auf die Umgebung Lorenzo Medicis deutet die Rückseite einer
Medaille auf Kardinal Estouteville, deren Rückseite den Apoll von der bereits erwähnten
antiken Marsyas-Gemme im Besitz des Magnifico variiert.
63