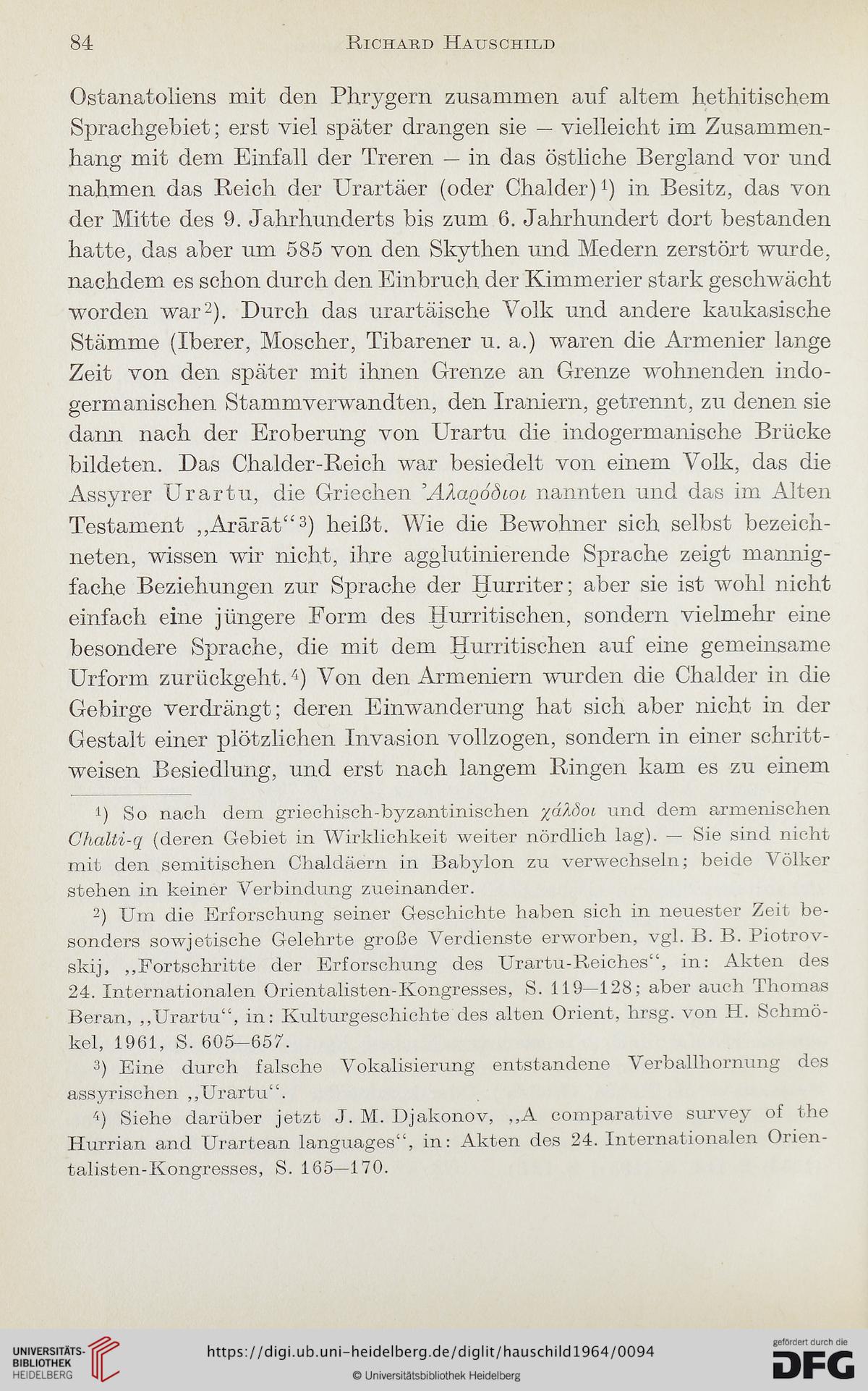84
Richard Hauschild
Ostanatoliens mit den Phrygern zusammen auf altem hethitischem
Sprachgebiet; erst viel später drangen sie — vielleicht im Zusammen-
hang mit dem Einfall der Treren — in das östliche Bergland vor und
nahmen das Reich der Urartäer (oder Chalder)1) in Besitz, das von
der Mitte des 9. Jahrhunderts bis zum 6. Jahrhundert dort bestanden
hatte, das aber um 585 von den Skythen und Medern zerstört wurde,
nachdem es schon durch den Einbruch der Kimmerier stark geschwächt
worden war2). Durch das urartäische Volk und andere kaukasische
Stämme (Iberer, Moscher, Tibarener u. a.) waren die Armenier lange
Zeit von den später mit ihnen Grenze an Grenze wohnenden indo-
germanischen Stammverwandten, den Iraniern, getrennt, zu denen sie
dami nach der Eroberung von Urartu die indogermanische Brücke
bildeten. Das Chalder-Reich war besiedelt von einem Volk, das die
Assyrer Urartu, die Griechen Άλαρόδιοι nannten und das im Alten
Testament „Arärät“3) heißt. Wie die Bewohner sich selbst bezeich-
neten, wissen wir nicht, ihre agglutinierende Sprache zeigt mannig-
fache Beziehungen zur Sprache der Hurriter; aber sie ist wohl nicht
einfach eine jüngere Form des Hurritischen, sondern vielmehr eine
besondere Sprache, die mit dem Hurritischen auf eine gemeinsame
Urform zurückgeht.4) Von den Armeniern wurden die Chalder in die
Gebirge verdrängt; deren Einwanderung hat sich aber nicht in der
Gestalt einer plötzlichen Invasion vollzogen, sondern in einer schritt-
weisen Besiedlung, und erst nach langem Ringen kam es zu einem
1) So nach dem griechisch-byzantinischen χάλδοι und dem armenischen
Chalti-q (deren Gebiet in Wirklichkeit weiter nördlich lag). — Sie sind nicht
mit den semitischen Chaldäern in Babylon zu verwechseln; beide Völker
stehen in keiner Verbindung zueinander.
2) Um die Erforschung seiner Geschichte haben sich in neuester Zeit be-
sonders sowjetische Gelehrte große Verdienste erworben, vgl. B. B. Piotrov-
skij, „Fortschritte der Erforschung des Urartu-Reiches“, in: Akten des
24. Internationalen Orientalisten-Kongresses, S. 119—128; aber auch Thomas
Beran, „Urartu“, in: Kulturgeschichte des alten Orient, hrsg. von H. Schmö-
kel, 1961, S. 605-657.
3) Eine durch falsche Vokalisierung entstandene Verballhornung des
assyrischen „Urartu“.
4) Siehe darüber jetzt J. Μ. Djakonov, „A comparative survey of the
Hurrian and Urartean languages“, in: Akten des 24. Internationalen Orien-
talisten-Kongresses, S. 165—170.
Richard Hauschild
Ostanatoliens mit den Phrygern zusammen auf altem hethitischem
Sprachgebiet; erst viel später drangen sie — vielleicht im Zusammen-
hang mit dem Einfall der Treren — in das östliche Bergland vor und
nahmen das Reich der Urartäer (oder Chalder)1) in Besitz, das von
der Mitte des 9. Jahrhunderts bis zum 6. Jahrhundert dort bestanden
hatte, das aber um 585 von den Skythen und Medern zerstört wurde,
nachdem es schon durch den Einbruch der Kimmerier stark geschwächt
worden war2). Durch das urartäische Volk und andere kaukasische
Stämme (Iberer, Moscher, Tibarener u. a.) waren die Armenier lange
Zeit von den später mit ihnen Grenze an Grenze wohnenden indo-
germanischen Stammverwandten, den Iraniern, getrennt, zu denen sie
dami nach der Eroberung von Urartu die indogermanische Brücke
bildeten. Das Chalder-Reich war besiedelt von einem Volk, das die
Assyrer Urartu, die Griechen Άλαρόδιοι nannten und das im Alten
Testament „Arärät“3) heißt. Wie die Bewohner sich selbst bezeich-
neten, wissen wir nicht, ihre agglutinierende Sprache zeigt mannig-
fache Beziehungen zur Sprache der Hurriter; aber sie ist wohl nicht
einfach eine jüngere Form des Hurritischen, sondern vielmehr eine
besondere Sprache, die mit dem Hurritischen auf eine gemeinsame
Urform zurückgeht.4) Von den Armeniern wurden die Chalder in die
Gebirge verdrängt; deren Einwanderung hat sich aber nicht in der
Gestalt einer plötzlichen Invasion vollzogen, sondern in einer schritt-
weisen Besiedlung, und erst nach langem Ringen kam es zu einem
1) So nach dem griechisch-byzantinischen χάλδοι und dem armenischen
Chalti-q (deren Gebiet in Wirklichkeit weiter nördlich lag). — Sie sind nicht
mit den semitischen Chaldäern in Babylon zu verwechseln; beide Völker
stehen in keiner Verbindung zueinander.
2) Um die Erforschung seiner Geschichte haben sich in neuester Zeit be-
sonders sowjetische Gelehrte große Verdienste erworben, vgl. B. B. Piotrov-
skij, „Fortschritte der Erforschung des Urartu-Reiches“, in: Akten des
24. Internationalen Orientalisten-Kongresses, S. 119—128; aber auch Thomas
Beran, „Urartu“, in: Kulturgeschichte des alten Orient, hrsg. von H. Schmö-
kel, 1961, S. 605-657.
3) Eine durch falsche Vokalisierung entstandene Verballhornung des
assyrischen „Urartu“.
4) Siehe darüber jetzt J. Μ. Djakonov, „A comparative survey of the
Hurrian and Urartean languages“, in: Akten des 24. Internationalen Orien-
talisten-Kongresses, S. 165—170.