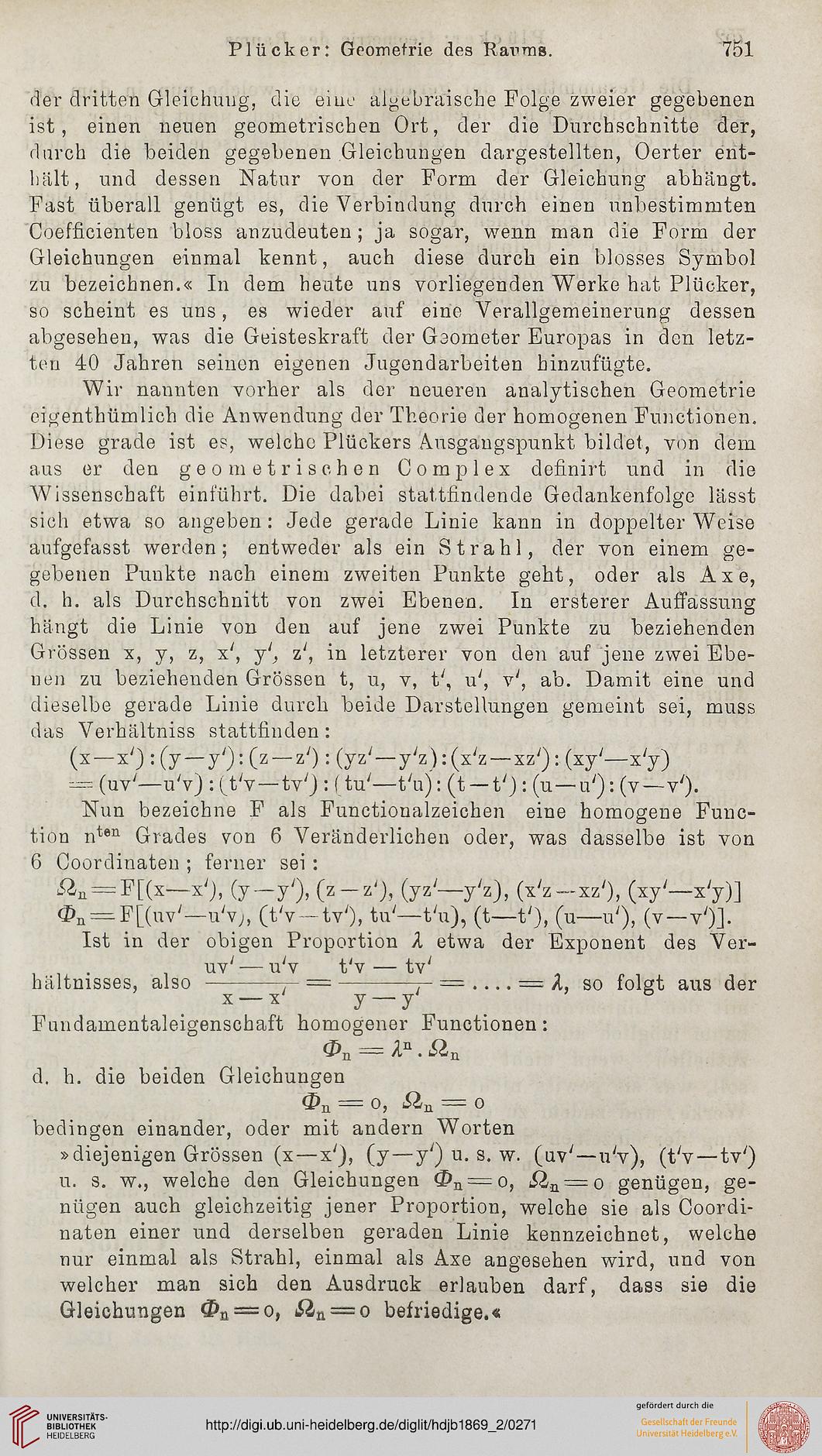PI Ücker: Geometrie des Ravms.
751
der dritten Gleichung, die eine algebraische Folge zweier gegebenen
ist, einen neuen geometrischen Ort, der die Durchschnitte der,
durch die beiden gegebenen Gleichungen dargestellten, Oerter ent-
hält, und dessen Natur von der Form der Gleichung abhängt.
Fast überall genügt es, die Verbindung durch einen unbestimmten
Coefficienten bloss anzudeuten; ja sogar, wenn man die Form der
Gleichungen einmal kennt, auch diese durch ein blosses Symbol
zu bezeichnen.« In dem heute uns vorliegenden Werke hat Plücker,
so scheint es uns, es wieder auf eine Verallgemeinerung dessen
abgesehen, was die Geisteskraft der Geometer Europas in den letz-
ten 40 Jahren seinen eigenen Jugendarbeiten hinzufügte.
Wir nannten vorher als der neueren analytischen Geometrie
eigenthümlich die Anwendung der Theorie der homogenen Functionen.
Diese grade ist es, welche Plückers Ausgangspunkt bildet, von dem
aus er den geometrischen Complex definirt und in die
Wissenschaft einfuhrt. Die dabei stattfindende Gedankenfolge lässt
sich etwa so angeben: Jede gerade Linie kann in doppelter Weise
aufgefasst werden; entweder als ein Strahl, der von einem ge-
gebenen Punkte nach einem zweiten Punkte geht, oder als Axe,
d. h. als Durchschnitt von zwei Ebenen. In ersterer Auffassung
hängt die Linie von den auf jene zwei Punkte zu beziehenden
Grössen x, y, z, x', y', z', in letzterer von den auf jene zwei Ebe-
nen zu beziehenden Grössen t, u, v, t', u', v', ab. Damit eine und
dieselbe gerade Linie durch beide Darstellungen gemeint sei, muss
das Verhältniss stattfinden:
(x—x'j : (y—y'): (z —z'): (yz'~y'z): (x'z—xz'): (xy'~x'y)
— (uv'—u'v) : (t'v—tv') : (tu'—t'u): (t —t'): (u—u'): (v—v').
Nun bezeichne F als Functionalzeichen eine homogene Func-
tion nten Grades von 6 Veränderlichen oder, was dasselbe ist von
6 Coordinaten ; ferner sei :
lQk = F[(x—x'), (y —y'), (z-z'), (yz'—y'z), (x'z —xz'), (xy'—x'y)]
0n = F[(uv'—u'v/, (t'v—tv'), tu'—t'u), (t—t'), (u—u'), (v —v')].
Ist in der obigen Proportion A etwa der Exponent des Ver-
, ,, . , uv' — u'v t'v — tv'
hältnisses, also -7— =-= .... = ä, so folgt aus der
x —x' y — y
Fundamentaleigenschaft homogener Functionen:
0n = An . ßn
d. h. die beiden Gleichungen
<Pn = 0, = 0
bedingen einander, oder mit andern Worten
»diejenigen Grössen (x—x'), (y — y') u. s. w. (uv'—u'v), (t'v — tv')
u. s. w., welche den Gleichungen ®n = o, = o genügen, ge-
nügen auch gleichzeitig jener Proportion, welche sie als Coordi-
naten einer und derselben geraden Linie kennzeichnet, welche
nur einmal als Strahl, einmal als Axe angesehen wird, und von
welcher man sich den Ausdruck erlauben darf, dass sie die
Gleichungen <X>n = o, ßfl = o befriedige.«
751
der dritten Gleichung, die eine algebraische Folge zweier gegebenen
ist, einen neuen geometrischen Ort, der die Durchschnitte der,
durch die beiden gegebenen Gleichungen dargestellten, Oerter ent-
hält, und dessen Natur von der Form der Gleichung abhängt.
Fast überall genügt es, die Verbindung durch einen unbestimmten
Coefficienten bloss anzudeuten; ja sogar, wenn man die Form der
Gleichungen einmal kennt, auch diese durch ein blosses Symbol
zu bezeichnen.« In dem heute uns vorliegenden Werke hat Plücker,
so scheint es uns, es wieder auf eine Verallgemeinerung dessen
abgesehen, was die Geisteskraft der Geometer Europas in den letz-
ten 40 Jahren seinen eigenen Jugendarbeiten hinzufügte.
Wir nannten vorher als der neueren analytischen Geometrie
eigenthümlich die Anwendung der Theorie der homogenen Functionen.
Diese grade ist es, welche Plückers Ausgangspunkt bildet, von dem
aus er den geometrischen Complex definirt und in die
Wissenschaft einfuhrt. Die dabei stattfindende Gedankenfolge lässt
sich etwa so angeben: Jede gerade Linie kann in doppelter Weise
aufgefasst werden; entweder als ein Strahl, der von einem ge-
gebenen Punkte nach einem zweiten Punkte geht, oder als Axe,
d. h. als Durchschnitt von zwei Ebenen. In ersterer Auffassung
hängt die Linie von den auf jene zwei Punkte zu beziehenden
Grössen x, y, z, x', y', z', in letzterer von den auf jene zwei Ebe-
nen zu beziehenden Grössen t, u, v, t', u', v', ab. Damit eine und
dieselbe gerade Linie durch beide Darstellungen gemeint sei, muss
das Verhältniss stattfinden:
(x—x'j : (y—y'): (z —z'): (yz'~y'z): (x'z—xz'): (xy'~x'y)
— (uv'—u'v) : (t'v—tv') : (tu'—t'u): (t —t'): (u—u'): (v—v').
Nun bezeichne F als Functionalzeichen eine homogene Func-
tion nten Grades von 6 Veränderlichen oder, was dasselbe ist von
6 Coordinaten ; ferner sei :
lQk = F[(x—x'), (y —y'), (z-z'), (yz'—y'z), (x'z —xz'), (xy'—x'y)]
0n = F[(uv'—u'v/, (t'v—tv'), tu'—t'u), (t—t'), (u—u'), (v —v')].
Ist in der obigen Proportion A etwa der Exponent des Ver-
, ,, . , uv' — u'v t'v — tv'
hältnisses, also -7— =-= .... = ä, so folgt aus der
x —x' y — y
Fundamentaleigenschaft homogener Functionen:
0n = An . ßn
d. h. die beiden Gleichungen
<Pn = 0, = 0
bedingen einander, oder mit andern Worten
»diejenigen Grössen (x—x'), (y — y') u. s. w. (uv'—u'v), (t'v — tv')
u. s. w., welche den Gleichungen ®n = o, = o genügen, ge-
nügen auch gleichzeitig jener Proportion, welche sie als Coordi-
naten einer und derselben geraden Linie kennzeichnet, welche
nur einmal als Strahl, einmal als Axe angesehen wird, und von
welcher man sich den Ausdruck erlauben darf, dass sie die
Gleichungen <X>n = o, ßfl = o befriedige.«