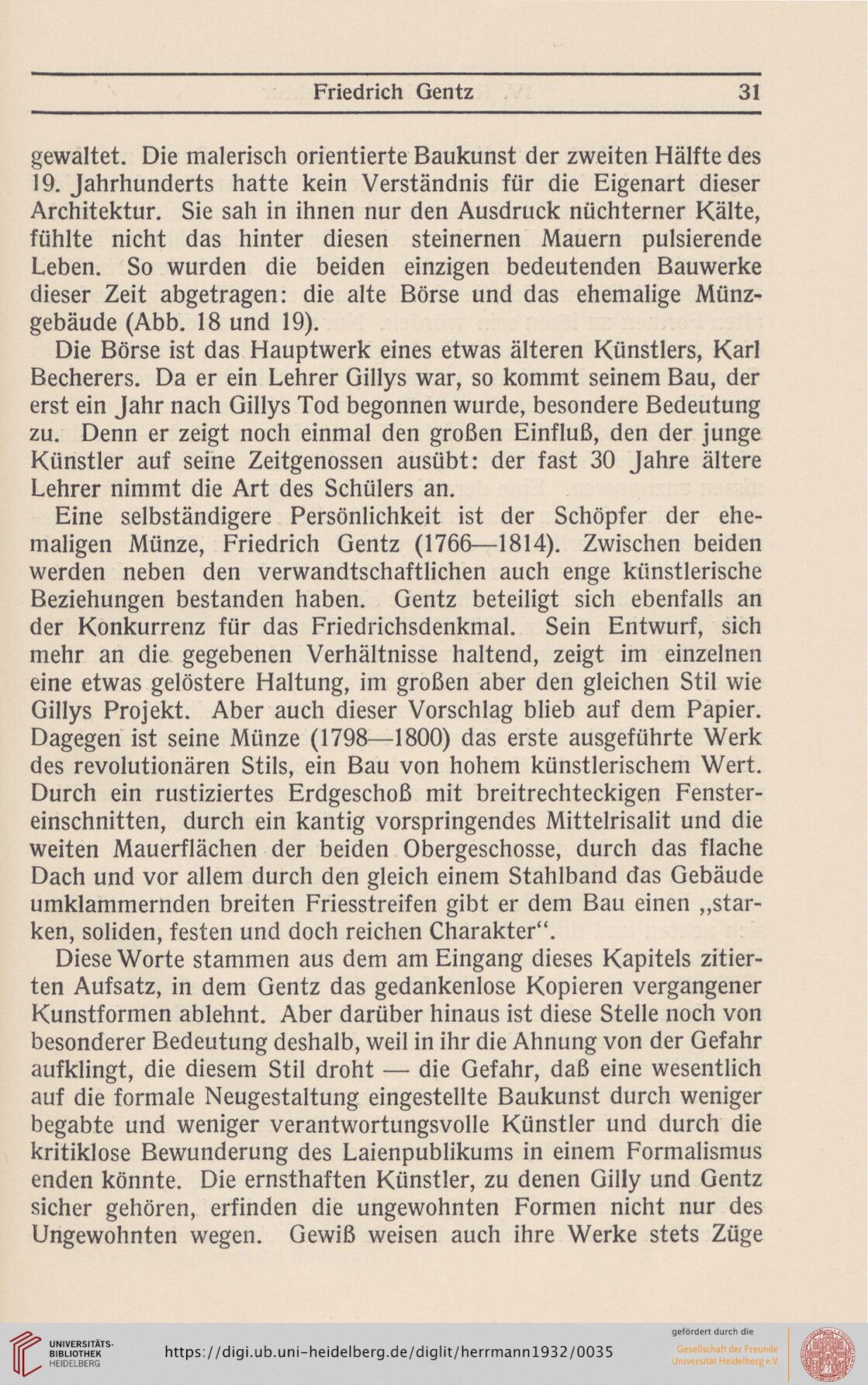Friedrich Gentz
31
gewaltet. Die malerisch orientierte Baukunst der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts hatte kein Verständnis für die Eigenart dieser
Architektur. Sie sah in ihnen nur den Ausdruck nüchterner Kälte,
fühlte nicht das hinter diesen steinernen Mauern pulsierende
Leben. So wurden die beiden einzigen bedeutenden Bauwerke
dieser Zeit abgetragen: die alte Börse und das ehemalige Münz-
gebäude (Abb. 18 und 19).
Die Börse ist das Hauptwerk eines etwas älteren Künstlers, Karl
Becherers. Da er ein Lehrer Gillys war, so kommt seinem Bau, der
erst ein Jahr nach Gillys Tod begonnen wurde, besondere Bedeutung
zu. Denn er zeigt noch einmal den großen Einfluß, den der junge
Künstler auf seine Zeitgenossen ausübt: der fast 30 Jahre ältere
Lehrer nimmt die Art des Schülers an.
Eine selbständigere Persönlichkeit ist der Schöpfer der ehe-
maligen Münze, Friedrich Gentz (1766—1814). Zwischen beiden
werden neben den verwandtschaftlichen auch enge künstlerische
Beziehungen bestanden haben. Gentz beteiligt sich ebenfalls an
der Konkurrenz für das Friedrichsdenkmal. Sein Entwurf, sich
mehr an die gegebenen Verhältnisse haltend, zeigt im einzelnen
eine etwas gelöstere Haltung, im großen aber den gleichen Stil wie
Gillys Projekt. Aber auch dieser Vorschlag blieb auf dem Papier.
Dagegen ist seine Münze (1798—1800) das erste ausgeführte Werk
des revolutionären Stils, ein Bau von hohem künstlerischem Wert.
Durch ein rustiziertes Erdgeschoß mit breitrechteckigen Fenster-
einschnitten, durch ein kantig vorspringendes Mittelrisalit und die
weiten Mauerflächen der beiden Obergeschosse, durch das flache
Dach und vor allem durch den gleich einem Stahlband das Gebäude
umklammernden breiten Friesstreifen gibt er dem Bau einen „star-
ken, soliden, festen und doch reichen Charakter“.
Diese Worte stammen aus dem am Eingang dieses Kapitels zitier-
ten Aufsatz, in dem Gentz das gedankenlose Kopieren vergangener
Kunstformen ablehnt. Aber darüber hinaus ist diese Stelle noch von
besonderer Bedeutung deshalb, weil in ihr die Ahnung von der Gefahr
aufklingt, die diesem Stil droht — die Gefahr, daß eine wesentlich
auf die formale Neugestaltung eingestellte Baukunst durch weniger
begabte und weniger verantwortungsvolle Künstler und durch die
kritiklose Bewunderung des Laienpublikums in einem Formalismus
enden könnte. Die ernsthaften Künstler, zu denen Gilly und Gentz
sicher gehören, erfinden die ungewohnten Formen nicht nur des
Ungewohnten wegen. Gewiß weisen auch ihre Werke stets Züge
31
gewaltet. Die malerisch orientierte Baukunst der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts hatte kein Verständnis für die Eigenart dieser
Architektur. Sie sah in ihnen nur den Ausdruck nüchterner Kälte,
fühlte nicht das hinter diesen steinernen Mauern pulsierende
Leben. So wurden die beiden einzigen bedeutenden Bauwerke
dieser Zeit abgetragen: die alte Börse und das ehemalige Münz-
gebäude (Abb. 18 und 19).
Die Börse ist das Hauptwerk eines etwas älteren Künstlers, Karl
Becherers. Da er ein Lehrer Gillys war, so kommt seinem Bau, der
erst ein Jahr nach Gillys Tod begonnen wurde, besondere Bedeutung
zu. Denn er zeigt noch einmal den großen Einfluß, den der junge
Künstler auf seine Zeitgenossen ausübt: der fast 30 Jahre ältere
Lehrer nimmt die Art des Schülers an.
Eine selbständigere Persönlichkeit ist der Schöpfer der ehe-
maligen Münze, Friedrich Gentz (1766—1814). Zwischen beiden
werden neben den verwandtschaftlichen auch enge künstlerische
Beziehungen bestanden haben. Gentz beteiligt sich ebenfalls an
der Konkurrenz für das Friedrichsdenkmal. Sein Entwurf, sich
mehr an die gegebenen Verhältnisse haltend, zeigt im einzelnen
eine etwas gelöstere Haltung, im großen aber den gleichen Stil wie
Gillys Projekt. Aber auch dieser Vorschlag blieb auf dem Papier.
Dagegen ist seine Münze (1798—1800) das erste ausgeführte Werk
des revolutionären Stils, ein Bau von hohem künstlerischem Wert.
Durch ein rustiziertes Erdgeschoß mit breitrechteckigen Fenster-
einschnitten, durch ein kantig vorspringendes Mittelrisalit und die
weiten Mauerflächen der beiden Obergeschosse, durch das flache
Dach und vor allem durch den gleich einem Stahlband das Gebäude
umklammernden breiten Friesstreifen gibt er dem Bau einen „star-
ken, soliden, festen und doch reichen Charakter“.
Diese Worte stammen aus dem am Eingang dieses Kapitels zitier-
ten Aufsatz, in dem Gentz das gedankenlose Kopieren vergangener
Kunstformen ablehnt. Aber darüber hinaus ist diese Stelle noch von
besonderer Bedeutung deshalb, weil in ihr die Ahnung von der Gefahr
aufklingt, die diesem Stil droht — die Gefahr, daß eine wesentlich
auf die formale Neugestaltung eingestellte Baukunst durch weniger
begabte und weniger verantwortungsvolle Künstler und durch die
kritiklose Bewunderung des Laienpublikums in einem Formalismus
enden könnte. Die ernsthaften Künstler, zu denen Gilly und Gentz
sicher gehören, erfinden die ungewohnten Formen nicht nur des
Ungewohnten wegen. Gewiß weisen auch ihre Werke stets Züge