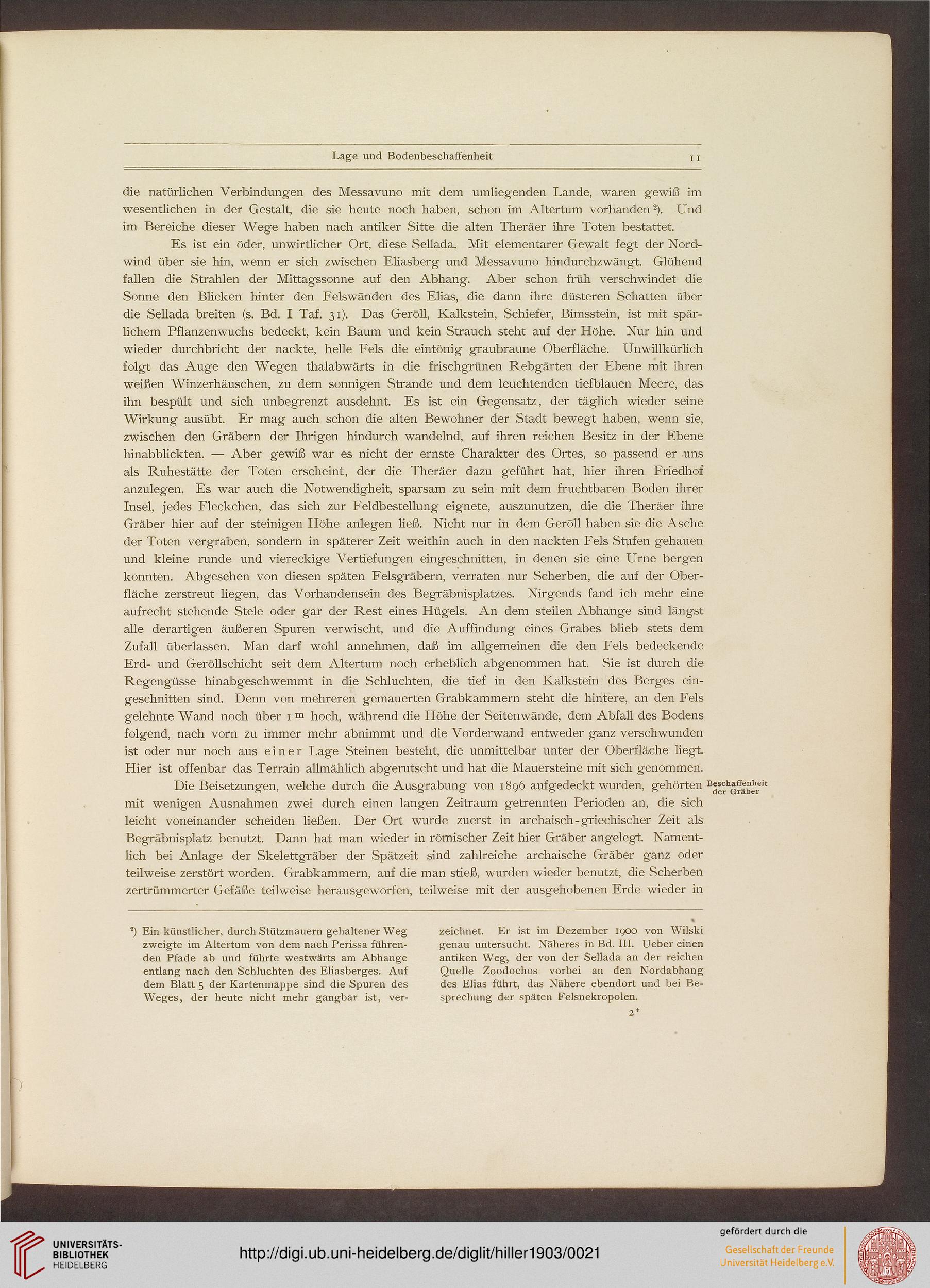Lage und Bodenbeschaffenheit
die natürlichen Verbindungen des Messavuno mit dem umliegenden Lande, waren gewiß im
wesentlichen in der Gestalt, die sie heute noch haben, schon im Altertum vorhanden2). Und
im Bereiche dieser Wege haben nach antiker Sitte die alten Theräer ihre Toten bestattet.
Es ist ein öder, unwirtlicher Ort, diese Seilada. Mit elementarer Gewalt fegt der Nord-
wind über sie hin, wenn er sich zwischen Eliasberg und Messavuno hindurchzwängt. Glühend
fallen die Strahlen der Mittagssonne auf den Abhang. Aber schon früh verschwindet die
Sonne den Blicken hinter den Felswänden des Elias, die dann ihre düsteren Schatten über
die Sellada breiten (s. Bd. I Taf. 31). Das Geröll, Kalkstein, Schiefer, Bimsstein, ist mit spär-
lichem Pflanzenwuchs bedeckt, kein Baum und kein Strauch steht auf der Höhe. Nur hin und
wieder durchbricht der nackte, helle Fels die eintönig graubraune Oberfläche. Unwillkürlich
folgt das Auge den Wegen thalabwärts in die frischgrünen Rebgärten der Ebene mit ihren
weißen Winzerhäuschen, zu dem sonnigen Strande und dem leuchtenden tiefblauen Meere, das
ihn bespült und sich unbegrenzt ausdehnt. Es ist ein Gegensatz, der täglich wieder seine
Wirkung ausübt. Er mag auch schon die alten Bewohner der Stadt bewegt haben, wenn sie,
zwischen den Gräbern der Ihrigen hindurch wandelnd, auf ihren reichen Besitz in der Ebene
hinabblickten. — Aber gewiß war es nicht der ernste Charakter des Ortes, so passend er uns
als Ruhestätte der Toten erscheint, der die Theräer dazu geführt hat, hier ihren Friedhof
anzulegen. Es war auch die Notwendigheit, sparsam zu sein mit dem fruchtbaren Boden ihrer
Insel, jedes Fleckchen, das sich zur Feldbestellung eignete, auszunutzen, die die Theräer ihre
Gräber hier auf der steinigen Höhe anlegen ließ. Nicht nur in dem Geröll haben sie die Asche
der Toten vergraben, sondern in späterer Zeit weithin auch in den nackten Fels Stufen gehauen
und kleine runde und viereckige Vertiefungen eingeschnitten, in denen sie eine Urne bergen
konnten. Abgesehen von diesen späten Felsgräbern, verraten nur Scherben, die auf der Ober-
fläche zerstreut liegen, das Vorhandensein des Begräbnisplatzes. Nirgends fand ich mehr eine
aufrecht stehende Stele oder gar der Rest eines Hügels. An dem steilen Abhänge sind längst
alle derartigen äußeren Spuren verwischt, und die Auffindung eines Grabes blieb stets dem
Zufall überlassen. Man darf wohl annehmen, daß im allgemeinen die den Fels bedeckende
Erd- und Geröllschicht seit dem Altertum noch erheblich abgenommen hat. Sie ist durch die
Regengüsse hinabgeschwemmt in die Schluchten, die tief in den Kalkstein des Berges ein-
geschnitten sind. Denn von mehreren gemauerten Grabkammern steht die hintere, an den Fels
gelehnte Wand noch über 1 m hoch, während die Höhe der Seitenwände, dem Abfall des Bodens
folgend, nach vorn zu immer mehr abnimmt und die Vorderwand entweder ganz verschwunden
ist oder nur noch aus einer Lage Steinen besteht, die unmittelbar unter der Oberfläche liegt.
Hier ist offenbar das Terrain allmählich abgerutscht und hat die Mauersteine mit sich genommen.
Die Beisetzungen, welche durch die Ausgrabung von 1896 aufgedeckt wurden, gehörten Beschaffenheit
mit wenigen Ausnahmen zwei durch einen langen Zeitraum getrennten Perioden an, die sich
leicht voneinander scheiden ließen. Der Ort wurde zuerst in archaisch-griechischer Zeit als
Begräbnisplatz benutzt. Dann hat man wieder in römischer Zeit hier Gräber angelegt. Nament-
lich bei Anlage der Skelettgräber der Spätzeit sind zahlreiche archaische Gräber ganz oder
teilweise zerstört worden. Grabkammern, auf die man stieß, wurden wieder benutzt, die Scherben
zertrümmerter Gefäße teilweise herausgeworfen, teilweise mit der ausgehobenen Erde wieder in
2) Ein künstlicher, durch Stützmauern gehaltener Weg
zweigte im Altertum von dem nach Perissa führen-
den Pfade ab und führte westwärts am Abhänge
entlang nach den Schluchten des Eliasberges. Auf
dem Blatt 5 der Kartenmappe sind die Spuren des
Weges, der heute nicht mehr gangbar ist, ver-
zeichnet. Er ist im Dezember 1900 von Wilski
genau untersucht. Näheres in Bd. III. Ueber einen
antiken Weg, der von der Sellada an der reichen
Quelle Zoodochos vorbei an den Nordabhang
des Elias führt, das Nähere ebendort und bei Be-
sprechung der späten Felsnekropolen.
die natürlichen Verbindungen des Messavuno mit dem umliegenden Lande, waren gewiß im
wesentlichen in der Gestalt, die sie heute noch haben, schon im Altertum vorhanden2). Und
im Bereiche dieser Wege haben nach antiker Sitte die alten Theräer ihre Toten bestattet.
Es ist ein öder, unwirtlicher Ort, diese Seilada. Mit elementarer Gewalt fegt der Nord-
wind über sie hin, wenn er sich zwischen Eliasberg und Messavuno hindurchzwängt. Glühend
fallen die Strahlen der Mittagssonne auf den Abhang. Aber schon früh verschwindet die
Sonne den Blicken hinter den Felswänden des Elias, die dann ihre düsteren Schatten über
die Sellada breiten (s. Bd. I Taf. 31). Das Geröll, Kalkstein, Schiefer, Bimsstein, ist mit spär-
lichem Pflanzenwuchs bedeckt, kein Baum und kein Strauch steht auf der Höhe. Nur hin und
wieder durchbricht der nackte, helle Fels die eintönig graubraune Oberfläche. Unwillkürlich
folgt das Auge den Wegen thalabwärts in die frischgrünen Rebgärten der Ebene mit ihren
weißen Winzerhäuschen, zu dem sonnigen Strande und dem leuchtenden tiefblauen Meere, das
ihn bespült und sich unbegrenzt ausdehnt. Es ist ein Gegensatz, der täglich wieder seine
Wirkung ausübt. Er mag auch schon die alten Bewohner der Stadt bewegt haben, wenn sie,
zwischen den Gräbern der Ihrigen hindurch wandelnd, auf ihren reichen Besitz in der Ebene
hinabblickten. — Aber gewiß war es nicht der ernste Charakter des Ortes, so passend er uns
als Ruhestätte der Toten erscheint, der die Theräer dazu geführt hat, hier ihren Friedhof
anzulegen. Es war auch die Notwendigheit, sparsam zu sein mit dem fruchtbaren Boden ihrer
Insel, jedes Fleckchen, das sich zur Feldbestellung eignete, auszunutzen, die die Theräer ihre
Gräber hier auf der steinigen Höhe anlegen ließ. Nicht nur in dem Geröll haben sie die Asche
der Toten vergraben, sondern in späterer Zeit weithin auch in den nackten Fels Stufen gehauen
und kleine runde und viereckige Vertiefungen eingeschnitten, in denen sie eine Urne bergen
konnten. Abgesehen von diesen späten Felsgräbern, verraten nur Scherben, die auf der Ober-
fläche zerstreut liegen, das Vorhandensein des Begräbnisplatzes. Nirgends fand ich mehr eine
aufrecht stehende Stele oder gar der Rest eines Hügels. An dem steilen Abhänge sind längst
alle derartigen äußeren Spuren verwischt, und die Auffindung eines Grabes blieb stets dem
Zufall überlassen. Man darf wohl annehmen, daß im allgemeinen die den Fels bedeckende
Erd- und Geröllschicht seit dem Altertum noch erheblich abgenommen hat. Sie ist durch die
Regengüsse hinabgeschwemmt in die Schluchten, die tief in den Kalkstein des Berges ein-
geschnitten sind. Denn von mehreren gemauerten Grabkammern steht die hintere, an den Fels
gelehnte Wand noch über 1 m hoch, während die Höhe der Seitenwände, dem Abfall des Bodens
folgend, nach vorn zu immer mehr abnimmt und die Vorderwand entweder ganz verschwunden
ist oder nur noch aus einer Lage Steinen besteht, die unmittelbar unter der Oberfläche liegt.
Hier ist offenbar das Terrain allmählich abgerutscht und hat die Mauersteine mit sich genommen.
Die Beisetzungen, welche durch die Ausgrabung von 1896 aufgedeckt wurden, gehörten Beschaffenheit
mit wenigen Ausnahmen zwei durch einen langen Zeitraum getrennten Perioden an, die sich
leicht voneinander scheiden ließen. Der Ort wurde zuerst in archaisch-griechischer Zeit als
Begräbnisplatz benutzt. Dann hat man wieder in römischer Zeit hier Gräber angelegt. Nament-
lich bei Anlage der Skelettgräber der Spätzeit sind zahlreiche archaische Gräber ganz oder
teilweise zerstört worden. Grabkammern, auf die man stieß, wurden wieder benutzt, die Scherben
zertrümmerter Gefäße teilweise herausgeworfen, teilweise mit der ausgehobenen Erde wieder in
2) Ein künstlicher, durch Stützmauern gehaltener Weg
zweigte im Altertum von dem nach Perissa führen-
den Pfade ab und führte westwärts am Abhänge
entlang nach den Schluchten des Eliasberges. Auf
dem Blatt 5 der Kartenmappe sind die Spuren des
Weges, der heute nicht mehr gangbar ist, ver-
zeichnet. Er ist im Dezember 1900 von Wilski
genau untersucht. Näheres in Bd. III. Ueber einen
antiken Weg, der von der Sellada an der reichen
Quelle Zoodochos vorbei an den Nordabhang
des Elias führt, das Nähere ebendort und bei Be-
sprechung der späten Felsnekropolen.