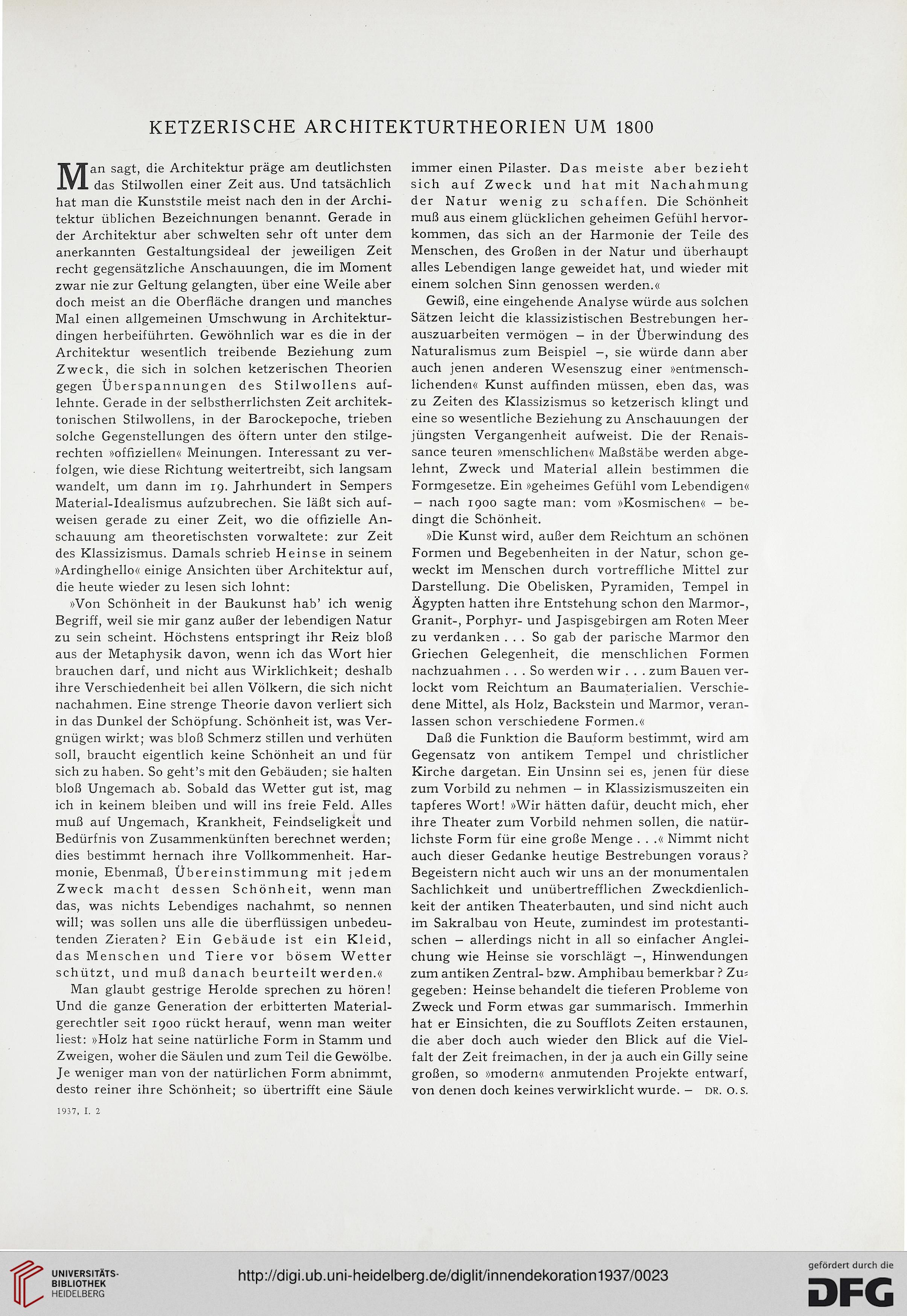KETZERISCHE ARCHITEKTURTHEORIEN UM 1800
Man sagt, die Architektur präge am deutlichsten
das Stilwollen einer Zeit aus. Und tatsächlich
hat man die Kunststile meist nach den in der Archi-
tektur üblichen Bezeichnungen benannt. Gerade in
der Architektur aber schwelten sehr oft unter dem
anerkannten Gestaltungsideal der jeweiligen Zeit
recht gegensätzliche Anschauungen, die im Moment
zwar nie zur Geltung gelangten, über eine Weile aber
doch meist an die Oberfläche drangen und manches
Mal einen allgemeinen Umschwung in Architektur-
dingen herbeiführten. Gewöhnlich war es die in der
Architektur wesentlich treibende Beziehung zum
Zweck, die sich in solchen ketzerischen Theorien
gegen Überspannungen des Stilwollens auf-
lehnte. Gerade in der selbstherrlichsten Zeit architek-
tonischen Stilwollens, in der Barockepoche, trieben
solche Gegenstellungen des öftern unter den stilge-
rechten »offiziellen« Meinungen. Interessant zu ver-
folgen, wie diese Richtung weitertreibt, sich langsam
wandelt, um dann im 19. Jahrhundert in Sempers
Material-Idealismus aufzubrechen. Sie läßt sich auf-
weisen gerade zu einer Zeit, wo die offizielle An-
schauung am theoretischsten vorwaltete: zur Zeit
des Klassizismus. Damals schrieb Heinse in seinem
»Ardinghello« einige Ansichten über Architektur auf,
die heute wieder zu lesen sich lohnt:
»Von Schönheit in der Baukunst hab' ich wenig
Begriff, weil sie mir ganz außer der lebendigen Natur
zu sein scheint. Höchstens entspringt ihr Reiz bloß
aus der Metaphysik davon, wenn ich das Wort hier
brauchen darf, und nicht aus Wirklichkeit; deshalb
ihre Verschiedenheit bei allen Völkern, die sich nicht
nachahmen. Eine strenge Theorie davon verliert sich
in das Dunkel der Schöpfung. Schönheit ist, was Ver-
gnügen wirkt; was bloß Schmerz stillen und verhüten
soll, braucht eigentlich keine Schönheit an und für
sich zu haben. So geht's mit den Gebäuden; sie halten
bloß Ungemach ab. Sobald das Wetter gut ist, mag
ich in keinem bleiben und will ins freie Feld. Alles
muß auf Ungemach, Krankheit, Feindseligkeit und
Bedürfnis von Zusammenkünften berechnet werden;
dies bestimmt hernach ihre Vollkommenheit. Har-
monie, Ebenmaß, Übereinstimmung mit jedem
Zweck macht dessen Schönheit, wenn man
das, was nichts Lebendiges nachahmt, so nennen
will; was sollen uns alle die überflüssigen unbedeu-
tenden Zieraten? Ein Gebäude ist ein Kleid,
das Menschen und Tiere vor bösem Wetter
schützt, und muß danach beurteilt werden.«
Man glaubt gestrige Herolde sprechen zu hören!
Und die ganze Generation der erbitterten Material-
gerechtler seit 1900 rückt herauf, wenn man weiter
liest: »Holz hat seine natürliche Form in Stamm und
Zweigen, woher die Säulen und zum Teil die Gewölbe.
Je weniger man von der natürlichen Form abnimmt,
desto reiner ihre Schönheit; so übertrifft eine Säule
1937, I. 2
immer einen Pilaster. Das meiste aber bezieht
sich auf Zweck und hat mit Nachahmung
der Natur wenig zu schaffen. Die Schönheit
muß aus einem glücklichen geheimen Gefühl hervor-
kommen, das sich an der Harmonie der Teile des
Menschen, des Großen in der Natur und überhaupt
alles Lebendigen lange geweidet hat, und wieder mit
einem solchen Sinn genossen werden.«
Gewiß, eine eingehende Analyse würde aus solchen
Sätzen leicht die klassizistischen Bestrebungen her-
auszuarbeiten vermögen - in der Überwindung des
Naturalismus zum Beispiel -, sie würde dann aber
auch jenen anderen Wesenszug einer »entmensch-
lichenden« Kunst auffinden müssen, eben das, was
zu Zeiten des Klassizismus so ketzerisch klingt und
eine so wesentliche Beziehung zu Anschauungen der
jüngsten Vergangenheit aufweist. Die der Renais-
sance teuren »menschlichen« Maßstäbe werden abge-
lehnt, Zweck und Material allein bestimmen die
Formgesetze. Ein »geheimes Gefühl vom Lebendigen«
— nach 1900 sagte man: vom »Kosmischen« — be-
dingt die Schönheit.
»Die Kunst wird, außer dem Reichtum an schönen
Formen und Begebenheiten in der Natur, schon ge-
weckt im Menschen durch vortreffliche Mittel zur
Darstellung. Die Obelisken, Pyramiden, Tempel in
Ägypten hatten ihre Entstehung schon den Marmor-,
Granit-, Porphyr- und Jaspisgebirgen am Roten Meer
zu verdanken ... So gab der parische Marmor den
Griechen Gelegenheit, die menschlichen Formen
nachzuahmen ... So werden wir . . . zum Bauen ver-
lockt vom Reichtum an Baumaterialien. Verschie-
dene Mittel, als Holz, Backstein und Marmor, veran-
lassen schon verschiedene Formen.«
Daß die Funktion die Bauform bestimmt, wird am
Gegensatz von antikem Tempel und christlicher
Kirche dargetan. Ein Unsinn sei es, jenen für diese
zum Vorbild zu nehmen - in Klassizismuszeiten ein
tapferes Wort! »Wir hätten dafür, deucht mich, eher
ihre Theater zum Vorbild nehmen sollen, die natür-
lichste Form für eine große Menge . . .« Nimmt nicht
auch dieser Gedanke heutige Bestrebungen voraus?
Begeistern nicht auch wir uns an der monumentalen
Sachlichkeit und unübertrefflichen Zweckdienlich-
keit der antiken Theaterbauten, und sind nicht auch
im Sakralbau von Heute, zumindest im protestanti-
schen - allerdings nicht in all so einfacher Anglei-
chung wie Heinse sie vorschlägt -, Hinwendungen
zum antiken Zentral- bzw. Amphibau bemerkbar ? Zu-
gegeben: Heinse behandelt die tieferen Probleme von
Zweck und Form etwas gar summarisch. Immerhin
hat er Einsichten, die zu Soufflots Zeiten erstaunen,
die aber doch auch wieder den Blick auf die Viel-
falt der Zeit freimachen, in der ja auch ein Gilly seine
großen, so »modern« anmutenden Projekte entwarf,
von denen doch keines verwirklicht wurde. — DR. o.s.
Man sagt, die Architektur präge am deutlichsten
das Stilwollen einer Zeit aus. Und tatsächlich
hat man die Kunststile meist nach den in der Archi-
tektur üblichen Bezeichnungen benannt. Gerade in
der Architektur aber schwelten sehr oft unter dem
anerkannten Gestaltungsideal der jeweiligen Zeit
recht gegensätzliche Anschauungen, die im Moment
zwar nie zur Geltung gelangten, über eine Weile aber
doch meist an die Oberfläche drangen und manches
Mal einen allgemeinen Umschwung in Architektur-
dingen herbeiführten. Gewöhnlich war es die in der
Architektur wesentlich treibende Beziehung zum
Zweck, die sich in solchen ketzerischen Theorien
gegen Überspannungen des Stilwollens auf-
lehnte. Gerade in der selbstherrlichsten Zeit architek-
tonischen Stilwollens, in der Barockepoche, trieben
solche Gegenstellungen des öftern unter den stilge-
rechten »offiziellen« Meinungen. Interessant zu ver-
folgen, wie diese Richtung weitertreibt, sich langsam
wandelt, um dann im 19. Jahrhundert in Sempers
Material-Idealismus aufzubrechen. Sie läßt sich auf-
weisen gerade zu einer Zeit, wo die offizielle An-
schauung am theoretischsten vorwaltete: zur Zeit
des Klassizismus. Damals schrieb Heinse in seinem
»Ardinghello« einige Ansichten über Architektur auf,
die heute wieder zu lesen sich lohnt:
»Von Schönheit in der Baukunst hab' ich wenig
Begriff, weil sie mir ganz außer der lebendigen Natur
zu sein scheint. Höchstens entspringt ihr Reiz bloß
aus der Metaphysik davon, wenn ich das Wort hier
brauchen darf, und nicht aus Wirklichkeit; deshalb
ihre Verschiedenheit bei allen Völkern, die sich nicht
nachahmen. Eine strenge Theorie davon verliert sich
in das Dunkel der Schöpfung. Schönheit ist, was Ver-
gnügen wirkt; was bloß Schmerz stillen und verhüten
soll, braucht eigentlich keine Schönheit an und für
sich zu haben. So geht's mit den Gebäuden; sie halten
bloß Ungemach ab. Sobald das Wetter gut ist, mag
ich in keinem bleiben und will ins freie Feld. Alles
muß auf Ungemach, Krankheit, Feindseligkeit und
Bedürfnis von Zusammenkünften berechnet werden;
dies bestimmt hernach ihre Vollkommenheit. Har-
monie, Ebenmaß, Übereinstimmung mit jedem
Zweck macht dessen Schönheit, wenn man
das, was nichts Lebendiges nachahmt, so nennen
will; was sollen uns alle die überflüssigen unbedeu-
tenden Zieraten? Ein Gebäude ist ein Kleid,
das Menschen und Tiere vor bösem Wetter
schützt, und muß danach beurteilt werden.«
Man glaubt gestrige Herolde sprechen zu hören!
Und die ganze Generation der erbitterten Material-
gerechtler seit 1900 rückt herauf, wenn man weiter
liest: »Holz hat seine natürliche Form in Stamm und
Zweigen, woher die Säulen und zum Teil die Gewölbe.
Je weniger man von der natürlichen Form abnimmt,
desto reiner ihre Schönheit; so übertrifft eine Säule
1937, I. 2
immer einen Pilaster. Das meiste aber bezieht
sich auf Zweck und hat mit Nachahmung
der Natur wenig zu schaffen. Die Schönheit
muß aus einem glücklichen geheimen Gefühl hervor-
kommen, das sich an der Harmonie der Teile des
Menschen, des Großen in der Natur und überhaupt
alles Lebendigen lange geweidet hat, und wieder mit
einem solchen Sinn genossen werden.«
Gewiß, eine eingehende Analyse würde aus solchen
Sätzen leicht die klassizistischen Bestrebungen her-
auszuarbeiten vermögen - in der Überwindung des
Naturalismus zum Beispiel -, sie würde dann aber
auch jenen anderen Wesenszug einer »entmensch-
lichenden« Kunst auffinden müssen, eben das, was
zu Zeiten des Klassizismus so ketzerisch klingt und
eine so wesentliche Beziehung zu Anschauungen der
jüngsten Vergangenheit aufweist. Die der Renais-
sance teuren »menschlichen« Maßstäbe werden abge-
lehnt, Zweck und Material allein bestimmen die
Formgesetze. Ein »geheimes Gefühl vom Lebendigen«
— nach 1900 sagte man: vom »Kosmischen« — be-
dingt die Schönheit.
»Die Kunst wird, außer dem Reichtum an schönen
Formen und Begebenheiten in der Natur, schon ge-
weckt im Menschen durch vortreffliche Mittel zur
Darstellung. Die Obelisken, Pyramiden, Tempel in
Ägypten hatten ihre Entstehung schon den Marmor-,
Granit-, Porphyr- und Jaspisgebirgen am Roten Meer
zu verdanken ... So gab der parische Marmor den
Griechen Gelegenheit, die menschlichen Formen
nachzuahmen ... So werden wir . . . zum Bauen ver-
lockt vom Reichtum an Baumaterialien. Verschie-
dene Mittel, als Holz, Backstein und Marmor, veran-
lassen schon verschiedene Formen.«
Daß die Funktion die Bauform bestimmt, wird am
Gegensatz von antikem Tempel und christlicher
Kirche dargetan. Ein Unsinn sei es, jenen für diese
zum Vorbild zu nehmen - in Klassizismuszeiten ein
tapferes Wort! »Wir hätten dafür, deucht mich, eher
ihre Theater zum Vorbild nehmen sollen, die natür-
lichste Form für eine große Menge . . .« Nimmt nicht
auch dieser Gedanke heutige Bestrebungen voraus?
Begeistern nicht auch wir uns an der monumentalen
Sachlichkeit und unübertrefflichen Zweckdienlich-
keit der antiken Theaterbauten, und sind nicht auch
im Sakralbau von Heute, zumindest im protestanti-
schen - allerdings nicht in all so einfacher Anglei-
chung wie Heinse sie vorschlägt -, Hinwendungen
zum antiken Zentral- bzw. Amphibau bemerkbar ? Zu-
gegeben: Heinse behandelt die tieferen Probleme von
Zweck und Form etwas gar summarisch. Immerhin
hat er Einsichten, die zu Soufflots Zeiten erstaunen,
die aber doch auch wieder den Blick auf die Viel-
falt der Zeit freimachen, in der ja auch ein Gilly seine
großen, so »modern« anmutenden Projekte entwarf,
von denen doch keines verwirklicht wurde. — DR. o.s.