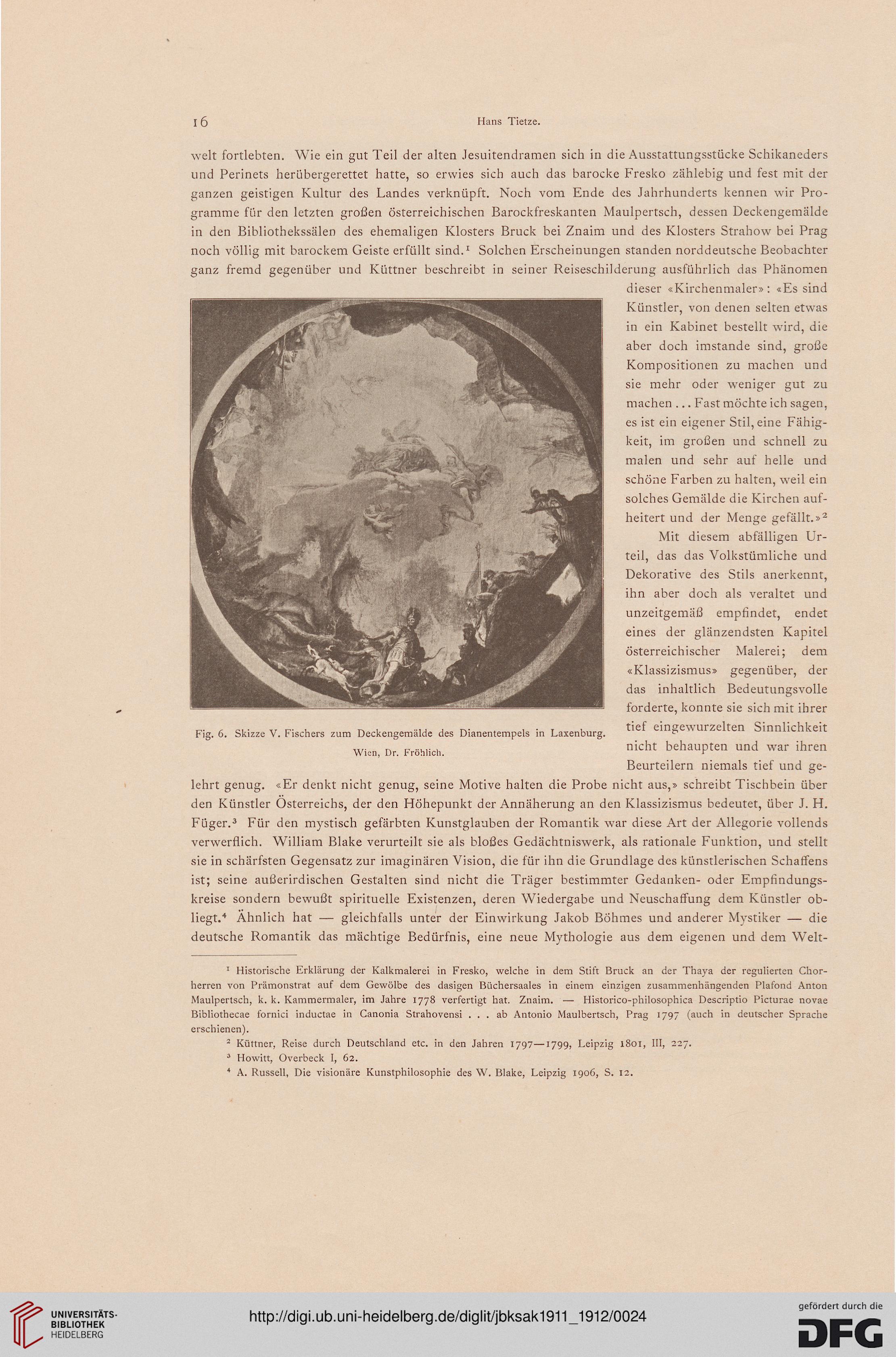[6
Hans Tietze.
weit fortlebten. Wie ein gut Teil der alten Jesuitendramen sich in die Ausstattungsstücke Schikaneders
und Perinets herübergerettet hatte, so erwies sich auch das barocke Fresko zählebig und fest mit der
ganzen geistigen Kultur des Landes verknüpft. Noch vom Ende des Jahrhunderts kennen wir Pro-
gramme für den letzten großen österreichischen Barockfreskanten Maulpertsch, dessen Deckengemälde
in den Bibliothekssälen des ehemaligen Klosters Bruck bei Znaim und des Klosters Strahow bei Prag
noch völlig mit barockem Geiste erfüllt sind.1 Solchen Erscheinungen standen norddeutsche Beobachter
ganz fremd gegenüber und Küttner beschreibt in seiner Reiseschilderung ausführlich das Phänomen
dieser «Kirchenmaler»: «Es sind
Künstler, von denen selten etwas
in ein Kabinet bestellt wird, die
aber doch imstande sind, große
Kompositionen zu machen und
sie mehr oder weniger gut zu
machen ... Fast möchte ich sagen,
es ist ein eigener Stil, eine Fähig-
keit, im großen und schnell zu
malen und sehr auf helle und
schöne Farben zu halten, weil ein
solches Gemälde die Kirchen auf-
heitert und der Menge gefällt.»2
Mit diesem abfälligen Ur-
teil, das das Volkstümliche und
Dekorative des Stils anerkennt,
ihn aber doch als veraltet und
unzeitgemäß empfindet, endet
eines der glänzendsten Kapitel
österreichischer Malerei; dem
«Klassizismus» gegenüber, der
das inhaltlich Bedeutungsvolle
forderte, konnte sie sich mit ihrer
tief eingewurzelten Sinnlichkeit
nicht behaupten und war ihren
Beurteilern niemals tief und ge-
lehrt genug. «Er denkt nicht genug, seine Motive halten die Probe nicht aus,» schreibt Tischbein über
den Künstler Österreichs, der den Höhepunkt der Annäherung an den Klassizismus bedeutet, über J. H.
Füger.3 Für den mystisch gefärbten Kunstglauben der Romantik war diese Art der Allegorie vollends
verwerflich. William Blake verurteilt sie als bloßes Gedächtniswerk, als rationale Funktion, und stellt
sie in schärfsten Gegensatz zur imaginären Vision, die für ihn die Grundlage des künstlerischen Schaffens
ist; seine außerirdischen Gestalten sind nicht die Träger bestimmter Gedanken- oder Empfindungs-
kreise sondern bewußt spirituelle Existenzen, deren Wiedergabe und Neuschaffung dem Künstler ob-
liegt.4 Ahnlich hat — gleichfalls unter der Einwirkung Jakob Böhmes und anderer Mystiker — die
deutsche Romantik das mächtige Bedürfnis, eine neue Mythologie aus dem eigenen und dem Welt-
Fig. 6. Skizze V. Fischers zum Deckengemälde des Dianentempels in Laxenburg.
Wien, Dr. Fröhlich.
1 Historische Erklärung der Kalkmalerei in Fresko, welche in dem Stift Bruck an der Thaya der regulierten Chor-
herren von Prämonstrat auf dem Gewölbe des dasigen Büchersaales in einem einzigen zusammenhängenden Plafond Anton
Maulpertsch, k. k. Kammermaler, im Jahre 1778 verfertigt hat. Znaim. — Historico-philosophica Descriptio Picturae novae
Bibliothecae fornici inductae in Canonia Strahovensi ... ab Antonio Maulbertsch, Prag 1797 (auch in deutscher Sprache
erschienen).
2 Küttner, Reise durch Deutschland etc. in den Jahren 1797—1799, Leipzig 1801, III, 227.
3 Howitt, Overbeck I, 62.
* A. Russell, Die visionäre Kunstphilosophie des W. Blake, Leipzig 1906, S. 12.
Hans Tietze.
weit fortlebten. Wie ein gut Teil der alten Jesuitendramen sich in die Ausstattungsstücke Schikaneders
und Perinets herübergerettet hatte, so erwies sich auch das barocke Fresko zählebig und fest mit der
ganzen geistigen Kultur des Landes verknüpft. Noch vom Ende des Jahrhunderts kennen wir Pro-
gramme für den letzten großen österreichischen Barockfreskanten Maulpertsch, dessen Deckengemälde
in den Bibliothekssälen des ehemaligen Klosters Bruck bei Znaim und des Klosters Strahow bei Prag
noch völlig mit barockem Geiste erfüllt sind.1 Solchen Erscheinungen standen norddeutsche Beobachter
ganz fremd gegenüber und Küttner beschreibt in seiner Reiseschilderung ausführlich das Phänomen
dieser «Kirchenmaler»: «Es sind
Künstler, von denen selten etwas
in ein Kabinet bestellt wird, die
aber doch imstande sind, große
Kompositionen zu machen und
sie mehr oder weniger gut zu
machen ... Fast möchte ich sagen,
es ist ein eigener Stil, eine Fähig-
keit, im großen und schnell zu
malen und sehr auf helle und
schöne Farben zu halten, weil ein
solches Gemälde die Kirchen auf-
heitert und der Menge gefällt.»2
Mit diesem abfälligen Ur-
teil, das das Volkstümliche und
Dekorative des Stils anerkennt,
ihn aber doch als veraltet und
unzeitgemäß empfindet, endet
eines der glänzendsten Kapitel
österreichischer Malerei; dem
«Klassizismus» gegenüber, der
das inhaltlich Bedeutungsvolle
forderte, konnte sie sich mit ihrer
tief eingewurzelten Sinnlichkeit
nicht behaupten und war ihren
Beurteilern niemals tief und ge-
lehrt genug. «Er denkt nicht genug, seine Motive halten die Probe nicht aus,» schreibt Tischbein über
den Künstler Österreichs, der den Höhepunkt der Annäherung an den Klassizismus bedeutet, über J. H.
Füger.3 Für den mystisch gefärbten Kunstglauben der Romantik war diese Art der Allegorie vollends
verwerflich. William Blake verurteilt sie als bloßes Gedächtniswerk, als rationale Funktion, und stellt
sie in schärfsten Gegensatz zur imaginären Vision, die für ihn die Grundlage des künstlerischen Schaffens
ist; seine außerirdischen Gestalten sind nicht die Träger bestimmter Gedanken- oder Empfindungs-
kreise sondern bewußt spirituelle Existenzen, deren Wiedergabe und Neuschaffung dem Künstler ob-
liegt.4 Ahnlich hat — gleichfalls unter der Einwirkung Jakob Böhmes und anderer Mystiker — die
deutsche Romantik das mächtige Bedürfnis, eine neue Mythologie aus dem eigenen und dem Welt-
Fig. 6. Skizze V. Fischers zum Deckengemälde des Dianentempels in Laxenburg.
Wien, Dr. Fröhlich.
1 Historische Erklärung der Kalkmalerei in Fresko, welche in dem Stift Bruck an der Thaya der regulierten Chor-
herren von Prämonstrat auf dem Gewölbe des dasigen Büchersaales in einem einzigen zusammenhängenden Plafond Anton
Maulpertsch, k. k. Kammermaler, im Jahre 1778 verfertigt hat. Znaim. — Historico-philosophica Descriptio Picturae novae
Bibliothecae fornici inductae in Canonia Strahovensi ... ab Antonio Maulbertsch, Prag 1797 (auch in deutscher Sprache
erschienen).
2 Küttner, Reise durch Deutschland etc. in den Jahren 1797—1799, Leipzig 1801, III, 227.
3 Howitt, Overbeck I, 62.
* A. Russell, Die visionäre Kunstphilosophie des W. Blake, Leipzig 1906, S. 12.