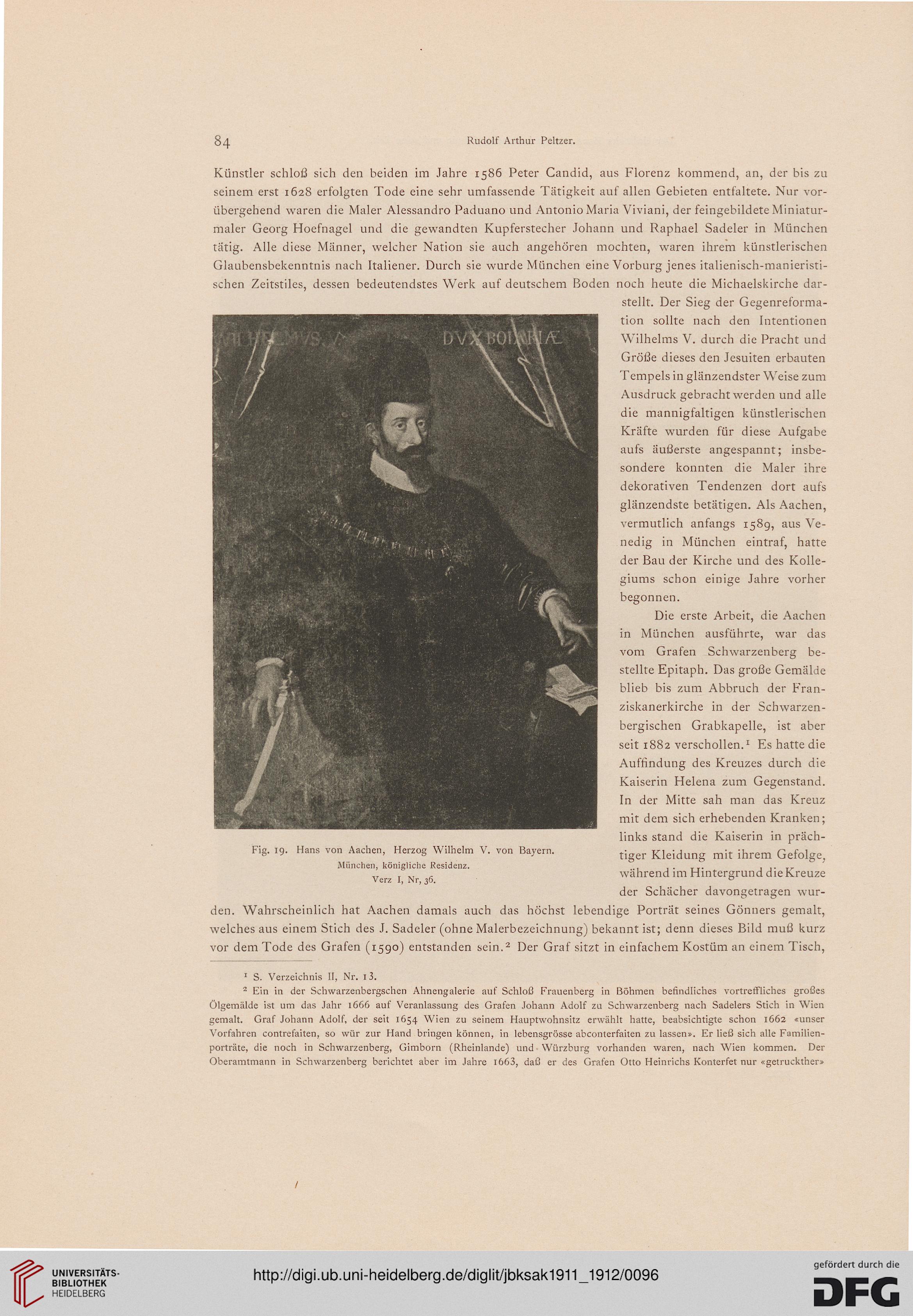84
Rudolf Arthur Peltzer.
Künstler schloß sich den beiden im Jahre 1586 Peter Candid, aus Florenz kommend, an, der bis zu
seinem erst 1628 erfolgten Tode eine sehr umfassende Tätigkeit auf allen Gebieten entfaltete. Nur vor-
übergehend waren die Maler Alessandro Paduano und Antonio Maria Viviani, der feingebildete Miniatur-
maler Georg Hoefnagel und die gewandten Kupferstecher Johann und Raphael Sadeler in München
tätig. Alle diese Männer, welcher Nation sie auch angehören mochten, waren ihrem künstlerischen
Glaubensbekenntnis nach Italiener. Durch sie wurde München eine Vorburg jenes italienisch-manieristi-
schen Zeitstiles, dessen bedeutendstes Werk auf deutschem Boden noch heute die Michaelskirche dar-
stellt. Der Sieg der Gegenreforma-
tion sollte nach den Intentionen
Wilhelms V. durch die Pracht und
Größe dieses den Jesuiten erbauten
Tempels in glänzendster Weise zum
Ausdruck gebracht werden und alle
die mannigfaltigen künstlerischen
Kräfte wurden für diese Aufgabe
aufs äußerste angespannt; insbe-
sondere konnten die Maler ihre
dekorativen Tendenzen dort aufs
glänzendste betätigen. Als Aachen,
vermutlich anfangs 158g, aus Ve-
nedig in München eintraf, hatte
der Bau der Kirche und des Kolle-
giums schon einige Jahre vorher
begonnen.
Die erste Arbeit, die Aachen
in München ausführte, war das
vom Grafen Schwarzenberg be-
stellte Epitaph. Das große Gemälde
blieb bis zum Abbruch der Fran-
ziskanerkirche in der Schwarzen-
bergischen Grabkapelle, ist aber
seit 1882 verschollen.1 Es hatte die
Auffindung des Kreuzes durch die
Kaiserin Helena zum Gegenstand.
In der Mitte sah man das Kreuz
mit dem sich erhebenden Kranken;
links stand die Kaiserin in präch-
Fig. 19. Hans von Aachen, Herzog Wilhelm V. von Bayern. tiggr Kleidung mit ihrem Gefolge,
München, königliche Residenz. TT. . Tr
, „ , während im Hintergrund die Kreuze
Verz I, Nr, 36. 0
der Schächer davongetragen wur-
den. Wahrscheinlich hat Aachen damals auch das höchst lebendige Porträt seines Gönners gemalt,
welches aus einem Stich des J. Sadeler (ohne Malerbezeichnung) bekannt ist; denn dieses Bild muß kurz
vor dem Tode des Grafen (1590) entstanden sein.2 Der Graf sitzt in einfachem Kostüm an einem Tisch,
1 S. Verzeichnis II, Nr. 13.
2 Ein in der Schwarzenbergschen Ahnengalerie auf Schloß Frauenberg in Böhmen befindliches vortreffliches großes
Ölgemälde ist um das Jahr 1666 auf Veranlassung des Grafen Johann Adolf zu Schwarzenberg nach Sadelers Stich in Wien
gemalt. Graf Johann Adolf, der seit 1654 Wien zu seinem Hauptwohnsitz erwählt hatte, beabsichtigte schon 1662 «unser
Vorfahren contrefaiten, so wür zur Hand bringen können, in lebensgrösse abconterfaiten zu lassen». Er ließ sich alle Familien-
porträte, die noch in Schwarzenberg, Gimborn (Rheinlande) und Würzburg vorhanden waren, nach Wien kommen. Der
Oberamtmann in Schwarzenberg berichtet aber im Jahre 1663, daß er des Grafen Otto Heinrichs Konterfet nur «getruckther»
/
Rudolf Arthur Peltzer.
Künstler schloß sich den beiden im Jahre 1586 Peter Candid, aus Florenz kommend, an, der bis zu
seinem erst 1628 erfolgten Tode eine sehr umfassende Tätigkeit auf allen Gebieten entfaltete. Nur vor-
übergehend waren die Maler Alessandro Paduano und Antonio Maria Viviani, der feingebildete Miniatur-
maler Georg Hoefnagel und die gewandten Kupferstecher Johann und Raphael Sadeler in München
tätig. Alle diese Männer, welcher Nation sie auch angehören mochten, waren ihrem künstlerischen
Glaubensbekenntnis nach Italiener. Durch sie wurde München eine Vorburg jenes italienisch-manieristi-
schen Zeitstiles, dessen bedeutendstes Werk auf deutschem Boden noch heute die Michaelskirche dar-
stellt. Der Sieg der Gegenreforma-
tion sollte nach den Intentionen
Wilhelms V. durch die Pracht und
Größe dieses den Jesuiten erbauten
Tempels in glänzendster Weise zum
Ausdruck gebracht werden und alle
die mannigfaltigen künstlerischen
Kräfte wurden für diese Aufgabe
aufs äußerste angespannt; insbe-
sondere konnten die Maler ihre
dekorativen Tendenzen dort aufs
glänzendste betätigen. Als Aachen,
vermutlich anfangs 158g, aus Ve-
nedig in München eintraf, hatte
der Bau der Kirche und des Kolle-
giums schon einige Jahre vorher
begonnen.
Die erste Arbeit, die Aachen
in München ausführte, war das
vom Grafen Schwarzenberg be-
stellte Epitaph. Das große Gemälde
blieb bis zum Abbruch der Fran-
ziskanerkirche in der Schwarzen-
bergischen Grabkapelle, ist aber
seit 1882 verschollen.1 Es hatte die
Auffindung des Kreuzes durch die
Kaiserin Helena zum Gegenstand.
In der Mitte sah man das Kreuz
mit dem sich erhebenden Kranken;
links stand die Kaiserin in präch-
Fig. 19. Hans von Aachen, Herzog Wilhelm V. von Bayern. tiggr Kleidung mit ihrem Gefolge,
München, königliche Residenz. TT. . Tr
, „ , während im Hintergrund die Kreuze
Verz I, Nr, 36. 0
der Schächer davongetragen wur-
den. Wahrscheinlich hat Aachen damals auch das höchst lebendige Porträt seines Gönners gemalt,
welches aus einem Stich des J. Sadeler (ohne Malerbezeichnung) bekannt ist; denn dieses Bild muß kurz
vor dem Tode des Grafen (1590) entstanden sein.2 Der Graf sitzt in einfachem Kostüm an einem Tisch,
1 S. Verzeichnis II, Nr. 13.
2 Ein in der Schwarzenbergschen Ahnengalerie auf Schloß Frauenberg in Böhmen befindliches vortreffliches großes
Ölgemälde ist um das Jahr 1666 auf Veranlassung des Grafen Johann Adolf zu Schwarzenberg nach Sadelers Stich in Wien
gemalt. Graf Johann Adolf, der seit 1654 Wien zu seinem Hauptwohnsitz erwählt hatte, beabsichtigte schon 1662 «unser
Vorfahren contrefaiten, so wür zur Hand bringen können, in lebensgrösse abconterfaiten zu lassen». Er ließ sich alle Familien-
porträte, die noch in Schwarzenberg, Gimborn (Rheinlande) und Würzburg vorhanden waren, nach Wien kommen. Der
Oberamtmann in Schwarzenberg berichtet aber im Jahre 1663, daß er des Grafen Otto Heinrichs Konterfet nur «getruckther»
/