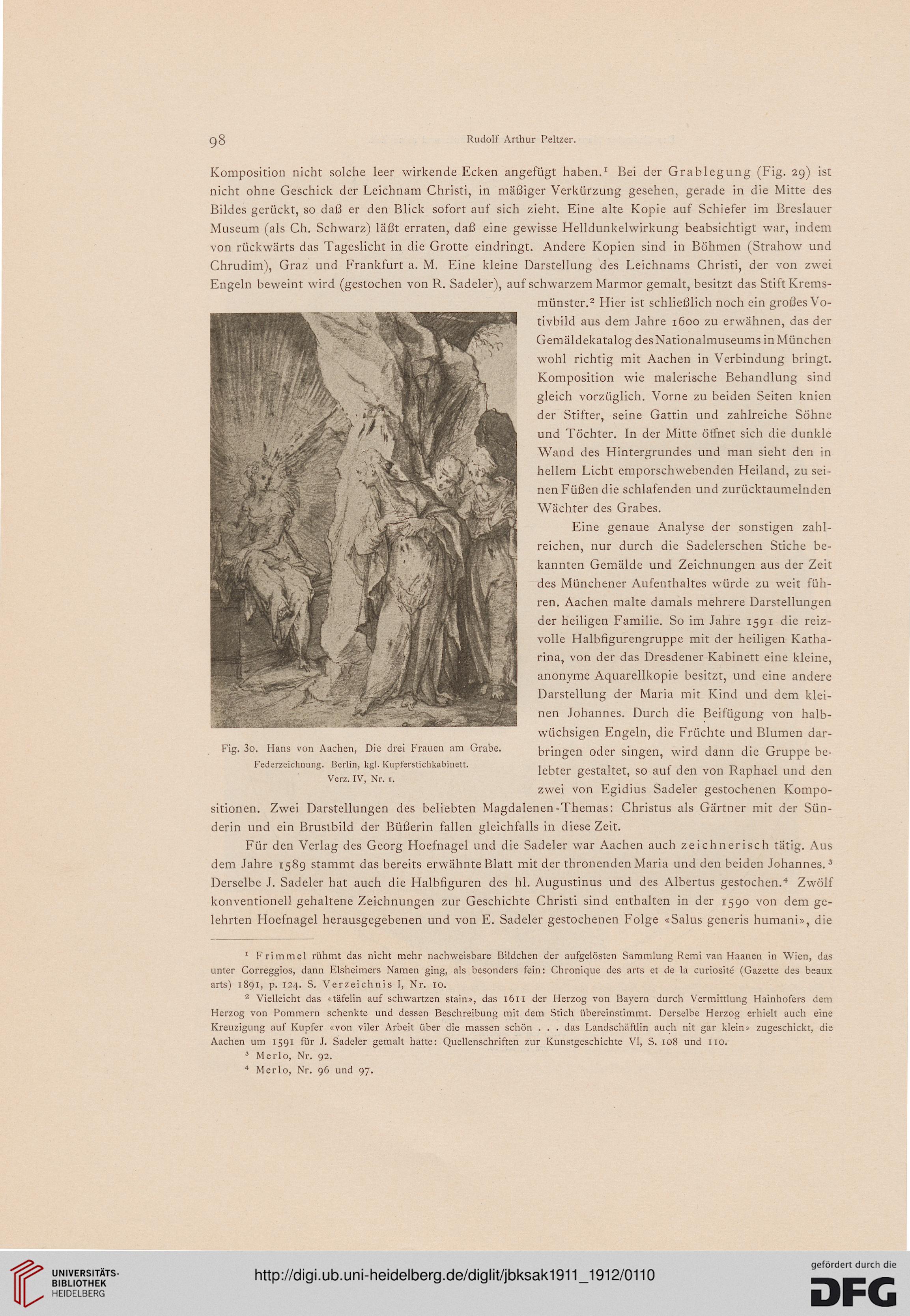98
Rudolf Arthur Peltzer.
Komposition nicht solche leer wirkende Ecken angefügt haben.1 Bei der Grablegung (Fig. 29) ist
nicht ohne Geschick der Leichnam Christi, in mäßiger Verkürzung gesehen, gerade in die Mitte des
Bildes gerückt, so daß er den Blick sofort auf sich zieht. Eine alte Kopie auf Schiefer im Breslauer
Museum (als Ch. Schwarz) läßt erraten, daß eine gewisse Helldunkelwirkung beabsichtigt war, indem
von rückwärts das Tageslicht in die Grotte eindringt. Andere Kopien sind in Böhmen (Strahow und
Chrudim), Graz und Frankfurt a. M. Eine kleine Darstellung des Leichnams Christi, der von zwei
Engeln beweint wird (gestochen von R. Sadeler), auf schwarzem Marmor gemalt, besitzt das Stift Krems-
münster.2 Hier ist schließlich noch ein großes Vo-
tivbild aus dem Jahre 1600 zu erwähnen, das der
Gemäldekatalog des Nationalmuseums in München
wohl richtig mit Aachen in Verbindung bringt.
Komposition wie malerische Behandlung sind
gleich vorzüglich. Vorne zu beiden Seiten knien
der Stifter, seine Gattin und zahlreiche Söhne
und Töchter. In der Mitte öffnet sich die dunkle
Wand des Hintergrundes und man sieht den in
hellem Licht emporschwebenden Heiland, zu sei-
nen Füßen die schlafenden und zurücktaumelnden
Wächter des Grabes.
Eine genaue Analyse der sonstigen zahl-
reichen, nur durch die Sadelerschen Stiche be-
kannten Gemälde und Zeichnungen aus der Zeit
des Münchener Aufenthaltes würde zu weit füh-
ren. Aachen malte damals mehrere Darstellungen
der heiligen Familie. So im Jahre 1591 die reiz-
volle Halbfigurengruppe mit der heiligen Katha-
rina, von der das Dresdener Kabinett eine kleine,
anonyme Aquarellkopie besitzt, und eine andere
Darstellung der Maria mit Kind und dem klei-
nen Johannes. Durch die Beifügung von halb-
wüchsigen Engeln, die Früchte und Blumen dar-
bringen oder singen, wird dann die Gruppe be-
lebter gestaltet, so auf den von Raphael und den
zwei von Egidius Sadeler gestochenen Kompo-
sitionen. Zwei Darstellungen des beliebten Magdalenen-Themas: Christus als Gärtner mit der Sün-
derin und ein Brustbild der Büßerin fallen gleichfalls in diese Zeit.
Für den Verlag des Georg Hoefnagel und die Sadeler war Aachen auch zeichnerisch tätig. Aus
dem Jahre 1589 stammt das bereits erwähnte Blatt mit der thronenden Maria und den beiden Johannes. 3
Derselbe J. Sadeler hat auch die Halbfiguren des hl. Augustinus und des Albertus gestochen.4 Zwölf
konventionell gehaltene Zeichnungen zur Geschichte Christi sind enthalten in der 1590 von dem ge-
lehrten Hoefnagel herausgegebenen und von E. Sadeler gestochenen Folge «Salus generis humani», die
1 Frimmel rühmt das nicht mehr nachweisbare Bildchen der aufgelösten Sammlung Remi van Haanen in Wien, das
unter Correggios, dann Elsheimers Namen ging, als besonders fein: Chronique des arts et de la curiosite (Gazette des beaux
arts) 1891, p. 124. S. Verzeichnis I, Nr. 10.
2 Vielleicht das «täfelin auf schwartzen stain», das 1611 der Herzog von Bayern durch Vermittlung Hainhofers dem
Herzog von Pommern schenkte und dessen Beschreibung mit dem Stich übereinstimmt. Derselbe Herzog erhielt auch eine
Kreuzigung auf Kupfer «von viler Arbeit über die massen schön . . . das Landschäftlin auch nit gar klein» zugeschickt, die
Aachen um 1591 für J. Sadeler gemalt hatte: Quellenschriften zur Kunstgeschichte VI, S. 108 und 110.
3 Merlo, Nr. 92.
4 Merlo, Nr. 96 und 97.
Fig. 3o. Hans von Aachen, Die drei Frauen am Grabe.
Federzeichnung. Berlin, kgl. Kupferstichkabinett.
Verz. IV, Nr. r.
Rudolf Arthur Peltzer.
Komposition nicht solche leer wirkende Ecken angefügt haben.1 Bei der Grablegung (Fig. 29) ist
nicht ohne Geschick der Leichnam Christi, in mäßiger Verkürzung gesehen, gerade in die Mitte des
Bildes gerückt, so daß er den Blick sofort auf sich zieht. Eine alte Kopie auf Schiefer im Breslauer
Museum (als Ch. Schwarz) läßt erraten, daß eine gewisse Helldunkelwirkung beabsichtigt war, indem
von rückwärts das Tageslicht in die Grotte eindringt. Andere Kopien sind in Böhmen (Strahow und
Chrudim), Graz und Frankfurt a. M. Eine kleine Darstellung des Leichnams Christi, der von zwei
Engeln beweint wird (gestochen von R. Sadeler), auf schwarzem Marmor gemalt, besitzt das Stift Krems-
münster.2 Hier ist schließlich noch ein großes Vo-
tivbild aus dem Jahre 1600 zu erwähnen, das der
Gemäldekatalog des Nationalmuseums in München
wohl richtig mit Aachen in Verbindung bringt.
Komposition wie malerische Behandlung sind
gleich vorzüglich. Vorne zu beiden Seiten knien
der Stifter, seine Gattin und zahlreiche Söhne
und Töchter. In der Mitte öffnet sich die dunkle
Wand des Hintergrundes und man sieht den in
hellem Licht emporschwebenden Heiland, zu sei-
nen Füßen die schlafenden und zurücktaumelnden
Wächter des Grabes.
Eine genaue Analyse der sonstigen zahl-
reichen, nur durch die Sadelerschen Stiche be-
kannten Gemälde und Zeichnungen aus der Zeit
des Münchener Aufenthaltes würde zu weit füh-
ren. Aachen malte damals mehrere Darstellungen
der heiligen Familie. So im Jahre 1591 die reiz-
volle Halbfigurengruppe mit der heiligen Katha-
rina, von der das Dresdener Kabinett eine kleine,
anonyme Aquarellkopie besitzt, und eine andere
Darstellung der Maria mit Kind und dem klei-
nen Johannes. Durch die Beifügung von halb-
wüchsigen Engeln, die Früchte und Blumen dar-
bringen oder singen, wird dann die Gruppe be-
lebter gestaltet, so auf den von Raphael und den
zwei von Egidius Sadeler gestochenen Kompo-
sitionen. Zwei Darstellungen des beliebten Magdalenen-Themas: Christus als Gärtner mit der Sün-
derin und ein Brustbild der Büßerin fallen gleichfalls in diese Zeit.
Für den Verlag des Georg Hoefnagel und die Sadeler war Aachen auch zeichnerisch tätig. Aus
dem Jahre 1589 stammt das bereits erwähnte Blatt mit der thronenden Maria und den beiden Johannes. 3
Derselbe J. Sadeler hat auch die Halbfiguren des hl. Augustinus und des Albertus gestochen.4 Zwölf
konventionell gehaltene Zeichnungen zur Geschichte Christi sind enthalten in der 1590 von dem ge-
lehrten Hoefnagel herausgegebenen und von E. Sadeler gestochenen Folge «Salus generis humani», die
1 Frimmel rühmt das nicht mehr nachweisbare Bildchen der aufgelösten Sammlung Remi van Haanen in Wien, das
unter Correggios, dann Elsheimers Namen ging, als besonders fein: Chronique des arts et de la curiosite (Gazette des beaux
arts) 1891, p. 124. S. Verzeichnis I, Nr. 10.
2 Vielleicht das «täfelin auf schwartzen stain», das 1611 der Herzog von Bayern durch Vermittlung Hainhofers dem
Herzog von Pommern schenkte und dessen Beschreibung mit dem Stich übereinstimmt. Derselbe Herzog erhielt auch eine
Kreuzigung auf Kupfer «von viler Arbeit über die massen schön . . . das Landschäftlin auch nit gar klein» zugeschickt, die
Aachen um 1591 für J. Sadeler gemalt hatte: Quellenschriften zur Kunstgeschichte VI, S. 108 und 110.
3 Merlo, Nr. 92.
4 Merlo, Nr. 96 und 97.
Fig. 3o. Hans von Aachen, Die drei Frauen am Grabe.
Federzeichnung. Berlin, kgl. Kupferstichkabinett.
Verz. IV, Nr. r.