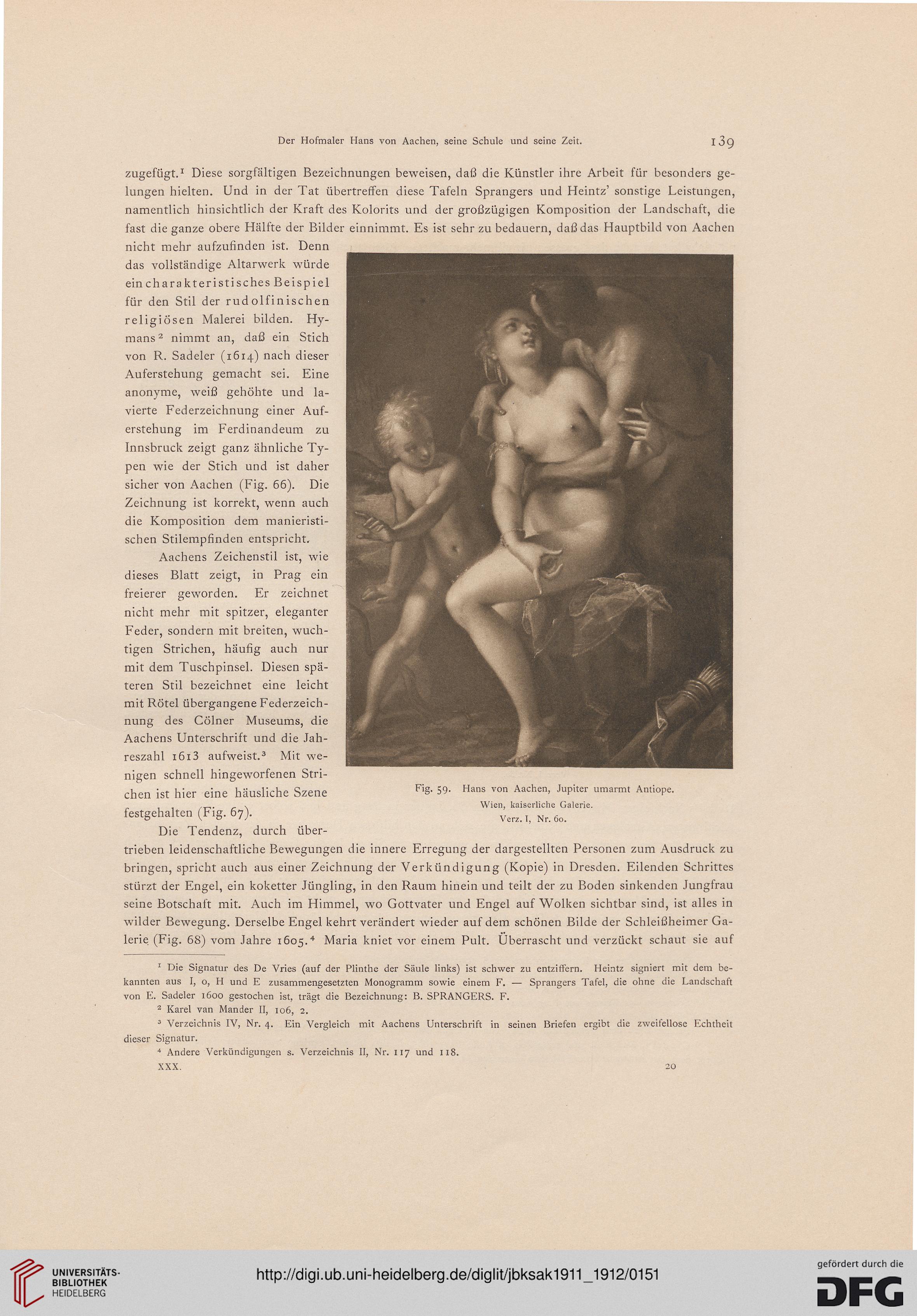Der Hofmaler Hans von Aachen, seine Schule und seine Zeit.
zugefügt.1 Diese sorgfältigen Bezeichnungen beweisen, daß die Künstler ihre Arbeit für besonders ge-
lungen hielten. Und in der Tat übertreffen diese Tafeln Sprangers und Heintz' sonstige Leistungen,
namentlich hinsichtlich der Kraft des Kolorits und der großzügigen Komposition der Landschaft, die
fast die ganze obere Hälfte der Bilder einnimmt. Es ist sehr zu bedauern, daß das Hauptbild von Aachen
nicht mehr aufzufinden ist. Denn
das vollständige Altarwerk würde
ein charakteristisches Beispiel
für den Stil der rudolfinischen
religiösen Malerei bilden. Hy-
mans2 nimmt an, daß ein Stich
von R. Sadeler (1614) nach dieser
Auferstehung gemacht sei. Eine
anonyme, weiß gehöhte und la-
vierte Federzeichnung einer Auf-
erstehung im Ferdinandeum zu
Innsbruck zeigt ganz ähnliche Ty-
pen wie der Stich und ist daher
sicher von Aachen (Fig. 66). Die
Zeichnung ist korrekt, wenn auch
die Komposition dem manieristi-
schen Stilempfinden entspricht.
Aachens Zeichenstil ist, wie
dieses Blatt zeigt, in Prag ein
freierer geworden. Er zeichnet
nicht mehr mit spitzer, eleganter
Feder, sondern mit breiten, wuch-
tigen Strichen, häufig auch nur
mit dem Tuschpinsel. Diesen spä-
teren Stil bezeichnet eine leicht
mit Rötel übergangene Federzeich-
nung des Cölner Museums, die
Aachens Unterschrift und die Jah-
reszahl 1613 aufweist.3 Mit we-
nigen schnell hingeworfenen Stri-
chen ist hier eine häusliche Szene
festgehalten (Fig. 67).
Die Tendenz, durch über-
trieben leidenschaftliche Bewegungen die innere Erregung der dargestellten Personen zum Ausdruck zu
bringen, spricht auch aus einer Zeichnung der Verkündigung (Kopie) in Dresden. Eilenden Schrittes
stürzt der Engel, ein koketter Jüngling, in den Raum hinein und teilt der zu Boden sinkenden Jungfrau
seine Botschaft mit. Auch im Himmel, wo Gottvater und Engel auf Wolken sichtbar sind, ist alles in
wilder Bewegung. Derselbe Engel kehrt verändert wieder auf dem schönen Bilde der Schleißheimer Ga-
lerie (Fig. 68) vom Jahre 1605.4 Maria kniet vor einem Pult. Überrascht und verzückt schaut sie auf
Fig. 59-
Hans von Aachen, Jupiter umarmt Antiope.
Wien, kaiserliche Galerie.
Verz. 1, Nr. 60.
1 Die Signatur des De Vries (auf der Plinthe der Säule links) ist schwer zu entziffern. Heintz signiert mit dem be-
kannten aus I, o, H und E zusammengesetzten Monogramm sowie einem F. — Sprangers Tafel, die ohne die Landschaft
von E. Sadeler 1600 gestochen ist, trägt die Bezeichnung: B. SPRANGERS. F.
2 Karel van Mander II, 106, 2.
3 Verzeichnis IV, Nr. 4. Ein Vergleich mit Aachens Unterschrift in seinen Briefen ergibt die zweifellose Echtheit
dieser Signatur.
4 Andere Verkündigungen s. Verzeichnis II, Nr. 117 und 118.
XXX. 20
zugefügt.1 Diese sorgfältigen Bezeichnungen beweisen, daß die Künstler ihre Arbeit für besonders ge-
lungen hielten. Und in der Tat übertreffen diese Tafeln Sprangers und Heintz' sonstige Leistungen,
namentlich hinsichtlich der Kraft des Kolorits und der großzügigen Komposition der Landschaft, die
fast die ganze obere Hälfte der Bilder einnimmt. Es ist sehr zu bedauern, daß das Hauptbild von Aachen
nicht mehr aufzufinden ist. Denn
das vollständige Altarwerk würde
ein charakteristisches Beispiel
für den Stil der rudolfinischen
religiösen Malerei bilden. Hy-
mans2 nimmt an, daß ein Stich
von R. Sadeler (1614) nach dieser
Auferstehung gemacht sei. Eine
anonyme, weiß gehöhte und la-
vierte Federzeichnung einer Auf-
erstehung im Ferdinandeum zu
Innsbruck zeigt ganz ähnliche Ty-
pen wie der Stich und ist daher
sicher von Aachen (Fig. 66). Die
Zeichnung ist korrekt, wenn auch
die Komposition dem manieristi-
schen Stilempfinden entspricht.
Aachens Zeichenstil ist, wie
dieses Blatt zeigt, in Prag ein
freierer geworden. Er zeichnet
nicht mehr mit spitzer, eleganter
Feder, sondern mit breiten, wuch-
tigen Strichen, häufig auch nur
mit dem Tuschpinsel. Diesen spä-
teren Stil bezeichnet eine leicht
mit Rötel übergangene Federzeich-
nung des Cölner Museums, die
Aachens Unterschrift und die Jah-
reszahl 1613 aufweist.3 Mit we-
nigen schnell hingeworfenen Stri-
chen ist hier eine häusliche Szene
festgehalten (Fig. 67).
Die Tendenz, durch über-
trieben leidenschaftliche Bewegungen die innere Erregung der dargestellten Personen zum Ausdruck zu
bringen, spricht auch aus einer Zeichnung der Verkündigung (Kopie) in Dresden. Eilenden Schrittes
stürzt der Engel, ein koketter Jüngling, in den Raum hinein und teilt der zu Boden sinkenden Jungfrau
seine Botschaft mit. Auch im Himmel, wo Gottvater und Engel auf Wolken sichtbar sind, ist alles in
wilder Bewegung. Derselbe Engel kehrt verändert wieder auf dem schönen Bilde der Schleißheimer Ga-
lerie (Fig. 68) vom Jahre 1605.4 Maria kniet vor einem Pult. Überrascht und verzückt schaut sie auf
Fig. 59-
Hans von Aachen, Jupiter umarmt Antiope.
Wien, kaiserliche Galerie.
Verz. 1, Nr. 60.
1 Die Signatur des De Vries (auf der Plinthe der Säule links) ist schwer zu entziffern. Heintz signiert mit dem be-
kannten aus I, o, H und E zusammengesetzten Monogramm sowie einem F. — Sprangers Tafel, die ohne die Landschaft
von E. Sadeler 1600 gestochen ist, trägt die Bezeichnung: B. SPRANGERS. F.
2 Karel van Mander II, 106, 2.
3 Verzeichnis IV, Nr. 4. Ein Vergleich mit Aachens Unterschrift in seinen Briefen ergibt die zweifellose Echtheit
dieser Signatur.
4 Andere Verkündigungen s. Verzeichnis II, Nr. 117 und 118.
XXX. 20