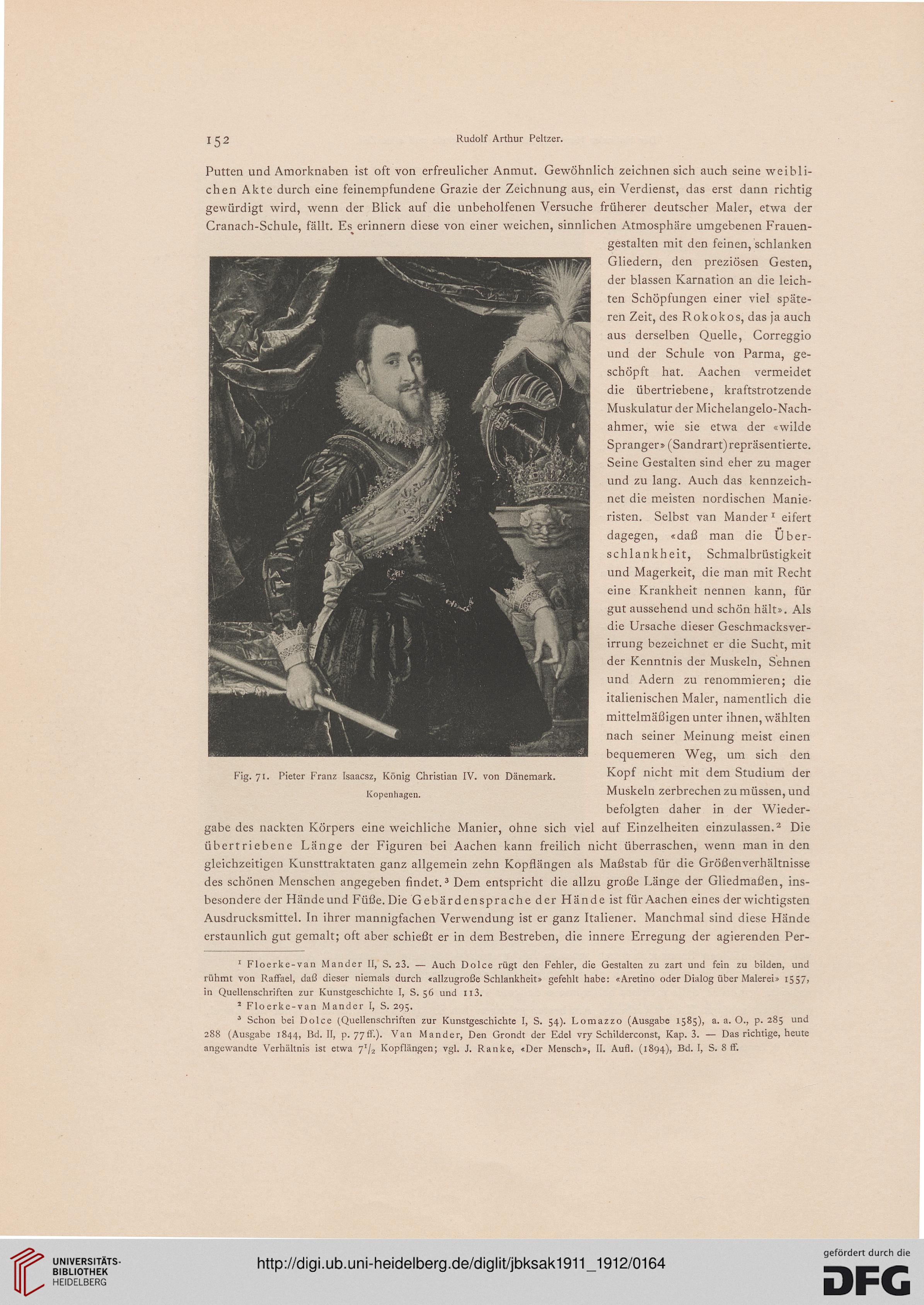152
Rudolf Arthur Peltzer.
Putten und Amorknaben ist oft von erfreulicher Anmut. Gewöhnlich zeichnen sich auch seine weihli-
chen Akte durch eine feinempfundene Grazie der Zeichnung aus, ein Verdienst, das erst dann richtig
gewürdigt wird, wenn der Blick auf die unbeholfenen Versuche früherer deutscher Maler, etwa der
Cranach-Schule, fällt. Es erinnern diese von einer weichen, sinnlichen Atmosphäre umgebenen Frauen-
gestalten mit den feinen, schlanken
Gliedern, den preziösen Gesten,
der blassen Karnation an die leich-
ten Schöpfungen einer viel späte-
ren Zeit, des Rokokos, das ja auch
aus derselben Quelle, Correggio
und der Schule von Parma, ge-
schöpft hat. Aachen vermeidet
die übertriebene, kraftstrotzende
Muskulatur der Michelangelo-Nach-
ahmer, wie sie etwa der «wilde
Spranger» (Sandrart)repräsentierte.
Seine Gestalten sind eher zu mager
und zu lang. Auch das kennzeich-
net die meisten nordischen Manie-
risten. Selbst van Mander1 eifert
dagegen, «daß man die Ober-
schlankheit, Schmalbrüstigkeit
und Magerkeit, die man mit Recht
eine Krankheit nennen kann, für
gut aussehend und schön hält». Als
die Ursache dieser Geschmacksver-
irrung bezeichnet er die Sucht, mit
der Kenntnis der Muskeln, Sehnen
und Adern zu renommieren; die
italienischen Maler, namentlich die
mittelmäßigen unter ihnen, wählten
nach seiner Meinung meist einen
bequemeren Weg, um sich den
Kopf nicht mit dem Studium der
Muskeln zerbrechen zu müssen, und
befolgten daher in der Wieder-
gabe des nackten Körpers eine weichliche Manier, ohne sich viel auf Einzelheiten einzulassen.2 Die
übertriebene Länge der Figuren bei Aachen kann freilich nicht überraschen, wenn man in den
gleichzeitigen Kunsttraktaten ganz allgemein zehn Kopflängen als Maßstab für die Größenverhältnisse
des schönen Menschen angegeben findet.3 Dem entspricht die allzu große Länge der Gliedmaßen, ins-
besondere der Händeund Füße. Die Gebärdensprache der Hände ist für Aachen eines der wichtigsten
Ausdrucksmittel. In ihrer mannigfachen Verwendung ist er ganz Italiener. Manchmal sind diese Hände
erstaunlich gut gemalt; oft aber schießt er in dem Bestreben, die innere Erregung der agierenden Per-
Fig. 71. Pieter Franz Isaacsz, König Christian IV. von Dänemark.
Kopenhagen.
1 Floerke-van Mander II, S. 23. — Auch Dolce rügt den Fehler, die Gestalten zu zart und fein zu bilden, und
rühmt von Raffael, daß dieser niemals durch «allzugroße Schlankheit» gefehlt habe: «Aretino oder Dialog über Malerei» 1557,
in Quellenschriften zur Kunstgeschichte I, S. 56 und 113.
1 Floerke-van Mander I, S. 295.
3 Schon bei Dolce (Quellenschriften zur Kunstgeschichte I, S. 54). Lomazzo (Ausgabe 1585), a. a. O., p. 285 und
288 (Ausgabe 1844, Bd. II, p. 77«'.). Van Mander, Den Grondt der Edel vry Schilderconst, Kap. 3. — Das richtige, heute
angewandte Verhältnis ist etwa y'j2 Kopflängen; vgl. J. Ranke, «Der Mensch», II. Aufl. (1894), Bd. I, S. 8 ff.
Rudolf Arthur Peltzer.
Putten und Amorknaben ist oft von erfreulicher Anmut. Gewöhnlich zeichnen sich auch seine weihli-
chen Akte durch eine feinempfundene Grazie der Zeichnung aus, ein Verdienst, das erst dann richtig
gewürdigt wird, wenn der Blick auf die unbeholfenen Versuche früherer deutscher Maler, etwa der
Cranach-Schule, fällt. Es erinnern diese von einer weichen, sinnlichen Atmosphäre umgebenen Frauen-
gestalten mit den feinen, schlanken
Gliedern, den preziösen Gesten,
der blassen Karnation an die leich-
ten Schöpfungen einer viel späte-
ren Zeit, des Rokokos, das ja auch
aus derselben Quelle, Correggio
und der Schule von Parma, ge-
schöpft hat. Aachen vermeidet
die übertriebene, kraftstrotzende
Muskulatur der Michelangelo-Nach-
ahmer, wie sie etwa der «wilde
Spranger» (Sandrart)repräsentierte.
Seine Gestalten sind eher zu mager
und zu lang. Auch das kennzeich-
net die meisten nordischen Manie-
risten. Selbst van Mander1 eifert
dagegen, «daß man die Ober-
schlankheit, Schmalbrüstigkeit
und Magerkeit, die man mit Recht
eine Krankheit nennen kann, für
gut aussehend und schön hält». Als
die Ursache dieser Geschmacksver-
irrung bezeichnet er die Sucht, mit
der Kenntnis der Muskeln, Sehnen
und Adern zu renommieren; die
italienischen Maler, namentlich die
mittelmäßigen unter ihnen, wählten
nach seiner Meinung meist einen
bequemeren Weg, um sich den
Kopf nicht mit dem Studium der
Muskeln zerbrechen zu müssen, und
befolgten daher in der Wieder-
gabe des nackten Körpers eine weichliche Manier, ohne sich viel auf Einzelheiten einzulassen.2 Die
übertriebene Länge der Figuren bei Aachen kann freilich nicht überraschen, wenn man in den
gleichzeitigen Kunsttraktaten ganz allgemein zehn Kopflängen als Maßstab für die Größenverhältnisse
des schönen Menschen angegeben findet.3 Dem entspricht die allzu große Länge der Gliedmaßen, ins-
besondere der Händeund Füße. Die Gebärdensprache der Hände ist für Aachen eines der wichtigsten
Ausdrucksmittel. In ihrer mannigfachen Verwendung ist er ganz Italiener. Manchmal sind diese Hände
erstaunlich gut gemalt; oft aber schießt er in dem Bestreben, die innere Erregung der agierenden Per-
Fig. 71. Pieter Franz Isaacsz, König Christian IV. von Dänemark.
Kopenhagen.
1 Floerke-van Mander II, S. 23. — Auch Dolce rügt den Fehler, die Gestalten zu zart und fein zu bilden, und
rühmt von Raffael, daß dieser niemals durch «allzugroße Schlankheit» gefehlt habe: «Aretino oder Dialog über Malerei» 1557,
in Quellenschriften zur Kunstgeschichte I, S. 56 und 113.
1 Floerke-van Mander I, S. 295.
3 Schon bei Dolce (Quellenschriften zur Kunstgeschichte I, S. 54). Lomazzo (Ausgabe 1585), a. a. O., p. 285 und
288 (Ausgabe 1844, Bd. II, p. 77«'.). Van Mander, Den Grondt der Edel vry Schilderconst, Kap. 3. — Das richtige, heute
angewandte Verhältnis ist etwa y'j2 Kopflängen; vgl. J. Ranke, «Der Mensch», II. Aufl. (1894), Bd. I, S. 8 ff.