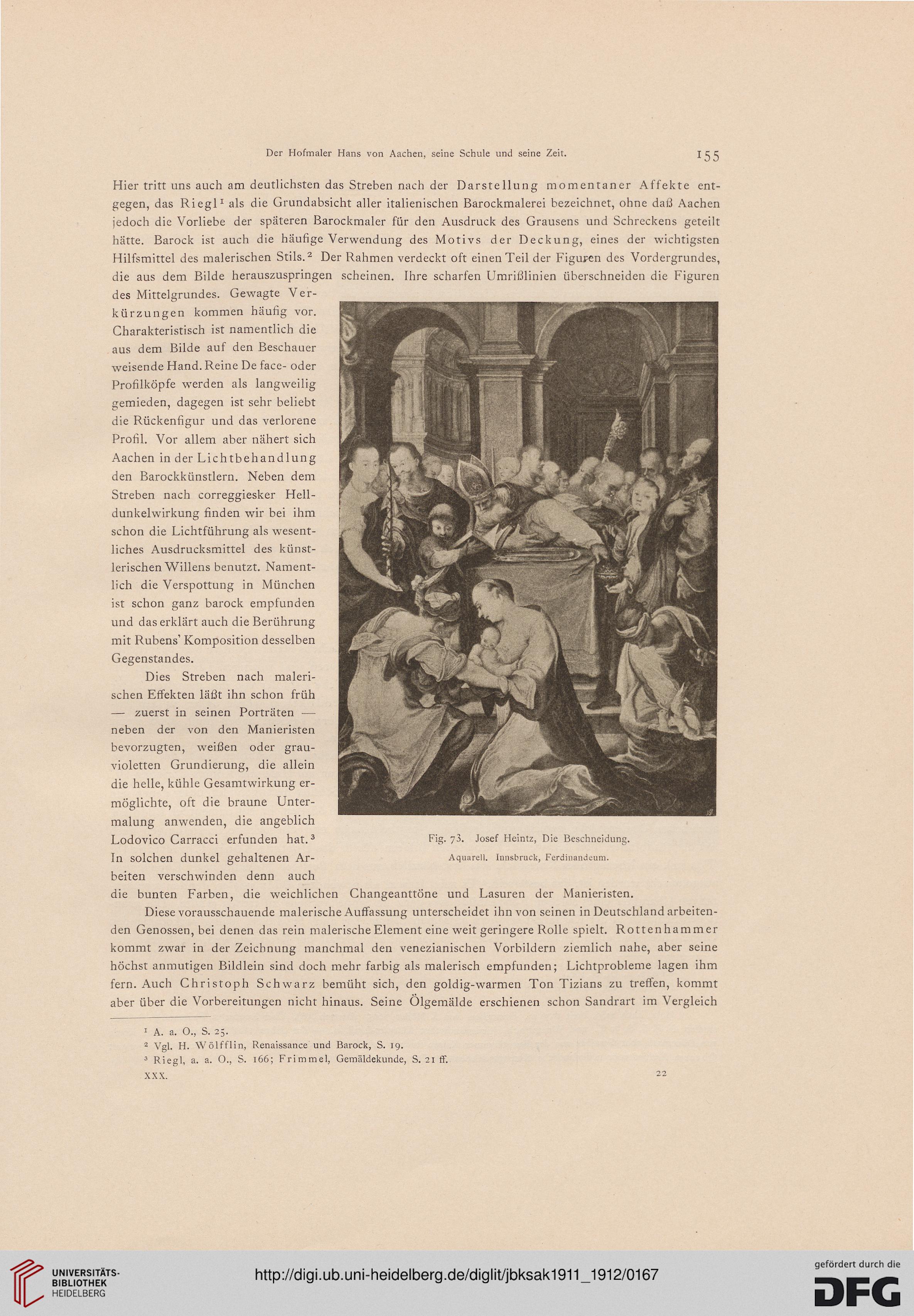Der Hofmaler Hans von Aachen, seine Schule und seine Zeit.
155
Hier tritt uns auch am deutlichsten das Streben nach der Darstellung momentaner Affekte ent-
gegen, das Riegl1 als die Grundabsicht aller italienischen Barockmalerei bezeichnet, ohne daß Aachen
jedoch die Vorliebe der späteren Barockmaler für den Ausdruck des Grausens und Schreckens geteilt
hätte. Barock ist auch die häufige Verwendung des Motivs der Deckung, eines der wichtigsten
Hilfsmittel des malerischen Stils.2 Der Rahmen verdeckt oft einen Teil der Figuren des Vordergrundes,
die aus dem Bilde herauszuspringen scheinen. Ihre scharfen Umrißlinien überschneiden die Figuren
des Mittelgrundes. Gewagte Ver-
kürzungen kommen häufig vor.
Charakteristisch ist namentlich die
aus dem Bilde auf den Beschauer
weisende Hand. Reine De face- oder
Profilköpfe werden als langweilig
gemieden, dagegen ist sehr beliebt
die Rückenfigur und das verlorene
Profil. Vor allem aber nähert sich
Aachen in der Lichtbehandlung
den Barockkünstlern. Neben dem
Streben nach correggiesker Hell-
dunkelwirkung finden wir bei ihm
schon die Lichtführung als wesent-
liches Ausdrucksmittel des künst-
lerischen Willens benutzt. Nament-
lich die Verspottung in München
ist schon ganz barock empfunden
und daserklärt auch die Berührung
mit Rubens' Komposition desselben
Gegenstandes.
Dies Streben nach maleri-
schen Effekten läßt ihn schon früh
— zuerst in seinen Porträten —
neben der von den Manieristen
bevorzugten, weißen oder grau-
violetten Grundierung, die allein
die helle, kühle Gesamtwirkung er-
möglichte, oft die braune Unter-
malung anwenden, die angeblich
Lodovico Carracci erfunden hat.3
In solchen dunkel gehaltenen Ar-
beiten verschwinden denn auch
die bunten Farben, die weichlichen Changeanttöne und Lasuren der Manieristen.
Diese vorausschauende malerische Auffassung unterscheidet ihn von seinen in Deutschland arbeiten-
den Genossen, bei denen das rein malerische Element eine weit geringere Rolle spielt. Rotten hammer
kommt zwar in der Zeichnung manchmal den venezianischen Vorbildern ziemlich nahe, aber seine
höchst anmutigen Bildlein sind doch mehr farbig als malerisch empfunden; Lichtprobleme lagen ihm
fern. Auch Christoph Schwarz bemüht sich, den goldig-warmen Ton Tizians zu treffen, kommt
aber über die Vorbereitungen nicht hinaus. Seine Ölgemälde erschienen schon Sandrart im Vergleich
Fig. 73. Josef Heintz, Die Beschneidunp.
Aquarell. Innsbruck, Ferdinandcum.
1 A. a. O., S. 25.
2 Vgl. H. Wölfflin, Renaissance und Barock, S. 19.
3 Riegl, a. a. ()., S. 166; Frimmel, Gemäldekunde, S. 21 fif.
XXX.
155
Hier tritt uns auch am deutlichsten das Streben nach der Darstellung momentaner Affekte ent-
gegen, das Riegl1 als die Grundabsicht aller italienischen Barockmalerei bezeichnet, ohne daß Aachen
jedoch die Vorliebe der späteren Barockmaler für den Ausdruck des Grausens und Schreckens geteilt
hätte. Barock ist auch die häufige Verwendung des Motivs der Deckung, eines der wichtigsten
Hilfsmittel des malerischen Stils.2 Der Rahmen verdeckt oft einen Teil der Figuren des Vordergrundes,
die aus dem Bilde herauszuspringen scheinen. Ihre scharfen Umrißlinien überschneiden die Figuren
des Mittelgrundes. Gewagte Ver-
kürzungen kommen häufig vor.
Charakteristisch ist namentlich die
aus dem Bilde auf den Beschauer
weisende Hand. Reine De face- oder
Profilköpfe werden als langweilig
gemieden, dagegen ist sehr beliebt
die Rückenfigur und das verlorene
Profil. Vor allem aber nähert sich
Aachen in der Lichtbehandlung
den Barockkünstlern. Neben dem
Streben nach correggiesker Hell-
dunkelwirkung finden wir bei ihm
schon die Lichtführung als wesent-
liches Ausdrucksmittel des künst-
lerischen Willens benutzt. Nament-
lich die Verspottung in München
ist schon ganz barock empfunden
und daserklärt auch die Berührung
mit Rubens' Komposition desselben
Gegenstandes.
Dies Streben nach maleri-
schen Effekten läßt ihn schon früh
— zuerst in seinen Porträten —
neben der von den Manieristen
bevorzugten, weißen oder grau-
violetten Grundierung, die allein
die helle, kühle Gesamtwirkung er-
möglichte, oft die braune Unter-
malung anwenden, die angeblich
Lodovico Carracci erfunden hat.3
In solchen dunkel gehaltenen Ar-
beiten verschwinden denn auch
die bunten Farben, die weichlichen Changeanttöne und Lasuren der Manieristen.
Diese vorausschauende malerische Auffassung unterscheidet ihn von seinen in Deutschland arbeiten-
den Genossen, bei denen das rein malerische Element eine weit geringere Rolle spielt. Rotten hammer
kommt zwar in der Zeichnung manchmal den venezianischen Vorbildern ziemlich nahe, aber seine
höchst anmutigen Bildlein sind doch mehr farbig als malerisch empfunden; Lichtprobleme lagen ihm
fern. Auch Christoph Schwarz bemüht sich, den goldig-warmen Ton Tizians zu treffen, kommt
aber über die Vorbereitungen nicht hinaus. Seine Ölgemälde erschienen schon Sandrart im Vergleich
Fig. 73. Josef Heintz, Die Beschneidunp.
Aquarell. Innsbruck, Ferdinandcum.
1 A. a. O., S. 25.
2 Vgl. H. Wölfflin, Renaissance und Barock, S. 19.
3 Riegl, a. a. ()., S. 166; Frimmel, Gemäldekunde, S. 21 fif.
XXX.