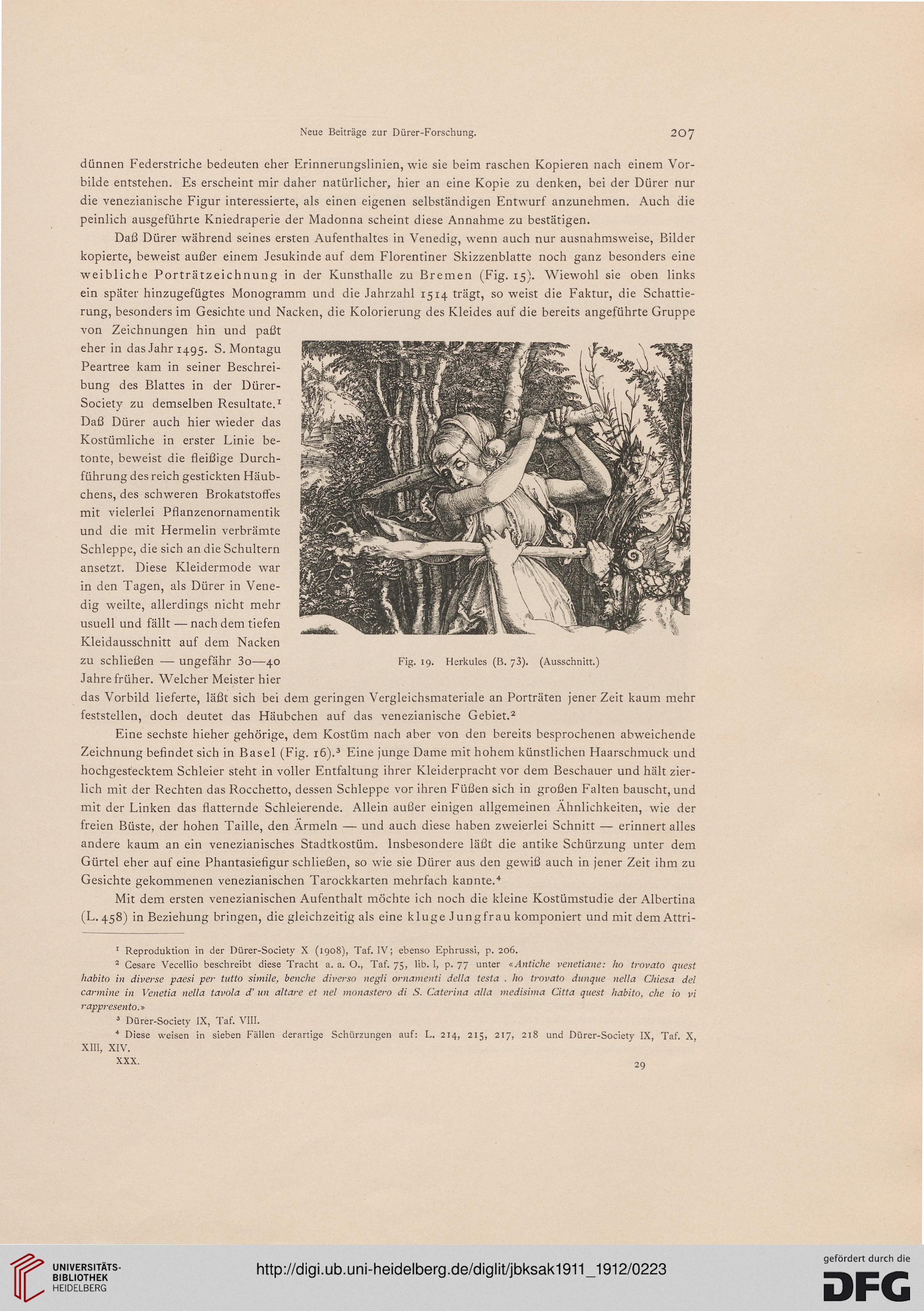Neue Beiträge zur Dürer-Forschung.
207
dünnen Federstriche bedeuten eher Erinnerungslinien, wie sie beim raschen Kopieren nach einem Vor-
bilde entstehen. Es erscheint mir daher natürlicher, hier an eine Kopie zu denken, bei der Dürer nur
die venezianische Figur interessierte, als einen eigenen selbständigen Entwurf anzunehmen. Auch die
peinlich ausgeführte Kniedraperie der Madonna scheint diese Annahme zu bestätigen.
Daß Dürer während seines ersten Aufenthaltes in Venedig, wenn auch nur ausnahmsweise, Bilder
kopierte, beweist außer einem Jesukinde auf dem Florentiner Skizzenblatte noch ganz besonders eine
weibliche Porträtzeichnung in der Kunsthalle zu Bremen (Fig. 15). Wiewohl sie oben links
ein später hinzugefügtes Monogramm und die Jahrzahl 1514 trägt, so weist die Faktur, die Schattie-
rung, besonders im Gesichte und Nacken, die Kolorierung des Kleides auf die bereits angeführte Gruppe
von Zeichnungen hin und paßt
eher in das Jahr 1495. S. Montagu
Peartree kam in seiner Beschrei-
bung des Blattes in der Dürer-
Society zu demselben Resultate.1
Daß Dürer auch hier wieder das
Kostümliche in erster Linie be-
tonte, beweist die fleißige Durch-
führung des reich gestickten Häub-
chens, des schweren Brokatstoffes
mit vielerlei Pflanzenornamentik
und die mit Hermelin verbrämte
Schleppe, die sich an die Schultern
ansetzt. Diese Kleidermode war
in den Tagen, als Dürer in Vene-
dig weilte, allerdings nicht mehr
usuell und fällt — nach dem tiefen
Kleidausschnitt auf dem Nacken
zu schließen — ungefähr 3o—40
Jahre früher. Welcher Meister hier
das Vorbild lieferte, läßt sich bei dem geringen Vergleichsmateriale an Porträten jener Zeit kaum mehr
feststellen, doch deutet das Häubchen auf das venezianische Gebiet.2
Eine sechste hieher gehörige, dem Kostüm nach aber von den bereits besprochenen abweichende
Zeichnung befindet sich in Basel (Fig. 16).3 Eine junge Dame mit hohem künstlichen Haarschmuck und
hochgestecktem Schleier steht in voller Entfaltung ihrer Kleiderpracht vor dem Beschauer und hält zier-
lich mit der Rechten das Rocchetto, dessen Schleppe vor ihren Füßen sich in großen Falten bauscht, und
mit der Linken das flatternde Schleierende. Allein außer einigen allgemeinen Ähnlichkeiten, wie der
freien Büste, der hohen Taille, den Ärmeln — und auch diese haben zweierlei Schnitt — erinnert alles
andere kaum an ein venezianisches Stadtkostüm. Insbesondere läßt die antike Schürzung unter dem
Gürtel eher auf eine Phantasiefigur schließen, so wie sie Dürer aus den gewiß auch in jener Zeit ihm zu
Gesichte gekommenen venezianischen Tarockkarten mehrfach kannte.4
Mit dem ersten venezianischen Aufenthalt möchte ich noch die kleine Kostümstudie der Albertina
(L. 458) in Beziehung bringen, die gleichzeitig als eine kluge Jungfrau komponiert und mit dem Attri-
1 Reproduktion in der Dürer-Society X (1908), Taf. IV; ebenso Ephrussi, p. 206.
2 Cesare Vecellio beschreibt diese Tracht a. a. O., Taf. 75, lib. I, p. 77 unter «Antiche venetiane: ho trovato quest
habito in diverse paesi per tutto simile, benche diverso negli ornamenti della testa . ho trovato dunque nella Chiesa del
carmine in Venetia nella tavola d' un altare et nel monastero di S. Caterina alla mcdisima Gitta quest habito, che io vi
rappresento.*
3 Dürer-Society IX, Taf. VIII.
4 Diese weisen in sieben Fällen derartige Schürzungen auf: L. 214, 215, 217, 218 und Dürer-Society IX, Taf. X,
XIII, XIV.
207
dünnen Federstriche bedeuten eher Erinnerungslinien, wie sie beim raschen Kopieren nach einem Vor-
bilde entstehen. Es erscheint mir daher natürlicher, hier an eine Kopie zu denken, bei der Dürer nur
die venezianische Figur interessierte, als einen eigenen selbständigen Entwurf anzunehmen. Auch die
peinlich ausgeführte Kniedraperie der Madonna scheint diese Annahme zu bestätigen.
Daß Dürer während seines ersten Aufenthaltes in Venedig, wenn auch nur ausnahmsweise, Bilder
kopierte, beweist außer einem Jesukinde auf dem Florentiner Skizzenblatte noch ganz besonders eine
weibliche Porträtzeichnung in der Kunsthalle zu Bremen (Fig. 15). Wiewohl sie oben links
ein später hinzugefügtes Monogramm und die Jahrzahl 1514 trägt, so weist die Faktur, die Schattie-
rung, besonders im Gesichte und Nacken, die Kolorierung des Kleides auf die bereits angeführte Gruppe
von Zeichnungen hin und paßt
eher in das Jahr 1495. S. Montagu
Peartree kam in seiner Beschrei-
bung des Blattes in der Dürer-
Society zu demselben Resultate.1
Daß Dürer auch hier wieder das
Kostümliche in erster Linie be-
tonte, beweist die fleißige Durch-
führung des reich gestickten Häub-
chens, des schweren Brokatstoffes
mit vielerlei Pflanzenornamentik
und die mit Hermelin verbrämte
Schleppe, die sich an die Schultern
ansetzt. Diese Kleidermode war
in den Tagen, als Dürer in Vene-
dig weilte, allerdings nicht mehr
usuell und fällt — nach dem tiefen
Kleidausschnitt auf dem Nacken
zu schließen — ungefähr 3o—40
Jahre früher. Welcher Meister hier
das Vorbild lieferte, läßt sich bei dem geringen Vergleichsmateriale an Porträten jener Zeit kaum mehr
feststellen, doch deutet das Häubchen auf das venezianische Gebiet.2
Eine sechste hieher gehörige, dem Kostüm nach aber von den bereits besprochenen abweichende
Zeichnung befindet sich in Basel (Fig. 16).3 Eine junge Dame mit hohem künstlichen Haarschmuck und
hochgestecktem Schleier steht in voller Entfaltung ihrer Kleiderpracht vor dem Beschauer und hält zier-
lich mit der Rechten das Rocchetto, dessen Schleppe vor ihren Füßen sich in großen Falten bauscht, und
mit der Linken das flatternde Schleierende. Allein außer einigen allgemeinen Ähnlichkeiten, wie der
freien Büste, der hohen Taille, den Ärmeln — und auch diese haben zweierlei Schnitt — erinnert alles
andere kaum an ein venezianisches Stadtkostüm. Insbesondere läßt die antike Schürzung unter dem
Gürtel eher auf eine Phantasiefigur schließen, so wie sie Dürer aus den gewiß auch in jener Zeit ihm zu
Gesichte gekommenen venezianischen Tarockkarten mehrfach kannte.4
Mit dem ersten venezianischen Aufenthalt möchte ich noch die kleine Kostümstudie der Albertina
(L. 458) in Beziehung bringen, die gleichzeitig als eine kluge Jungfrau komponiert und mit dem Attri-
1 Reproduktion in der Dürer-Society X (1908), Taf. IV; ebenso Ephrussi, p. 206.
2 Cesare Vecellio beschreibt diese Tracht a. a. O., Taf. 75, lib. I, p. 77 unter «Antiche venetiane: ho trovato quest
habito in diverse paesi per tutto simile, benche diverso negli ornamenti della testa . ho trovato dunque nella Chiesa del
carmine in Venetia nella tavola d' un altare et nel monastero di S. Caterina alla mcdisima Gitta quest habito, che io vi
rappresento.*
3 Dürer-Society IX, Taf. VIII.
4 Diese weisen in sieben Fällen derartige Schürzungen auf: L. 214, 215, 217, 218 und Dürer-Society IX, Taf. X,
XIII, XIV.