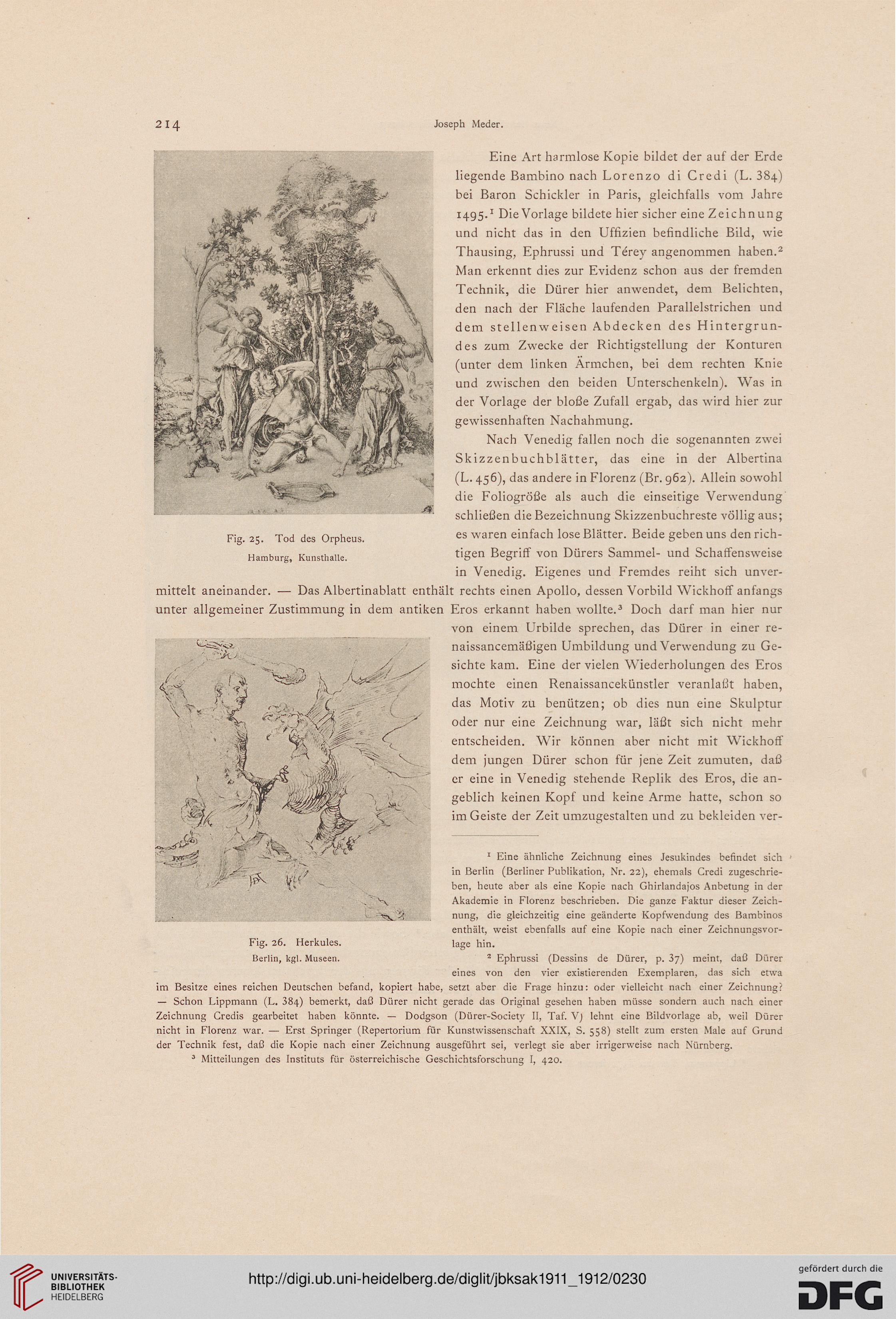Joseph Meder.
tarn
Fig. 25. Tod des Orpheus.
Hamburg, KunsthaUe.
Eine Art harmlose Kopie bildet der auf der Erde
liegende Bambino nach Lorenzo di Credi (L. 384)
bei Baron Schickler in Paris, gleichfalls vom Jahre
1495.1 Die Vorlage bildete hier sicher eine Zeichnung
und nicht das in den Uffizien befindliche Bild, wie
Thausing, Ephrussi und Terey angenommen haben.2
Man erkennt dies zur Evidenz schon aus der fremden
Technik, die Dürer hier anwendet, dem Belichten,
den nach der Fläche laufenden Parallelstrichen und
dem stellenweisen Abdecken des Hintergrun-
des zum Zwecke der Richtigstellung der Konturen
(unter dem linken Armchen, bei dem rechten Knie
und zwischen den beiden Unterschenkeln). Was in
der Vorlage der bloße Zufall ergab, das wird hier zur
gewissenhaften Nachahmung.
Nach Venedig fallen noch die sogenannten zwei
Skizzenbuchblätter, das eine in der Albertina
(L. 456), das andere in Florenz (Br. 962). Allein sowohl
die Foliogröße als auch die einseitige Verwendung
schließen die Bezeichnung Skizzenbuchreste völlig aus;
es waren einfach lose Blätter. Beide geben uns den rich-
tigen Begriff von Dürers Sammel- und Schaffensweise
in Venedig. Eigenes und Fremdes reiht sich unver-
mittelt aneinander. — Das Albertinablatt enthält rechts einen Apollo, dessen Vorbild Wickhoff anfangs
unter allgemeiner Zustimmung in dem antiken Eros erkannt haben wollte.3 Doch darf man hier nur
von einem Urbilde sprechen, das Dürer in einer re-
naissancemäßigen Umbildung und Verwendung zu Ge-
sichte kam. Eine der vielen Wiederholungen des Eros
mochte einen Renaissancekünstler veranlaßt haben,
das Motiv zu benützen; ob dies nun eine Skulptur
oder nur eine Zeichnung war, läßt sich nicht mehr
entscheiden. Wir können aber nicht mit Wickhoff
dem jungen Dürer schon für jene Zeit zumuten, daß
er eine in Venedig stehende Replik des Eros, die an-
geblich keinen Kopf und keine Arme hatte, schon so
im Geiste der Zeit umzugestalten und zu bekleiden ver-
1 Eine ähnliche Zeichnung eines Jesukindes befindet sich
in Berlin (Berliner Publikation, Nr. 22), ehemals Credi zugeschrie-
ben, heute aber als eine Kopie nach Ghirlandajos Anbetung in der
Akademie in Florenz beschrieben. Die ganze Faktur dieser Zeich-
nung, die gleichzeitig eine geänderte Kopfwendung des Bambinos
enthält, weist ebenfalls auf eine Kopie nach einer Zeichnungsvor-
lage hin.
2 Ephrussi (Dessins de Dürer, p. 37) meint, daß Dürer
eines von den vier existierenden Exemplaren, das sich etwa
im Besitze eines reichen Deutschen befand, kopiert habe, setzt aber die Frage hinzu: oder vielleicht nach einer Zeichnung?
— Schon Lippmann (L. 384) bemerkt, daß Dürer nicht gerade das Original gesehen haben müsse sondern auch nach einer
Zeichnung Credis gearbeitet haben könnte. — Dodgson (Dürer-Society II, Taf. Vj lehnt eine Bildvorlage ab, weil Dürer
nicht in Florenz war. — Erst Springer (Repertorium für Kunstwissenschaft XXIX, S. 558) stellt zum ersten Male auf Grund
der Technik fest, daß die Kopie nach einer Zeichnung ausgeführt sei, verlegt sie aber irrigerweise nach Nürnberg.
3 Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung I, 420.
l!.-*}'.> & v —*" " * {
Fig. 26. Herkules.
Berlin, kgl. Museen.
tarn
Fig. 25. Tod des Orpheus.
Hamburg, KunsthaUe.
Eine Art harmlose Kopie bildet der auf der Erde
liegende Bambino nach Lorenzo di Credi (L. 384)
bei Baron Schickler in Paris, gleichfalls vom Jahre
1495.1 Die Vorlage bildete hier sicher eine Zeichnung
und nicht das in den Uffizien befindliche Bild, wie
Thausing, Ephrussi und Terey angenommen haben.2
Man erkennt dies zur Evidenz schon aus der fremden
Technik, die Dürer hier anwendet, dem Belichten,
den nach der Fläche laufenden Parallelstrichen und
dem stellenweisen Abdecken des Hintergrun-
des zum Zwecke der Richtigstellung der Konturen
(unter dem linken Armchen, bei dem rechten Knie
und zwischen den beiden Unterschenkeln). Was in
der Vorlage der bloße Zufall ergab, das wird hier zur
gewissenhaften Nachahmung.
Nach Venedig fallen noch die sogenannten zwei
Skizzenbuchblätter, das eine in der Albertina
(L. 456), das andere in Florenz (Br. 962). Allein sowohl
die Foliogröße als auch die einseitige Verwendung
schließen die Bezeichnung Skizzenbuchreste völlig aus;
es waren einfach lose Blätter. Beide geben uns den rich-
tigen Begriff von Dürers Sammel- und Schaffensweise
in Venedig. Eigenes und Fremdes reiht sich unver-
mittelt aneinander. — Das Albertinablatt enthält rechts einen Apollo, dessen Vorbild Wickhoff anfangs
unter allgemeiner Zustimmung in dem antiken Eros erkannt haben wollte.3 Doch darf man hier nur
von einem Urbilde sprechen, das Dürer in einer re-
naissancemäßigen Umbildung und Verwendung zu Ge-
sichte kam. Eine der vielen Wiederholungen des Eros
mochte einen Renaissancekünstler veranlaßt haben,
das Motiv zu benützen; ob dies nun eine Skulptur
oder nur eine Zeichnung war, läßt sich nicht mehr
entscheiden. Wir können aber nicht mit Wickhoff
dem jungen Dürer schon für jene Zeit zumuten, daß
er eine in Venedig stehende Replik des Eros, die an-
geblich keinen Kopf und keine Arme hatte, schon so
im Geiste der Zeit umzugestalten und zu bekleiden ver-
1 Eine ähnliche Zeichnung eines Jesukindes befindet sich
in Berlin (Berliner Publikation, Nr. 22), ehemals Credi zugeschrie-
ben, heute aber als eine Kopie nach Ghirlandajos Anbetung in der
Akademie in Florenz beschrieben. Die ganze Faktur dieser Zeich-
nung, die gleichzeitig eine geänderte Kopfwendung des Bambinos
enthält, weist ebenfalls auf eine Kopie nach einer Zeichnungsvor-
lage hin.
2 Ephrussi (Dessins de Dürer, p. 37) meint, daß Dürer
eines von den vier existierenden Exemplaren, das sich etwa
im Besitze eines reichen Deutschen befand, kopiert habe, setzt aber die Frage hinzu: oder vielleicht nach einer Zeichnung?
— Schon Lippmann (L. 384) bemerkt, daß Dürer nicht gerade das Original gesehen haben müsse sondern auch nach einer
Zeichnung Credis gearbeitet haben könnte. — Dodgson (Dürer-Society II, Taf. Vj lehnt eine Bildvorlage ab, weil Dürer
nicht in Florenz war. — Erst Springer (Repertorium für Kunstwissenschaft XXIX, S. 558) stellt zum ersten Male auf Grund
der Technik fest, daß die Kopie nach einer Zeichnung ausgeführt sei, verlegt sie aber irrigerweise nach Nürnberg.
3 Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung I, 420.
l!.-*}'.> & v —*" " * {
Fig. 26. Herkules.
Berlin, kgl. Museen.