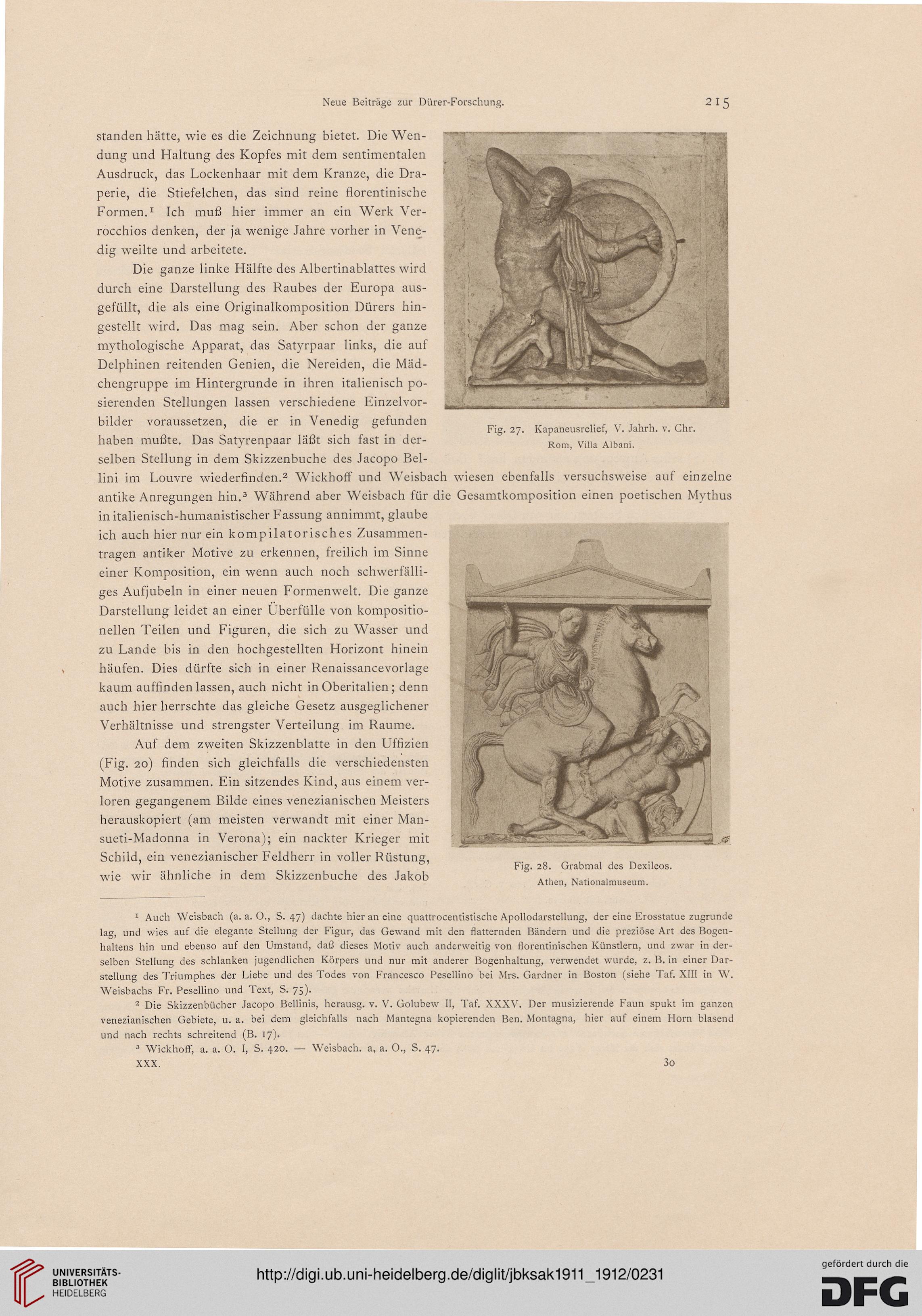Neue Beiträge zur Dürer-Forschung.
215
Fig. 27. Kapaneusrelief, V. Jahrh. v. Chr.
Rom, Villa Albani.
standen hätte, wie es die Zeichnung bietet. Die Wen-
dung und Haltung des Kopfes mit dem sentimentalen
Ausdruck, das Lockenhaar mit dem Kranze, die Dra-
perie, die Stiefelchen, das sind reine florentinische
Formen.1 Ich muß hier immer an ein Werk Ver-
rocchios denken, der ja wenige Jahre vorher in Vene-
dig weilte und arbeitete.
Die ganze linke Hälfte des Albertinablattes wird
durch eine Darstellung des Raubes der Europa aus-
gefüllt, die als eine Originalkomposition Dürers hin-
gestellt wird. Das mag sein. Aber schon der ganze
mythologische Apparat, das Satyrpaar links, die auf
Delphinen reitenden Genien, die Nereiden, die Mäd-
chengruppe im Hintergrunde in ihren italienisch po-
sierenden Stellungen lassen verschiedene Einzelvor-
bilder voraussetzen, die er in Venedig gefunden
haben mußte. Das Satyrenpaar läßt sich fast in der-
selben Stellung in dem Skizzenbuche des Jacopo Bel-
lini im Louvre wiederfinden.2 Wickhoff und Weisbach wiesen ebenfalls versuchsweise auf einzelne
antike Anregungen hin.3 Während aber Weisbach für die Gesamtkomposition einen poetischen Mvthus
in italienisch-humanistischer Fassung annimmt, glaube
ich auch hier nur ein kompilatorisches Zusammen-
tragen antiker Motive zu erkennen, freilich im Sinne
einer Komposition, ein wenn auch noch schwerfälli-
ges Aufjubeln in einer neuen Formenwelt. Die ganze
Darstellung leidet an einer Überfülle von kompositio-
neilen Teilen und Figuren, die sich zu Wasser und
zu Lande bis in den hochgestellten Horizont hinein
häufen. Dies dürfte sich in einer Renaissancevorlage
kaum auffinden lassen, auch nicht in Oberitalien; denn
auch hier herrschte das gleiche Gesetz ausgeglichener
Verhältnisse und strengster Verteilung im Räume.
Auf dem zweiten Skizzenblatte in den Uffizien
(Fig. 20) finden sich gleichfalls die verschiedensten
Motive zusammen. Ein sitzendes Kind, aus einem ver-
loren gegangenem Bilde eines venezianischen Meisters
herauskopiert (am meisten verwandt mit einer Man-
sueti-Madonna in Verona); ein nackter Krieger mit
Schild, ein venezianischer Feldherr in voller Rüstung,
. Fig. 28. Grabmal des Dexileos.
wie wir ähnliche in dem Skizzenbuche des Jakob , , x.
Athen, Nationalmuseum.
1 Auch Weisbach (a. a. O., S. 47) dachte hier an eine quattrocentistische Apollodarstellung, der eine Erosstatue zugrunde
lag, und wies auf die elegante Stellung der Figur, das Gewand mit den flatternden Bändern und die preziöse Art des Bogen-
haltens hin und ebenso auf den Umstand, daß dieses Motiv auch anderweitig von florentinischen Künstlern, und zwar in der-
selben Stellung des schlanken jugendlichen Körpers und nur mit anderer Bogenhaltung, verwendet wurde, z. B. in einer Dar-
stellung des Triumphes der Liebe und des Todes von Francesco Pesellino bei Mrs. Gardner in Boston (siehe Taf. XIII in W.
Weisbachs Fr. Pesellino und Text, S. 75).
a Die Skizzenbücher Jacopo Bellinis, herausg. v. V. Golubew II, Taf. XXXV. Der musizierende Faun spukt im ganzen
venezianischen Gebiete, u. a. bei dem gleichfalls nach Mantegna kopierenden Ben. Montagna, hier auf einem Horn blasend
und nach rechts schreitend (B. 17).
3 Wickhoff, a. a. O. I, S. 420. — Weisbach, a, a. O., S. 47.
XXX. 3o
215
Fig. 27. Kapaneusrelief, V. Jahrh. v. Chr.
Rom, Villa Albani.
standen hätte, wie es die Zeichnung bietet. Die Wen-
dung und Haltung des Kopfes mit dem sentimentalen
Ausdruck, das Lockenhaar mit dem Kranze, die Dra-
perie, die Stiefelchen, das sind reine florentinische
Formen.1 Ich muß hier immer an ein Werk Ver-
rocchios denken, der ja wenige Jahre vorher in Vene-
dig weilte und arbeitete.
Die ganze linke Hälfte des Albertinablattes wird
durch eine Darstellung des Raubes der Europa aus-
gefüllt, die als eine Originalkomposition Dürers hin-
gestellt wird. Das mag sein. Aber schon der ganze
mythologische Apparat, das Satyrpaar links, die auf
Delphinen reitenden Genien, die Nereiden, die Mäd-
chengruppe im Hintergrunde in ihren italienisch po-
sierenden Stellungen lassen verschiedene Einzelvor-
bilder voraussetzen, die er in Venedig gefunden
haben mußte. Das Satyrenpaar läßt sich fast in der-
selben Stellung in dem Skizzenbuche des Jacopo Bel-
lini im Louvre wiederfinden.2 Wickhoff und Weisbach wiesen ebenfalls versuchsweise auf einzelne
antike Anregungen hin.3 Während aber Weisbach für die Gesamtkomposition einen poetischen Mvthus
in italienisch-humanistischer Fassung annimmt, glaube
ich auch hier nur ein kompilatorisches Zusammen-
tragen antiker Motive zu erkennen, freilich im Sinne
einer Komposition, ein wenn auch noch schwerfälli-
ges Aufjubeln in einer neuen Formenwelt. Die ganze
Darstellung leidet an einer Überfülle von kompositio-
neilen Teilen und Figuren, die sich zu Wasser und
zu Lande bis in den hochgestellten Horizont hinein
häufen. Dies dürfte sich in einer Renaissancevorlage
kaum auffinden lassen, auch nicht in Oberitalien; denn
auch hier herrschte das gleiche Gesetz ausgeglichener
Verhältnisse und strengster Verteilung im Räume.
Auf dem zweiten Skizzenblatte in den Uffizien
(Fig. 20) finden sich gleichfalls die verschiedensten
Motive zusammen. Ein sitzendes Kind, aus einem ver-
loren gegangenem Bilde eines venezianischen Meisters
herauskopiert (am meisten verwandt mit einer Man-
sueti-Madonna in Verona); ein nackter Krieger mit
Schild, ein venezianischer Feldherr in voller Rüstung,
. Fig. 28. Grabmal des Dexileos.
wie wir ähnliche in dem Skizzenbuche des Jakob , , x.
Athen, Nationalmuseum.
1 Auch Weisbach (a. a. O., S. 47) dachte hier an eine quattrocentistische Apollodarstellung, der eine Erosstatue zugrunde
lag, und wies auf die elegante Stellung der Figur, das Gewand mit den flatternden Bändern und die preziöse Art des Bogen-
haltens hin und ebenso auf den Umstand, daß dieses Motiv auch anderweitig von florentinischen Künstlern, und zwar in der-
selben Stellung des schlanken jugendlichen Körpers und nur mit anderer Bogenhaltung, verwendet wurde, z. B. in einer Dar-
stellung des Triumphes der Liebe und des Todes von Francesco Pesellino bei Mrs. Gardner in Boston (siehe Taf. XIII in W.
Weisbachs Fr. Pesellino und Text, S. 75).
a Die Skizzenbücher Jacopo Bellinis, herausg. v. V. Golubew II, Taf. XXXV. Der musizierende Faun spukt im ganzen
venezianischen Gebiete, u. a. bei dem gleichfalls nach Mantegna kopierenden Ben. Montagna, hier auf einem Horn blasend
und nach rechts schreitend (B. 17).
3 Wickhoff, a. a. O. I, S. 420. — Weisbach, a, a. O., S. 47.
XXX. 3o