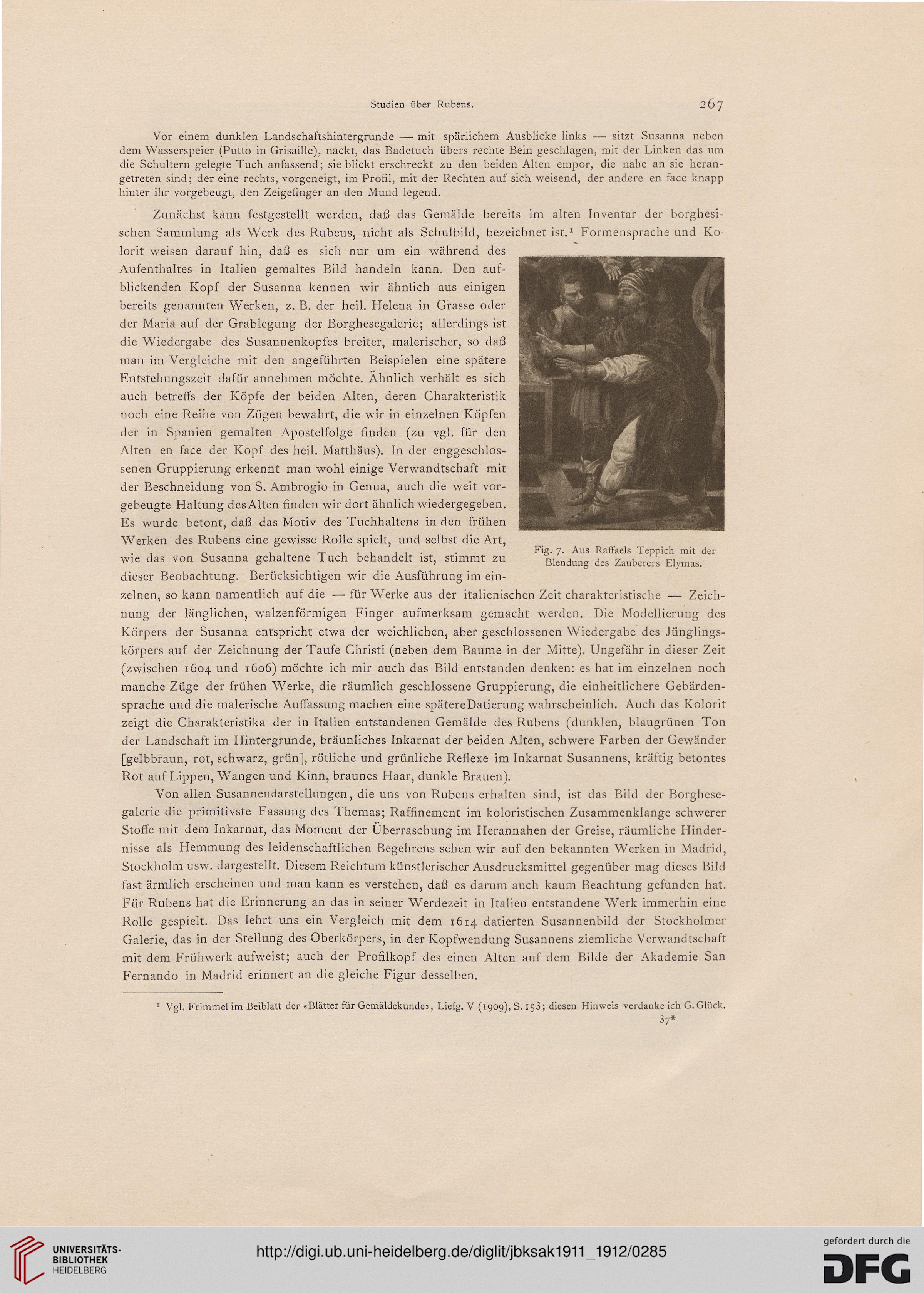Studien über Rubens.
267
Vor einem dunklen Landschaftshintergrunde — mit spärlichem Ausblicke links — sitzt Susanna neben
dem Wasserspeier (Putto in Grisaille), nackt, das Badetuch übers rechte Bein geschlagen, mit der Linken das um
die Schultern gelegte Tuch anfassend; sie blickt erschreckt zu den beiden Alten empor, die nahe an sie heran-
getreten sind; der eine rechts, vorgeneigt, im Profil, mit der Rechten auf sich weisend, der andere en face knapp
hinter ihr vorgebeugt, den Zeigefinger an den Mund legend.
Zunächst kann festgestellt werden, daß das Gemälde bereits im alten Inventar der borghesi-
schen Sammlung als Werk des Rubens, nicht als Schulbild, bezeichnet ist.1 Formensprache und Ko-
lorit weisen darauf hin, daß es sich nur um ein während des ....... _
Aufenthaltes in Italien gemaltes Bild handeln kann. Den auf-
blickenden Kopf der Susanna kennen wir ähnlich aus einigen
bereits genannten Werken, z. B. der heil. Helena in Grasse oder
der Maria auf der Grablegung der Borghesegalerie; allerdings ist
die Wiedergabe des Susannenkopfes breiter, malerischer, so daß
man im Vergleiche mit den angeführten Beispielen eine spätere
Entstehungszeit dafür annehmen möchte. Ahnlich verhält es sich
auch betreffs der Köpfe der beiden Alten, deren Charakteristik
noch eine Reibe von Zügen bewahrt, die wir in einzelnen Köpfen
der in Spanien gemalten Apostelfolge finden (zu vgl. für den
Alten en face der Kopf des heil. Matthäus). In der enggeschlos-
senen Gruppierung erkennt man wohl einige Verwandtschaft mit
der Beschneidung von S. Ambrogio in Genua, auch die weit vor-
gebeugte Haltung des Alten finden wir dort ähnlich wiedergegeben.
Es wurde betont, daß das Motiv des Tuchhaltens in den frühen
Werken des Rubens eine gewisse Rolle spielt, und selbst die Art,
wie das von Susanna gehaltene Tuch behandelt ist, stimmt zu
dieser Beobachtung. Berücksichtigen wir die Ausführung im ein-
zelnen, so kann namentlich auf die — für W'erke aus der italienischen Zeit charakteristische — Zeich-
nung der länglichen, walzenförmigen Finger aufmerksam gemacht werden. Die Modellierung des
Körpers der Susanna entspricht etwa der weichlichen, aber geschlossenen Wiedergabe des Jünglings-
körpers auf der Zeichnung der Taufe Christi (neben dem Baume in der Mitte). Ungefähr in dieser Zeit
(zwischen 1604 und 1606) möchte ich mir auch das Bild entstanden denken: es hat im einzelnen noch
manche Züge der frühen Werke, die räumlich geschlossene Gruppierung, die einheitlichere Gebärden-
sprache und die malerische Auffassung machen eine spätereDatierung wahrscheinlich. Auch das Kolorit
zeigt die Charakteristika der in Italien entstandenen Gemälde des Rubens (dunklen, blaugrünen Ton
der Landschaft im Hintergrunde, bräunliches Inkarnat der beiden Alten, schwere Farben der Gewänder
[gelbbraun, rot, schwarz, grün], rötliche und grünliche Reflexe im Inkarnat Susannens, kräftig betontes
Rot auf Lippen, Wangen und Kinn, braunes Haar, dunkle Brauen).
Von allen Susannendarstellungen, die uns von Rubens erhalten sind, ist das Bild der Borghese-
galerie die primitivste Fassung des Themas; Raffinement im koloristischen Zusammenklange schwerer
Stoffe mit dem Inkarnat, das Moment der Überraschung im Herannahen der Greise, räumliche Hinder-
nisse als Hemmung des leidenschaftlichen Begehrens sehen wir auf den bekannten Werken in Madrid,
Stockholm usw. dargestellt. Diesem Reichtum künstlerischer Ausdrucksmittel gegenüber mag dieses Bild
fast ärmlich erscheinen und man kann es verstehen, daß es darum auch kaum Beachtung gefunden hat.
Für Rubens hat die Erinnerung an das in seiner Werdezeit in Italien entstandene Werk immerhin eine
Rolle gespielt. Das lehrt uns ein Vergleich mit dem 1614 datierten Susannenbild der Stockholmer
Galerie, das in der Stellung des Oberkörpers, in der Kopfwendung Susannens ziemliche Verwandtschaft
mit dem Frühwerk aufweist; auch der Profilkopf des einen Alten auf dem Bilde der Akademie San
Fernando in Madrid erinnert an die gleiche Figur desselben.
Fig. 7. Aus Raffaels Teppich mit der
Blendung des Zauberers Elymas.
1 Vgl. Frimmel im Beiblatt der «Blätter für Gemäldekunde», Liefg. V (1909), S. 153; diesen Hinweis verdanke ich G. Glück.
37*
267
Vor einem dunklen Landschaftshintergrunde — mit spärlichem Ausblicke links — sitzt Susanna neben
dem Wasserspeier (Putto in Grisaille), nackt, das Badetuch übers rechte Bein geschlagen, mit der Linken das um
die Schultern gelegte Tuch anfassend; sie blickt erschreckt zu den beiden Alten empor, die nahe an sie heran-
getreten sind; der eine rechts, vorgeneigt, im Profil, mit der Rechten auf sich weisend, der andere en face knapp
hinter ihr vorgebeugt, den Zeigefinger an den Mund legend.
Zunächst kann festgestellt werden, daß das Gemälde bereits im alten Inventar der borghesi-
schen Sammlung als Werk des Rubens, nicht als Schulbild, bezeichnet ist.1 Formensprache und Ko-
lorit weisen darauf hin, daß es sich nur um ein während des ....... _
Aufenthaltes in Italien gemaltes Bild handeln kann. Den auf-
blickenden Kopf der Susanna kennen wir ähnlich aus einigen
bereits genannten Werken, z. B. der heil. Helena in Grasse oder
der Maria auf der Grablegung der Borghesegalerie; allerdings ist
die Wiedergabe des Susannenkopfes breiter, malerischer, so daß
man im Vergleiche mit den angeführten Beispielen eine spätere
Entstehungszeit dafür annehmen möchte. Ahnlich verhält es sich
auch betreffs der Köpfe der beiden Alten, deren Charakteristik
noch eine Reibe von Zügen bewahrt, die wir in einzelnen Köpfen
der in Spanien gemalten Apostelfolge finden (zu vgl. für den
Alten en face der Kopf des heil. Matthäus). In der enggeschlos-
senen Gruppierung erkennt man wohl einige Verwandtschaft mit
der Beschneidung von S. Ambrogio in Genua, auch die weit vor-
gebeugte Haltung des Alten finden wir dort ähnlich wiedergegeben.
Es wurde betont, daß das Motiv des Tuchhaltens in den frühen
Werken des Rubens eine gewisse Rolle spielt, und selbst die Art,
wie das von Susanna gehaltene Tuch behandelt ist, stimmt zu
dieser Beobachtung. Berücksichtigen wir die Ausführung im ein-
zelnen, so kann namentlich auf die — für W'erke aus der italienischen Zeit charakteristische — Zeich-
nung der länglichen, walzenförmigen Finger aufmerksam gemacht werden. Die Modellierung des
Körpers der Susanna entspricht etwa der weichlichen, aber geschlossenen Wiedergabe des Jünglings-
körpers auf der Zeichnung der Taufe Christi (neben dem Baume in der Mitte). Ungefähr in dieser Zeit
(zwischen 1604 und 1606) möchte ich mir auch das Bild entstanden denken: es hat im einzelnen noch
manche Züge der frühen Werke, die räumlich geschlossene Gruppierung, die einheitlichere Gebärden-
sprache und die malerische Auffassung machen eine spätereDatierung wahrscheinlich. Auch das Kolorit
zeigt die Charakteristika der in Italien entstandenen Gemälde des Rubens (dunklen, blaugrünen Ton
der Landschaft im Hintergrunde, bräunliches Inkarnat der beiden Alten, schwere Farben der Gewänder
[gelbbraun, rot, schwarz, grün], rötliche und grünliche Reflexe im Inkarnat Susannens, kräftig betontes
Rot auf Lippen, Wangen und Kinn, braunes Haar, dunkle Brauen).
Von allen Susannendarstellungen, die uns von Rubens erhalten sind, ist das Bild der Borghese-
galerie die primitivste Fassung des Themas; Raffinement im koloristischen Zusammenklange schwerer
Stoffe mit dem Inkarnat, das Moment der Überraschung im Herannahen der Greise, räumliche Hinder-
nisse als Hemmung des leidenschaftlichen Begehrens sehen wir auf den bekannten Werken in Madrid,
Stockholm usw. dargestellt. Diesem Reichtum künstlerischer Ausdrucksmittel gegenüber mag dieses Bild
fast ärmlich erscheinen und man kann es verstehen, daß es darum auch kaum Beachtung gefunden hat.
Für Rubens hat die Erinnerung an das in seiner Werdezeit in Italien entstandene Werk immerhin eine
Rolle gespielt. Das lehrt uns ein Vergleich mit dem 1614 datierten Susannenbild der Stockholmer
Galerie, das in der Stellung des Oberkörpers, in der Kopfwendung Susannens ziemliche Verwandtschaft
mit dem Frühwerk aufweist; auch der Profilkopf des einen Alten auf dem Bilde der Akademie San
Fernando in Madrid erinnert an die gleiche Figur desselben.
Fig. 7. Aus Raffaels Teppich mit der
Blendung des Zauberers Elymas.
1 Vgl. Frimmel im Beiblatt der «Blätter für Gemäldekunde», Liefg. V (1909), S. 153; diesen Hinweis verdanke ich G. Glück.
37*