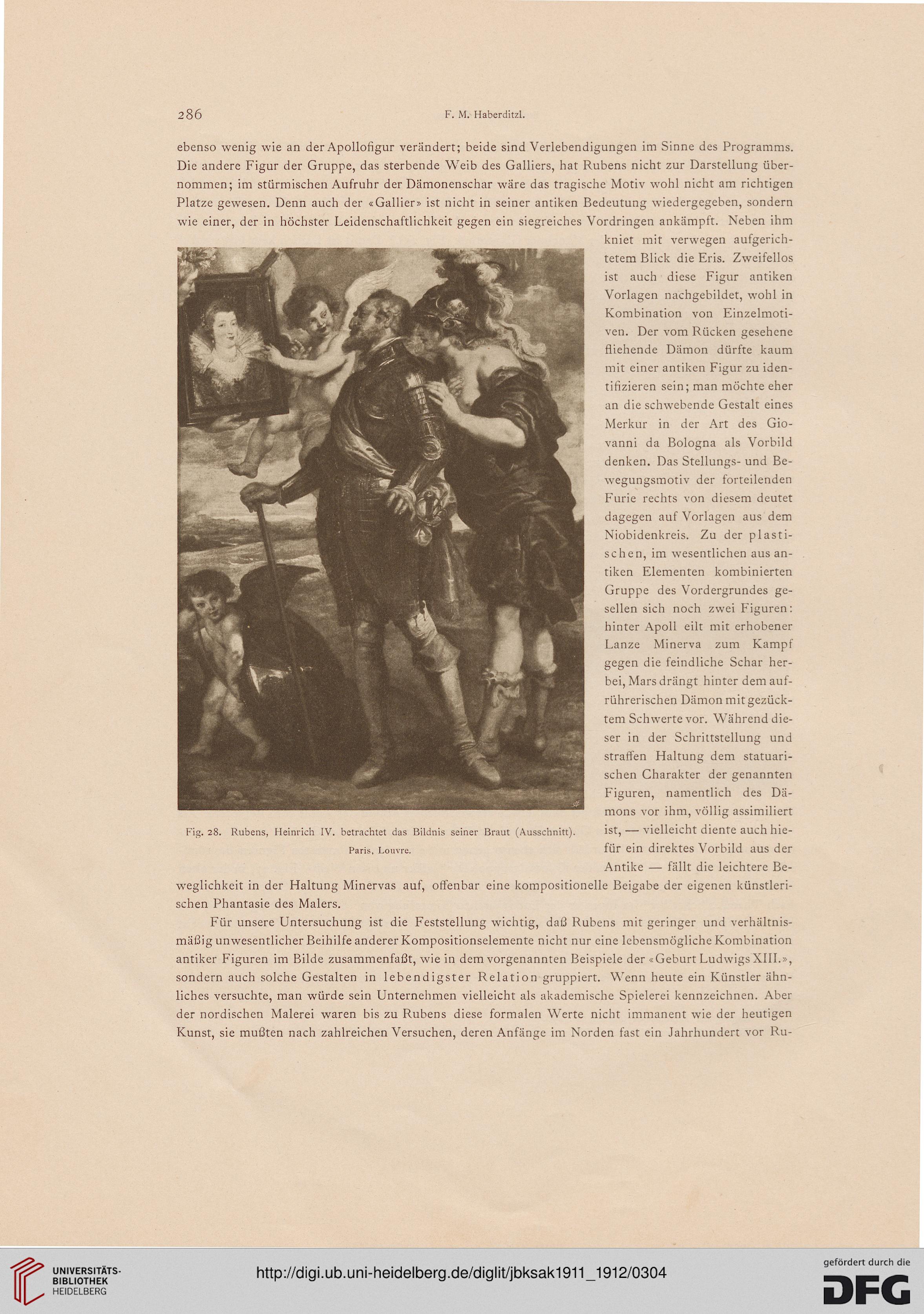286
F. M. Haberditzl.
ebenso wenig wie an der Apollofigur verändert; beide sind Verlebendigungen im Sinne des Programms.
Die andere Figur der Gruppe, das sterbende Weib des Galliers, hat Rubens nicht zur Darstellung über-
nommen; im stürmischen Aufruhr der Dämonenschar wäre das tragische Motiv wohl nicht am richtigen
Platze gewesen. Denn auch der «Gallier» ist nicht in seiner antiken Bedeutung wiedergegeben, sondern
wie einer, der in höchster Leidenschaftlichkeit gegen ein siegreiches Vordringen ankämpft. Neben ihm
kniet mit verwegen aufgerich-
tetem Blick die Eris. Zweifellos
ist auch diese Figur antiken
Vorlagen nachgebildet, wohl in
Kombination von Einzelmoti-
ven. Der vom Rücken gesehene
fliehende Dämon dürfte kaum
mit einer antiken Figur zu iden-
tifizieren sein; man möchte eher
an die schwebende Gestalt eines
Merkur in der Art des Gio-
vanni da Bologna als Vorbild
denken. Das Stellungs- und Be-
wegungsmotiv der forteilenden
Furie rechts von diesem deutet
dagegen auf Vorlagen aus dem
Niobidenkreis. Zu der plasti-
schen, im wesentlichen aus an-
tiken Elementen kombinierten
Gruppe des Vordergrundes ge-
sellen sich noch zwei Figuren:
hinter Apoll eilt mit erhobener
Lanze Minerva zum Kampf
gegen die feindliche Schar her-
bei, Mars drängt hinter dem auf-
rührerischen Dämon mit gezück-
tem Schwerte vor. Während die-
ser in der Schrittstellung und
straffen Haltung dem statuari-
schen Charakter der genannten
Figuren, namentlich des Dä-
mons vor ihm, völlig assimiliert
ist, — vielleicht diente auch hie-
für ein direktes Vorbild aus der
Antike — fällt die leichtere Be-
weglichkeit in der Haltung Minervas auf, offenbar eine kompositioneile Beigabe der eigenen künstleri-
schen Phantasie des Malers.
Für unsere Untersuchung ist die Feststellung wichtig, daß Rubens mit geringer und verhältnis-
mäßig unwesentlicher Beihilfe anderer Kompositionselemente nicht nur eine lebensmögliche Kombination
antiker Figuren im Bilde zusammenfaßt, wie in dem vorgenannten Beispiele der «Geburt Ludwigs XIII.»,
sondern auch solche Gestalten in lebendigster Relation gruppiert. Wenn heute ein Künstler ähn-
liches versuchte, man würde sein Unternehmen vielleicht als akademische Spielerei kennzeichnen. Aber
der nordischen Malerei waren bis zu Rubens diese formalen Werte nicht immanent wie der heutigen
Kunst, sie mußten nach zahlreichen Versuchen, deren Anfänge im Norden fast ein Jahrhundert vor Ru-
rig. 28. Rubens, Heinrich IV. betrachtet das Bildnis seiner Braut (Ausschnitt).
Paris, Louvre.
F. M. Haberditzl.
ebenso wenig wie an der Apollofigur verändert; beide sind Verlebendigungen im Sinne des Programms.
Die andere Figur der Gruppe, das sterbende Weib des Galliers, hat Rubens nicht zur Darstellung über-
nommen; im stürmischen Aufruhr der Dämonenschar wäre das tragische Motiv wohl nicht am richtigen
Platze gewesen. Denn auch der «Gallier» ist nicht in seiner antiken Bedeutung wiedergegeben, sondern
wie einer, der in höchster Leidenschaftlichkeit gegen ein siegreiches Vordringen ankämpft. Neben ihm
kniet mit verwegen aufgerich-
tetem Blick die Eris. Zweifellos
ist auch diese Figur antiken
Vorlagen nachgebildet, wohl in
Kombination von Einzelmoti-
ven. Der vom Rücken gesehene
fliehende Dämon dürfte kaum
mit einer antiken Figur zu iden-
tifizieren sein; man möchte eher
an die schwebende Gestalt eines
Merkur in der Art des Gio-
vanni da Bologna als Vorbild
denken. Das Stellungs- und Be-
wegungsmotiv der forteilenden
Furie rechts von diesem deutet
dagegen auf Vorlagen aus dem
Niobidenkreis. Zu der plasti-
schen, im wesentlichen aus an-
tiken Elementen kombinierten
Gruppe des Vordergrundes ge-
sellen sich noch zwei Figuren:
hinter Apoll eilt mit erhobener
Lanze Minerva zum Kampf
gegen die feindliche Schar her-
bei, Mars drängt hinter dem auf-
rührerischen Dämon mit gezück-
tem Schwerte vor. Während die-
ser in der Schrittstellung und
straffen Haltung dem statuari-
schen Charakter der genannten
Figuren, namentlich des Dä-
mons vor ihm, völlig assimiliert
ist, — vielleicht diente auch hie-
für ein direktes Vorbild aus der
Antike — fällt die leichtere Be-
weglichkeit in der Haltung Minervas auf, offenbar eine kompositioneile Beigabe der eigenen künstleri-
schen Phantasie des Malers.
Für unsere Untersuchung ist die Feststellung wichtig, daß Rubens mit geringer und verhältnis-
mäßig unwesentlicher Beihilfe anderer Kompositionselemente nicht nur eine lebensmögliche Kombination
antiker Figuren im Bilde zusammenfaßt, wie in dem vorgenannten Beispiele der «Geburt Ludwigs XIII.»,
sondern auch solche Gestalten in lebendigster Relation gruppiert. Wenn heute ein Künstler ähn-
liches versuchte, man würde sein Unternehmen vielleicht als akademische Spielerei kennzeichnen. Aber
der nordischen Malerei waren bis zu Rubens diese formalen Werte nicht immanent wie der heutigen
Kunst, sie mußten nach zahlreichen Versuchen, deren Anfänge im Norden fast ein Jahrhundert vor Ru-
rig. 28. Rubens, Heinrich IV. betrachtet das Bildnis seiner Braut (Ausschnitt).
Paris, Louvre.