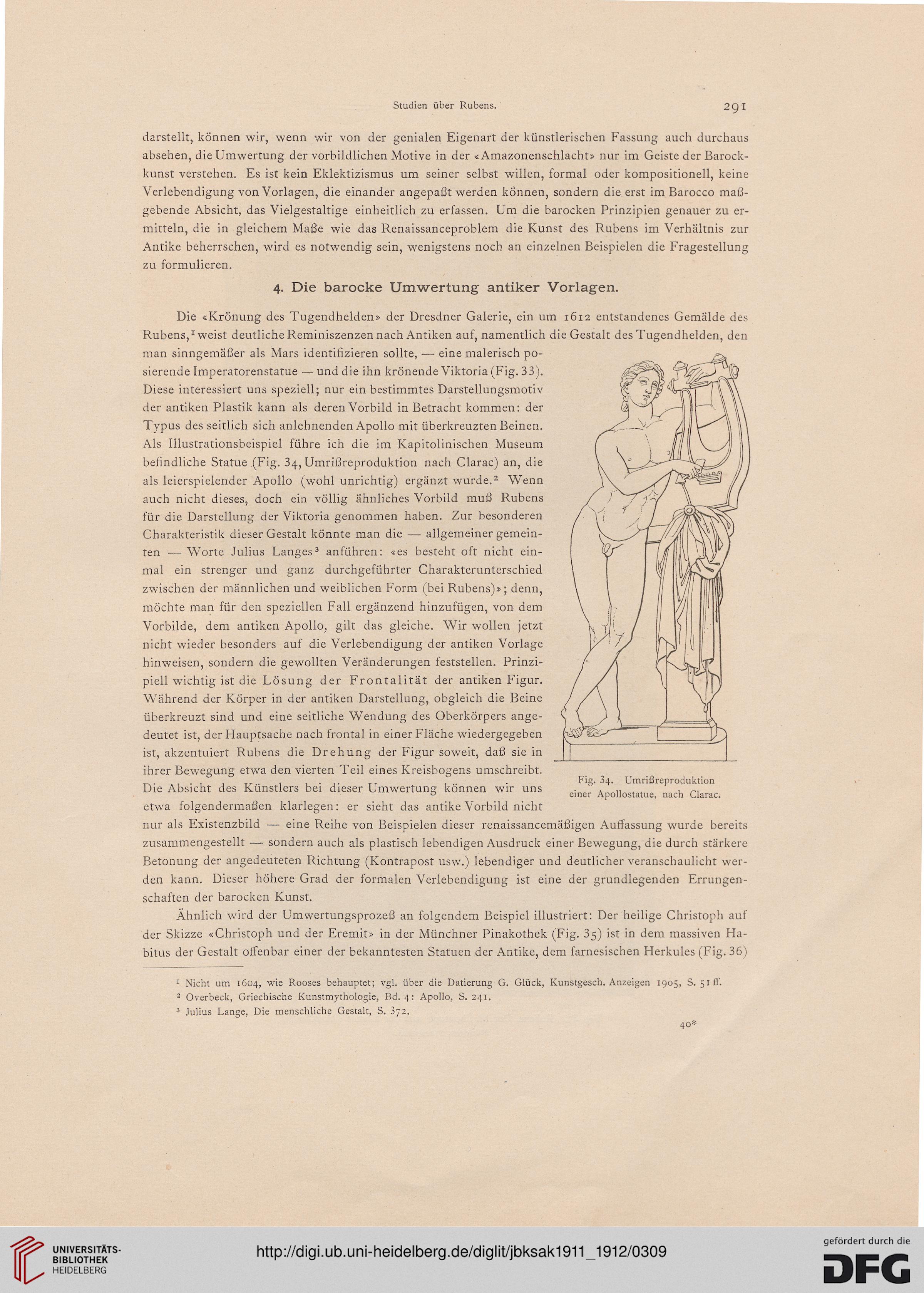Studien über Rubens.
29I
darstellt, können wir, wenn wir von der genialen Eigenart der künstlerischen Fassung auch durchaus
absehen, die Umwertung der vorbildlichen Motive in der < Amazonenschlacht» nur im Geiste der Barock-
kunst verstehen. Es ist kein Eklektizismus um seiner selbst willen, formal oder kompositionell, keine
Verlebendigung von Vorlagen, die einander angepaßt werden können, sondern die erst im Barocco maß-
gebende Absicht, das Vielgestaltige einheitlich zu erfassen. Um die barocken Prinzipien genauer zu er-
mitteln, die in gleichem Maße wie das Renaissanceproblem die Kunst des Rubens im Verhältnis zur
Antike beherrschen, wird es notwendig sein, wenigstens noch an einzelnen Beispielen die Fragestellung
zu formulieren.
4. Die barocke Umwertung antiker Vorlagen.
Die «Krönung des Tugendhelden» der Dresdner Galerie, ein um 1612 entstandenes Gemälde des
Rubens,1 weist deutliche Reminiszenzen nach Antiken auf, namentlich die Gestalt des Tugendhelden, den
man sinngemäßer als Mars identifizieren sollte, — eine malerisch po-
sierende Imperatorenstatue — und die ihn krönende Viktoria (Fig. 33).
Diese interessiert uns speziell; nur ein bestimmtes Darstellungsmotiv
der antiken Plastik kann als deren Vorbild in Betracht kommen: der
Typus des seitlich sich anlehnenden Apollo mit überkreuzten Beinen.
Als Illustrationsbeispiel führe ich die im Kapitolinischen Museum
befindliche Statue (Fig. 34, Umrißreproduktion nach Clarac) an, die
als leierspielender Apollo (wohl unrichtig) ergänzt wurde.2 Wenn
auch nicht dieses, doch ein völlig ähnliches Vorbild muß Rubens
für die Darstellung der Viktoria genommen haben. Zur besonderen
Charakteristik dieser Gestalt könnte man die — allgemeiner gemein-
ten — Worte Julius Langes3 anführen: «es besteht oft nicht ein-
mal ein strenger und ganz durchgeführter Charakterunterschied
zwischen der männlichen und weiblichen Form (bei Rubens)»; denn,
möchte man für den speziellen Fall ergänzend hinzufügen, von dem
Vorbilde, dem antiken Apollo, gilt das gleiche. Wir wollen jetzt
nicht wieder besonders auf die Verlebendigung der antiken Vorlage
hinweisen, sondern die gewollten Veränderungen feststellen. Prinzi-
piell wichtig ist die Lösung der Frontalität der antiken Figur.
Während der Körper in der antiken Darstellung, obgleich die Beine
überkreuzt sind und eine seitliche Wendung des Oberkörpers ange-
deutet ist, der Hauptsache nach frontal in einer Fläche wiedergegeben
ist, akzentuiert Rubens die Drehung der Figur soweit, daß sie in
ihrer Bewegung etwa den vierten Teil eines Kreisbogens umschreibt.
Die Absicht des Künstlers bei dieser Umwertung können wir uns
etwa folgendermaßen klarlegen: er sieht das antike Vorbild nicht
nur als Existenzbild — eine Reihe von Beispielen dieser renaissancemäßigen Auffassung wurde bereits
zusammengestellt — sondern auch als plastisch lebendigen Ausdruck einer Bewegung, die durch stärkere
Betonung der angedeuteten Richtung (Kontrapost usw.) lebendiger und deutlicher veranschaulicht wer-
den kann. Dieser höhere Grad der formalen Verlebendigung ist eine der grundlegenden Errungen-
schaften der barocken Kunst.
Ähnlich wird der Umwertungsprozeß an folgendem Beispiel illustriert: Der heilige Christoph auf
der Skizze «Christoph und der Eremit» in der Münchner Pinakothek (Fig. 35) ist in dem massiven Ha-
bitus der Gestalt offenbar einer der bekanntesten Statuen der Antike, dem farnesischen Herkules (Fig. 36)
Fig. 34. Umrißreproduktion
einer Apollostatue, nach Clarac.
1 Nicht um 1604, wie Rooses behauptet; vgl. über die Datierung G. Glück, Kunstgesch, Anzeigen 1905, S. 518".
2 Overbeck, Griechische Kunstmythologie, Bd. 4: Apollo, S. 241.
3 Julius Lange, Die menschliche Gestalt, S. 3;2.
40*
29I
darstellt, können wir, wenn wir von der genialen Eigenart der künstlerischen Fassung auch durchaus
absehen, die Umwertung der vorbildlichen Motive in der < Amazonenschlacht» nur im Geiste der Barock-
kunst verstehen. Es ist kein Eklektizismus um seiner selbst willen, formal oder kompositionell, keine
Verlebendigung von Vorlagen, die einander angepaßt werden können, sondern die erst im Barocco maß-
gebende Absicht, das Vielgestaltige einheitlich zu erfassen. Um die barocken Prinzipien genauer zu er-
mitteln, die in gleichem Maße wie das Renaissanceproblem die Kunst des Rubens im Verhältnis zur
Antike beherrschen, wird es notwendig sein, wenigstens noch an einzelnen Beispielen die Fragestellung
zu formulieren.
4. Die barocke Umwertung antiker Vorlagen.
Die «Krönung des Tugendhelden» der Dresdner Galerie, ein um 1612 entstandenes Gemälde des
Rubens,1 weist deutliche Reminiszenzen nach Antiken auf, namentlich die Gestalt des Tugendhelden, den
man sinngemäßer als Mars identifizieren sollte, — eine malerisch po-
sierende Imperatorenstatue — und die ihn krönende Viktoria (Fig. 33).
Diese interessiert uns speziell; nur ein bestimmtes Darstellungsmotiv
der antiken Plastik kann als deren Vorbild in Betracht kommen: der
Typus des seitlich sich anlehnenden Apollo mit überkreuzten Beinen.
Als Illustrationsbeispiel führe ich die im Kapitolinischen Museum
befindliche Statue (Fig. 34, Umrißreproduktion nach Clarac) an, die
als leierspielender Apollo (wohl unrichtig) ergänzt wurde.2 Wenn
auch nicht dieses, doch ein völlig ähnliches Vorbild muß Rubens
für die Darstellung der Viktoria genommen haben. Zur besonderen
Charakteristik dieser Gestalt könnte man die — allgemeiner gemein-
ten — Worte Julius Langes3 anführen: «es besteht oft nicht ein-
mal ein strenger und ganz durchgeführter Charakterunterschied
zwischen der männlichen und weiblichen Form (bei Rubens)»; denn,
möchte man für den speziellen Fall ergänzend hinzufügen, von dem
Vorbilde, dem antiken Apollo, gilt das gleiche. Wir wollen jetzt
nicht wieder besonders auf die Verlebendigung der antiken Vorlage
hinweisen, sondern die gewollten Veränderungen feststellen. Prinzi-
piell wichtig ist die Lösung der Frontalität der antiken Figur.
Während der Körper in der antiken Darstellung, obgleich die Beine
überkreuzt sind und eine seitliche Wendung des Oberkörpers ange-
deutet ist, der Hauptsache nach frontal in einer Fläche wiedergegeben
ist, akzentuiert Rubens die Drehung der Figur soweit, daß sie in
ihrer Bewegung etwa den vierten Teil eines Kreisbogens umschreibt.
Die Absicht des Künstlers bei dieser Umwertung können wir uns
etwa folgendermaßen klarlegen: er sieht das antike Vorbild nicht
nur als Existenzbild — eine Reihe von Beispielen dieser renaissancemäßigen Auffassung wurde bereits
zusammengestellt — sondern auch als plastisch lebendigen Ausdruck einer Bewegung, die durch stärkere
Betonung der angedeuteten Richtung (Kontrapost usw.) lebendiger und deutlicher veranschaulicht wer-
den kann. Dieser höhere Grad der formalen Verlebendigung ist eine der grundlegenden Errungen-
schaften der barocken Kunst.
Ähnlich wird der Umwertungsprozeß an folgendem Beispiel illustriert: Der heilige Christoph auf
der Skizze «Christoph und der Eremit» in der Münchner Pinakothek (Fig. 35) ist in dem massiven Ha-
bitus der Gestalt offenbar einer der bekanntesten Statuen der Antike, dem farnesischen Herkules (Fig. 36)
Fig. 34. Umrißreproduktion
einer Apollostatue, nach Clarac.
1 Nicht um 1604, wie Rooses behauptet; vgl. über die Datierung G. Glück, Kunstgesch, Anzeigen 1905, S. 518".
2 Overbeck, Griechische Kunstmythologie, Bd. 4: Apollo, S. 241.
3 Julius Lange, Die menschliche Gestalt, S. 3;2.
40*