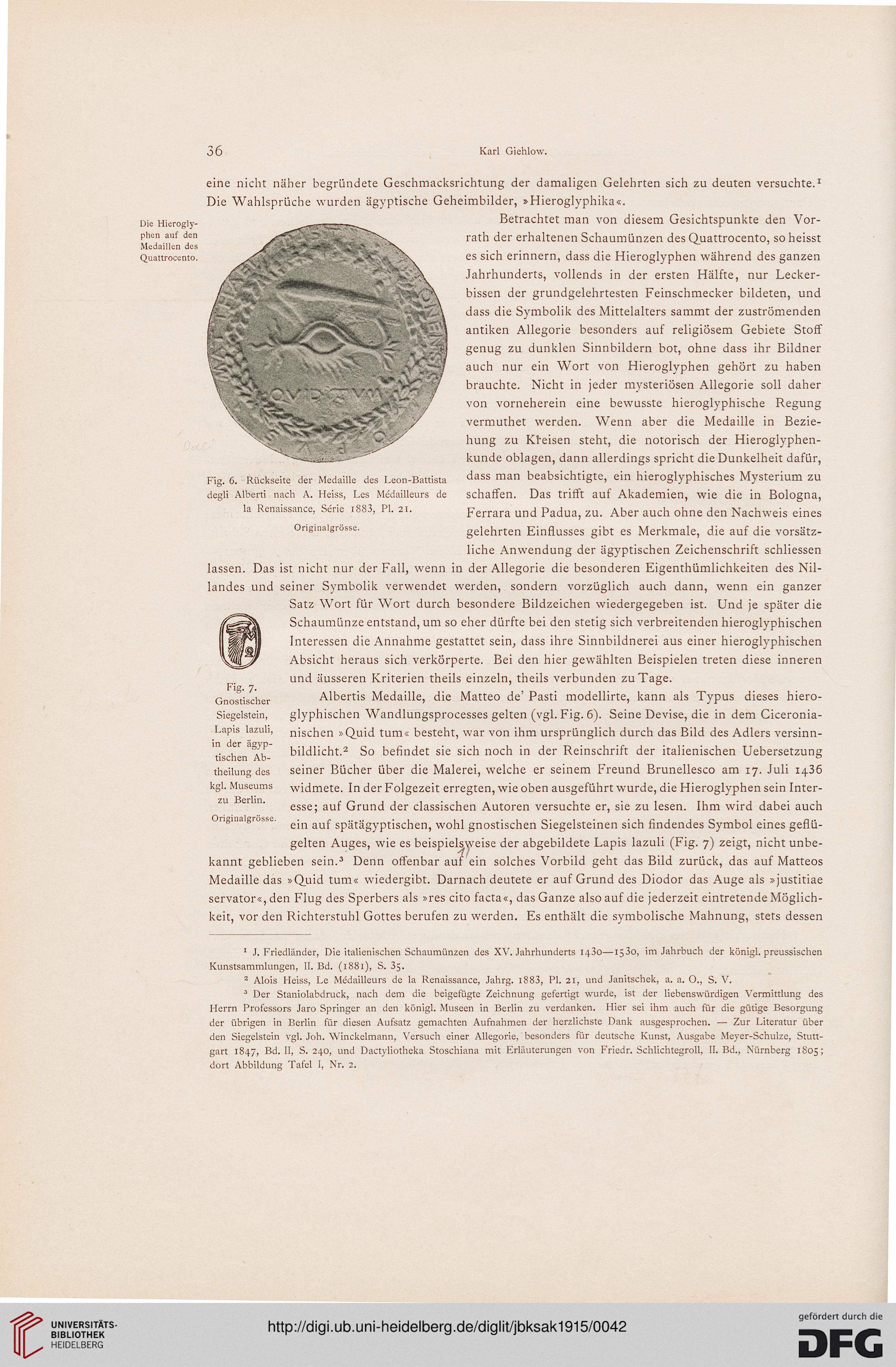36
Karl Giehlow.
Die Hierogly-
phen auf den
Medaillen des
Quattrocento.
1,1'.....■"•|»«»%5te
eine nicht näher begründete Geschmacksrichtung der damaligen Gelehrten sich zu deuten versuchte.1
Die Wahlsprüche wurden ägyptische Geheimbilder, »Hieroglyphika«.
Betrachtet man von diesem Gesichtspunkte den Vor-
rath der erhaltenen Schaumünzen des Quattrocento, so heisst
es sich erinnern, dass die Hieroglyphen während des ganzen
Jahrhunderts, vollends in der ersten Hälfte, nur Lecker-
bissen der grundgelehrtesten Feinschmecker bildeten, und
dass die Symbolik des Mittelalters sammt der zuströmenden
antiken Allegorie besonders auf religiösem Gebiete Stoff
genug zu dunklen Sinnbildern bot, ohne dass ihr Bildner
auch nur ein Wort von Hieroglyphen gehört zu haben
brauchte. Nicht in jeder mysteriösen Allegorie soll daher
von vorneherein eine bewusste hieroglyphische Regung
vermuthet werden. Wenn aber die Medaille in Bezie-
hung zu Kreisen steht, die notorisch der Hieroglyphen-
kunde oblagen, dann allerdings spricht die Dunkelheit dafür,
Fig. 6. Rückseite der Medaille des Leon-Battista dass man beabsichtigte, ein hieroglyphisches Mysterium zu
degli Alberti nach A. Heiss, Les Medailleurs de schaffen. Das trifft auf Akademien, wie die in Bologna,
la Renaissance, Serie i883, PI. 21. Ferrara und Padua, zu. Aber auch ohne den Nachweis eines
Ongmaigrosse. gelehrten Einflusses gibt es Merkmale, die auf die vorsätz-
liche Anwendung der ägyptischen Zeichenschrift schliessen
lassen. Das ist nicht nur der Fall, wenn in der Allegorie die besonderen Eigenthümlichkeiten des Nil-
landes und seiner Symbolik verwendet werden, sondern vorzüglich auch dann, wenn ein ganzer
Satz Wort für Wort durch besondere Bildzeichen wiedergegeben ist. Und je später die
Schaumünze entstand, um so eher dürfte bei den stetig sich verbreitenden hieroglyphischen
Interessen die Annahme gestattet sein, dass ihre Sinnbildnerei aus einer hieroglyphischen
Absicht heraus sich verkörperte. Bei den hier gewählten Beispielen treten diese inneren
und äusseren Kriterien theils einzeln, theils verbunden zu Tage.
Albertis Medaille, die Matteo de' Pasti modellirte, kann als Typus dieses hiero-
glyphischen Wandlungsprocesses gelten (vgl. Fig. 6). Seine Devise, die in dem Ciceronia-
nischen »Quid tum« besteht, war von ihm ursprünglich durch das Bild des Adlers versinn-
bildlicht.2 So befindet sie sich noch in der Reinschrift der italienischen Uebersetzung
seiner Bücher über die Malerei, welche er seinem Freund Brunellesco am 17. Juli 1436
widmete. In der Folgezeit erregten, wie oben ausgeführt wurde, die Hieroglyphen sein Inter-
esse; auf Grund der classischen Autoren versuchte er, sie zu lesen. Ihm wird dabei auch
ein auf spätägyptischen, wohl gnostischen Siegelsteinen sich findendes Symbol eines geflü-
gelten Auges, wie es beispielsweise der abgebildete Lapis lazuli (Fig. 7) zeigt, nicht unbe-
kannt geblieben sein.3 Denn offenbar auf ein solches Vorbild geht das Bild zurück, das auf Matteos
Medaille das »Quid tum« wiedergibt. Darnach deutete er auf Grund des Diodor das Auge als »justitiae
servator«, den Flug des Sperbers als »res cito facta«, das Ganze also auf die jederzeit eintretende Möglich-
keit, vor den Richterstuhl Gottes berufen zu werden. Es enthält die symbolische Mahnung, stets dessen
f ig- 7-
Gnostischer
Siegelstein,
Lapis lazuli,
in der ägyp-
tischen Ab-
theilung des
kgl. Museums
zu Berlin.
Originalgrösse.
1 J. Friedländer, Die italienischen Schaumünzen des XV. Jahrhunderts 1430—15^0, im Jahrbuch der königl. preussischen
Kunstsammlungen, II. Bd. (1881), S. 35.
2 Alois Heiss, Le Medailleurs de la Renaissance, Jahrg. 1883, PI. 21', und Janitschek, a. a. 0., S. V.
3 Der Staniolabdruck, nach dem die beigefügte Zeichnung gefertigt wurde, ist der liebenswürdigen Vermittlung des
Herrn Professors Jaro Springer an den königl. Museen in Berlin zu verdanken. Hier sei ihm auch für die gütige Besorgung
der übrigen in Berlin für diesen Aufsatz gemachten Aufnahmen der herzlichste Dank ausgesprochen. — Zur Literatur über
den Siegelstein vgl. Joh. Winckelmann, Versuch einer Allegorie, besonders für deutsche Kunst, Ausgabe Meyer-Schulze, Stutt-
gart 1847, Bd. II, S. 240, und Dactyliotheka Stoschiana mit Erläuterungen von Friedr. Schlichtegroll, II. Bd., Nürnberg 1805;
dort Abbildung Tafel I, Nr. 2.
Karl Giehlow.
Die Hierogly-
phen auf den
Medaillen des
Quattrocento.
1,1'.....■"•|»«»%5te
eine nicht näher begründete Geschmacksrichtung der damaligen Gelehrten sich zu deuten versuchte.1
Die Wahlsprüche wurden ägyptische Geheimbilder, »Hieroglyphika«.
Betrachtet man von diesem Gesichtspunkte den Vor-
rath der erhaltenen Schaumünzen des Quattrocento, so heisst
es sich erinnern, dass die Hieroglyphen während des ganzen
Jahrhunderts, vollends in der ersten Hälfte, nur Lecker-
bissen der grundgelehrtesten Feinschmecker bildeten, und
dass die Symbolik des Mittelalters sammt der zuströmenden
antiken Allegorie besonders auf religiösem Gebiete Stoff
genug zu dunklen Sinnbildern bot, ohne dass ihr Bildner
auch nur ein Wort von Hieroglyphen gehört zu haben
brauchte. Nicht in jeder mysteriösen Allegorie soll daher
von vorneherein eine bewusste hieroglyphische Regung
vermuthet werden. Wenn aber die Medaille in Bezie-
hung zu Kreisen steht, die notorisch der Hieroglyphen-
kunde oblagen, dann allerdings spricht die Dunkelheit dafür,
Fig. 6. Rückseite der Medaille des Leon-Battista dass man beabsichtigte, ein hieroglyphisches Mysterium zu
degli Alberti nach A. Heiss, Les Medailleurs de schaffen. Das trifft auf Akademien, wie die in Bologna,
la Renaissance, Serie i883, PI. 21. Ferrara und Padua, zu. Aber auch ohne den Nachweis eines
Ongmaigrosse. gelehrten Einflusses gibt es Merkmale, die auf die vorsätz-
liche Anwendung der ägyptischen Zeichenschrift schliessen
lassen. Das ist nicht nur der Fall, wenn in der Allegorie die besonderen Eigenthümlichkeiten des Nil-
landes und seiner Symbolik verwendet werden, sondern vorzüglich auch dann, wenn ein ganzer
Satz Wort für Wort durch besondere Bildzeichen wiedergegeben ist. Und je später die
Schaumünze entstand, um so eher dürfte bei den stetig sich verbreitenden hieroglyphischen
Interessen die Annahme gestattet sein, dass ihre Sinnbildnerei aus einer hieroglyphischen
Absicht heraus sich verkörperte. Bei den hier gewählten Beispielen treten diese inneren
und äusseren Kriterien theils einzeln, theils verbunden zu Tage.
Albertis Medaille, die Matteo de' Pasti modellirte, kann als Typus dieses hiero-
glyphischen Wandlungsprocesses gelten (vgl. Fig. 6). Seine Devise, die in dem Ciceronia-
nischen »Quid tum« besteht, war von ihm ursprünglich durch das Bild des Adlers versinn-
bildlicht.2 So befindet sie sich noch in der Reinschrift der italienischen Uebersetzung
seiner Bücher über die Malerei, welche er seinem Freund Brunellesco am 17. Juli 1436
widmete. In der Folgezeit erregten, wie oben ausgeführt wurde, die Hieroglyphen sein Inter-
esse; auf Grund der classischen Autoren versuchte er, sie zu lesen. Ihm wird dabei auch
ein auf spätägyptischen, wohl gnostischen Siegelsteinen sich findendes Symbol eines geflü-
gelten Auges, wie es beispielsweise der abgebildete Lapis lazuli (Fig. 7) zeigt, nicht unbe-
kannt geblieben sein.3 Denn offenbar auf ein solches Vorbild geht das Bild zurück, das auf Matteos
Medaille das »Quid tum« wiedergibt. Darnach deutete er auf Grund des Diodor das Auge als »justitiae
servator«, den Flug des Sperbers als »res cito facta«, das Ganze also auf die jederzeit eintretende Möglich-
keit, vor den Richterstuhl Gottes berufen zu werden. Es enthält die symbolische Mahnung, stets dessen
f ig- 7-
Gnostischer
Siegelstein,
Lapis lazuli,
in der ägyp-
tischen Ab-
theilung des
kgl. Museums
zu Berlin.
Originalgrösse.
1 J. Friedländer, Die italienischen Schaumünzen des XV. Jahrhunderts 1430—15^0, im Jahrbuch der königl. preussischen
Kunstsammlungen, II. Bd. (1881), S. 35.
2 Alois Heiss, Le Medailleurs de la Renaissance, Jahrg. 1883, PI. 21', und Janitschek, a. a. 0., S. V.
3 Der Staniolabdruck, nach dem die beigefügte Zeichnung gefertigt wurde, ist der liebenswürdigen Vermittlung des
Herrn Professors Jaro Springer an den königl. Museen in Berlin zu verdanken. Hier sei ihm auch für die gütige Besorgung
der übrigen in Berlin für diesen Aufsatz gemachten Aufnahmen der herzlichste Dank ausgesprochen. — Zur Literatur über
den Siegelstein vgl. Joh. Winckelmann, Versuch einer Allegorie, besonders für deutsche Kunst, Ausgabe Meyer-Schulze, Stutt-
gart 1847, Bd. II, S. 240, und Dactyliotheka Stoschiana mit Erläuterungen von Friedr. Schlichtegroll, II. Bd., Nürnberg 1805;
dort Abbildung Tafel I, Nr. 2.