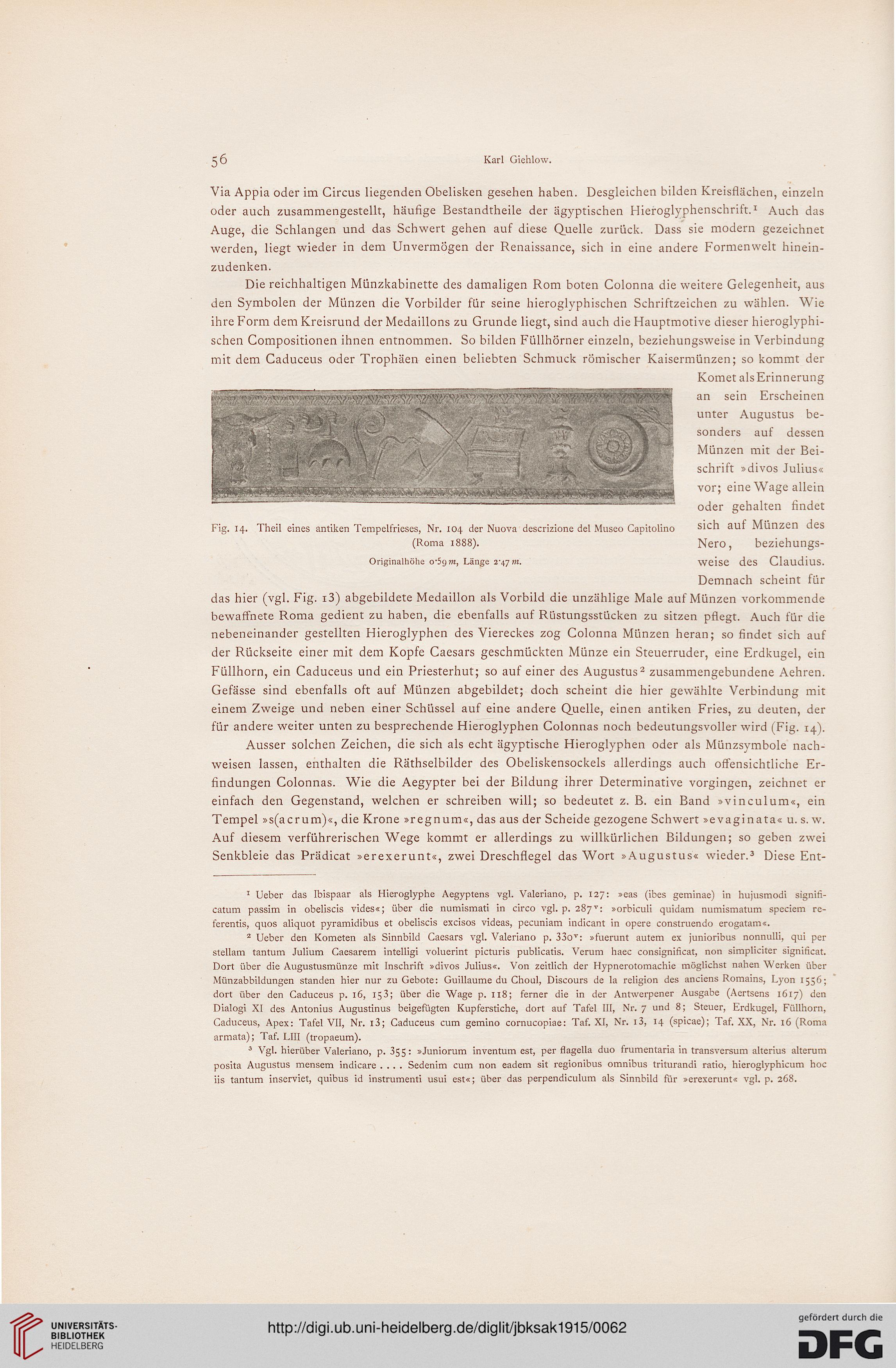56
Karl Giehlow.
Via Appia oder im Circus liegenden Obelisken gesehen haben. Desgleichen bilden Kreisflächen, einzeln
oder auch zusammengestellt, häufige Bestandteile der ägyptischen Hieroglyphenschrift.1 Auch das
Auge, die Schlangen und das Schwert gehen auf diese Quelle zurück. Dass sie modern gezeichnet
werden, liegt wieder in dem Unvermögen der Renaissance, sich in eine andere Formenwelt hinein-
zudenken.
Die reichhaltigen Münzkabinette des damaligen Rom boten Colonna die weitere Gelegenheit, aus
den Symbolen der Münzen die Vorbilder für seine hieroglyphischen Schriftzeichen zu wählen. Wie
ihre Form dem Kreisrund der Medaillons zu Grunde liegt, sind auch die Hauptmotive dieser hieroglyphi-
schen Compositionen ihnen entnommen. So bilden Füllhörner einzeln, beziehungsweise in Verbindung
mit dem Caduceus oder Trophäen einen beliebten Schmuck römischer Kaisermünzen; so kommt der
Komet alsErinnerung
an sein Erscheinen
unter Augustus be-
sonders auf dessen
Münzen mit der Bei-
schrift »divos Julius«
vor; eine Wage allein
oder gehalten findet
sich auf Münzen des
Nero, beziehungs-
weise des Claudius.
Demnach scheint für
das hier (vgl. Fig. i3) abgebildete Medaillon als Vorbild die unzählige Male auf Münzen vorkommende
bewaffnete Roma gedient zu haben, die ebenfalls auf Rüstungsstücken zu sitzen pflegt. Auch für die
nebeneinander gestellten Hieroglyphen des Viereckes zog Colonna Münzen heran; so findet sich auf
der Rückseite einer mit dem Kopfe Caesars geschmückten Münze ein Steuerruder, eine Erdkugel, ein
Füllhorn, ein Caduceus und ein Priesterhut; so auf einer des Augustus2 zusammengebundene Aehren.
Gefässe sind ebenfalls oft auf Münzen abgebildet; doch scheint die hier gewählte Verbindung mit
einem Zweige und neben einer Schüssel auf eine andere Quelle, einen antiken Fries, zu deuten, der
für andere weiter unten zu besprechende Hieroglyphen Colonnas noch bedeutungsvoller wird (Fig. 14).
Ausser solchen Zeichen, die sich als echt ägyptische Hieroglyphen oder als Münzsymbole nach-
weisen lassen, enthalten die Räthselbilder des Obeliskensockels allerdings auch offensichtliche Er-
findungen Colonnas. Wie die Aegypter bei der Bildung ihrer Determinative vorgingen, zeichnet er
einfach den Gegenstand, welchen er schreiben will; so bedeutet z. B. ein Band »vinculum«, ein
Tempel »s(acrum)«, die Krone »regnum«, das aus der Scheide gezogene Schwert »evaginata« u. s. w.
Auf diesem verführerischen Wege kommt er allerdings zu willkürlichen Bildungen; so geben zwei
Senkbleie das Prädicat »erexerunt«, zwei Dreschflegel das Wort »Augustus« wieder.3 Diese Ent-
Fig. 14. Theil eines antiken Tempelfrieses, Nr. 104 der Nuova descrizione del Museo Capitolino
(Roma 1888).
Originalhöhe o'5gm, Länge
1 Ueber das Ibispaar als Hieroglyphe Aegyptens vgl. Valeriano, p. 127: »eas (ibes geminae) in hujusmodi signifi-
catum passim in obeliscis vides«; über die numismati in circo vgl. p. 287': »orbiculi quidam numismatum speciem re-
ferentis, quos aliquot pyramidibus et obeliscis excisos videas, pecuniam indicant in opere construendo erogatam«.
2 Ueber den Kometen als Sinnbild Caesars vgl. Valeriano p. 33oT: »fuerunt autem ex junioribus nonnulli, qui per
stellam tantum Julium Caesarem intelligi voluerint picturis publicatis. Verum haec consignificat, non simpliciter significat.
Dort über die Augustusmünze mit Inschrift »divos Julius«. Von zeitlich der Hypnerotomachie möglichst nahen Werken über
Münzabbildungen standen hier nur zu Gebote: Guülaume du Choul, Discours de la religion des anciens Romains, Lyon 1556;
dort über den Caduceus p. 16, 15 3; über die Wage p. 118; ferner die in der Antwerpener Ausgabe (Aertsens 1617) den
Dialogi XI des Antonius Augustinus beigefügten Kupferstiche, dort auf Tafel III, Nr. 7 und 8; Steuer, Erdkugel, Füllhorn,
Caduceus, Apex: Tafel VII, Nr. l3; Caduceus cum gemino cornucopiae: Taf. XI, Nr. i3, 14 (spicae); Taf. XX, Nr. 16 (Roma
armata); Taf. LIII (tropaeum).
3 Vgl. hierüber Valeriano, p. 355: »Juniorum inventum est, per flagella duo frumentaria in transversum alterius alterum
posita Augustus mensem indicare .... Sedenim cum non eadem sit regionibus omnibus triturandi ratio, hieroglyphicum hoc
iis tantum inserviet, quibus id instrumenti usui est«; über das perpendiculum als Sinnbild für »erexerunt« vgl. p. 268.
Karl Giehlow.
Via Appia oder im Circus liegenden Obelisken gesehen haben. Desgleichen bilden Kreisflächen, einzeln
oder auch zusammengestellt, häufige Bestandteile der ägyptischen Hieroglyphenschrift.1 Auch das
Auge, die Schlangen und das Schwert gehen auf diese Quelle zurück. Dass sie modern gezeichnet
werden, liegt wieder in dem Unvermögen der Renaissance, sich in eine andere Formenwelt hinein-
zudenken.
Die reichhaltigen Münzkabinette des damaligen Rom boten Colonna die weitere Gelegenheit, aus
den Symbolen der Münzen die Vorbilder für seine hieroglyphischen Schriftzeichen zu wählen. Wie
ihre Form dem Kreisrund der Medaillons zu Grunde liegt, sind auch die Hauptmotive dieser hieroglyphi-
schen Compositionen ihnen entnommen. So bilden Füllhörner einzeln, beziehungsweise in Verbindung
mit dem Caduceus oder Trophäen einen beliebten Schmuck römischer Kaisermünzen; so kommt der
Komet alsErinnerung
an sein Erscheinen
unter Augustus be-
sonders auf dessen
Münzen mit der Bei-
schrift »divos Julius«
vor; eine Wage allein
oder gehalten findet
sich auf Münzen des
Nero, beziehungs-
weise des Claudius.
Demnach scheint für
das hier (vgl. Fig. i3) abgebildete Medaillon als Vorbild die unzählige Male auf Münzen vorkommende
bewaffnete Roma gedient zu haben, die ebenfalls auf Rüstungsstücken zu sitzen pflegt. Auch für die
nebeneinander gestellten Hieroglyphen des Viereckes zog Colonna Münzen heran; so findet sich auf
der Rückseite einer mit dem Kopfe Caesars geschmückten Münze ein Steuerruder, eine Erdkugel, ein
Füllhorn, ein Caduceus und ein Priesterhut; so auf einer des Augustus2 zusammengebundene Aehren.
Gefässe sind ebenfalls oft auf Münzen abgebildet; doch scheint die hier gewählte Verbindung mit
einem Zweige und neben einer Schüssel auf eine andere Quelle, einen antiken Fries, zu deuten, der
für andere weiter unten zu besprechende Hieroglyphen Colonnas noch bedeutungsvoller wird (Fig. 14).
Ausser solchen Zeichen, die sich als echt ägyptische Hieroglyphen oder als Münzsymbole nach-
weisen lassen, enthalten die Räthselbilder des Obeliskensockels allerdings auch offensichtliche Er-
findungen Colonnas. Wie die Aegypter bei der Bildung ihrer Determinative vorgingen, zeichnet er
einfach den Gegenstand, welchen er schreiben will; so bedeutet z. B. ein Band »vinculum«, ein
Tempel »s(acrum)«, die Krone »regnum«, das aus der Scheide gezogene Schwert »evaginata« u. s. w.
Auf diesem verführerischen Wege kommt er allerdings zu willkürlichen Bildungen; so geben zwei
Senkbleie das Prädicat »erexerunt«, zwei Dreschflegel das Wort »Augustus« wieder.3 Diese Ent-
Fig. 14. Theil eines antiken Tempelfrieses, Nr. 104 der Nuova descrizione del Museo Capitolino
(Roma 1888).
Originalhöhe o'5gm, Länge
1 Ueber das Ibispaar als Hieroglyphe Aegyptens vgl. Valeriano, p. 127: »eas (ibes geminae) in hujusmodi signifi-
catum passim in obeliscis vides«; über die numismati in circo vgl. p. 287': »orbiculi quidam numismatum speciem re-
ferentis, quos aliquot pyramidibus et obeliscis excisos videas, pecuniam indicant in opere construendo erogatam«.
2 Ueber den Kometen als Sinnbild Caesars vgl. Valeriano p. 33oT: »fuerunt autem ex junioribus nonnulli, qui per
stellam tantum Julium Caesarem intelligi voluerint picturis publicatis. Verum haec consignificat, non simpliciter significat.
Dort über die Augustusmünze mit Inschrift »divos Julius«. Von zeitlich der Hypnerotomachie möglichst nahen Werken über
Münzabbildungen standen hier nur zu Gebote: Guülaume du Choul, Discours de la religion des anciens Romains, Lyon 1556;
dort über den Caduceus p. 16, 15 3; über die Wage p. 118; ferner die in der Antwerpener Ausgabe (Aertsens 1617) den
Dialogi XI des Antonius Augustinus beigefügten Kupferstiche, dort auf Tafel III, Nr. 7 und 8; Steuer, Erdkugel, Füllhorn,
Caduceus, Apex: Tafel VII, Nr. l3; Caduceus cum gemino cornucopiae: Taf. XI, Nr. i3, 14 (spicae); Taf. XX, Nr. 16 (Roma
armata); Taf. LIII (tropaeum).
3 Vgl. hierüber Valeriano, p. 355: »Juniorum inventum est, per flagella duo frumentaria in transversum alterius alterum
posita Augustus mensem indicare .... Sedenim cum non eadem sit regionibus omnibus triturandi ratio, hieroglyphicum hoc
iis tantum inserviet, quibus id instrumenti usui est«; über das perpendiculum als Sinnbild für »erexerunt« vgl. p. 268.