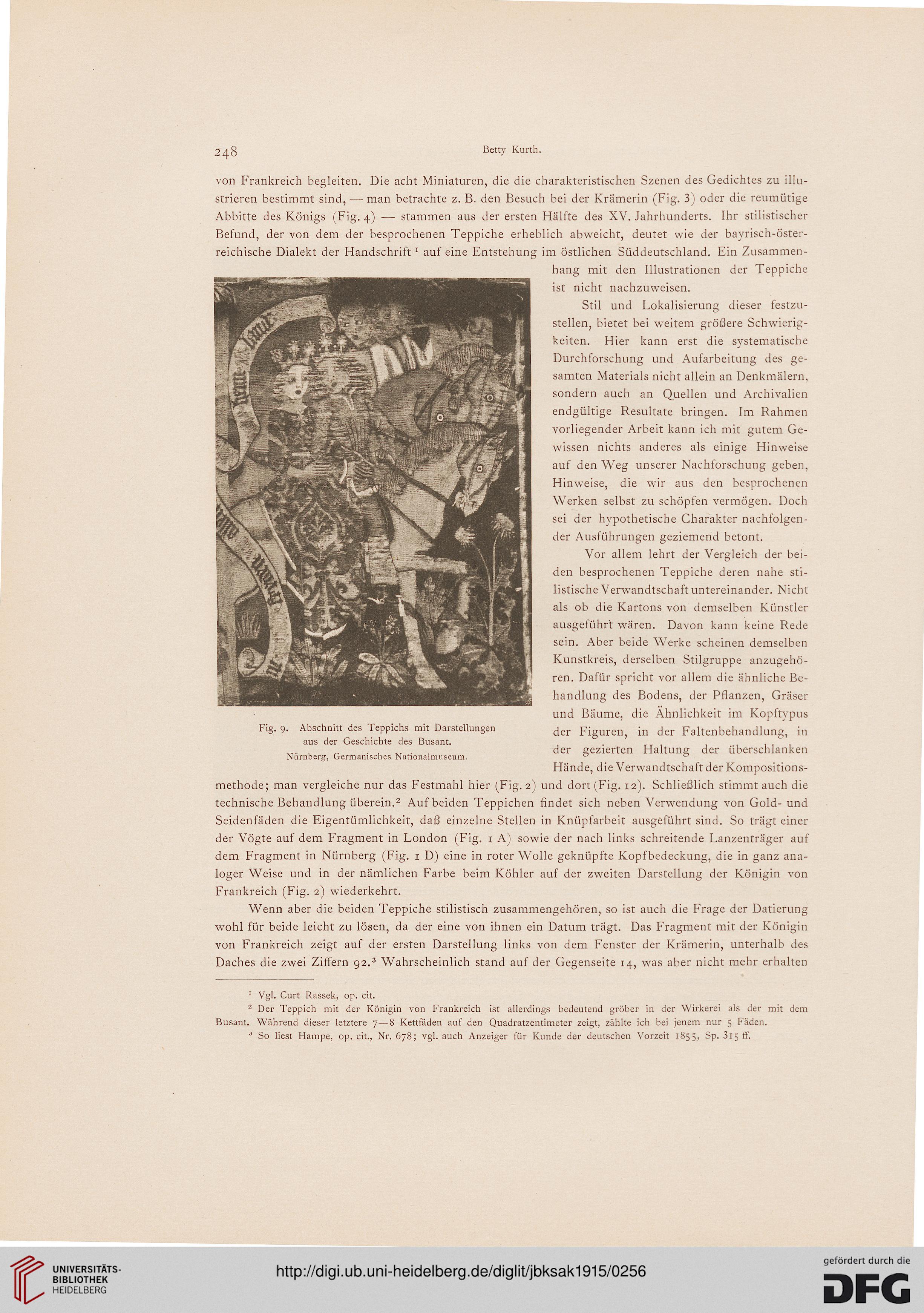2^g Betty Kurth.
von Frankreich begleiten. Die acht Miniaturen, die die charakteristischen Szenen des Gedichtes zu illu-
strieren bestimmt sind, — man betrachte z. B. den Besuch bei der Krämerin (Fig. 3) oder die reumütige
Abbitte des Königs (Fig. 4) — stammen aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Ihr stilistischer
Befund, der von dem der besprochenen Teppiche erheblich abweicht, deutet wie der bayrisch-öster-
reichische Dialekt der Handschrift1 auf eine Entstehung im östlichen Süddeutschland. Ein Zusammen-
hang mit den Illustrationen der Teppiche
ist nicht nachzuweisen.
Stil und Lokalisierung dieser festzu-
stellen, bietet bei weitem größere Schwierig-
keiten. Hier kann erst die systematische
Durchforschung und Aufarbeitung des ge-
samten Materials nicht allein an Denkmälern,
sondern auch an Quellen und Archivalien
endgültige Resultate bringen. Im Rahmen
vorliegender Arbeit kann ich mit gutem Ge-
wissen nichts anderes als einige Hinweise
auf den Weg unserer Nachforschung geben,
Hinweise, die wir aus den besprochenen
Werken selbst zu schöpfen vermögen. Doch
sei der hypothetische Charakter nachfolgen-
der Ausführungen geziemend betont.
Vor allem lehrt der Vergleich der bei-
den besprochenen Teppiche deren nahe sti-
listische Verwandtschaft untereinander. Nicht
als ob die Kartons von demselben Künstler
ausgeführt wären. Davon kann keine Rede
sein. Aber beide Werke scheinen demselben
Kunstkreis, derselben Stilgruppe anzugehö-
ren. Dafür spricht vor allem die ähnliche Be-
handlung des Bodens, der Pflanzen, Gräser
und Bäume, die Ähnlichkeit im Kopftypus
Fig. 9. Abschnitt des Teppichs mit Darstellungen der Figuren, in der Faltenbehandlung, in
aus der Geschichte des Busant.
. . . der gezierten Haltung der überschlanken
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum. ° °
Hände, die Verwandtschaft der Kompositions-
methode; man vergleiche nur das Festmahl hier (Fig. 2) und dort (Fig. 12). Schließlich stimmt auch die
technische Behandlung überein.2 Auf beiden Teppichen findet sich neben Verwendung von Gold- und
Seidenfäden die Eigentümlichkeit, daß einzelne Stellen in Knüpfarbeit ausgeführt sind. So trägt einer
der Vögte auf dem Fragment in London (Fig. 1 A) sowie der nach links schreitende Lanzenträger auf
dem Fragment in Nürnberg (Fig. 1 D) eine in roter Wolle geknüpfte Kopfbedeckung, die in ganz ana-
loger Weise und in der nämlichen Farbe beim Köhler auf der zweiten Darstellung der Königin von
Frankreich (Fig. 2) wiederkehrt.
Wenn aber die beiden Teppiche stilistisch zusammengehören, so ist auch die Frage der Datierung
wohl für beide leicht zu lösen, da der eine von ihnen ein Datum trägt. Das Fragment mit der Königin
von Frankreich zeigt auf der ersten Darstellung links von dem Fenster der Krämerin, unterhalb des
Daches die zwei Ziffern 92.3 Wahrscheinlich stand auf der Gegenseite 14, was aber nicht mehr erhalten
1 Vgl. Curt Rassek, op. cit.
2 Der Teppich mit der Königin von Frankreich ist allerdings bedeutend gröber in der Wirkerei als der mit dem
Busant. Während dieser letztere 7—8 Kettfäden auf den Quadratzentimeter zeigt, zählte ich bei jenem nur 5 Fäden.
3 So liest Hampe, op. cit., Nr. 678; vgl. auch Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1855, Sp. 3lj ff.
von Frankreich begleiten. Die acht Miniaturen, die die charakteristischen Szenen des Gedichtes zu illu-
strieren bestimmt sind, — man betrachte z. B. den Besuch bei der Krämerin (Fig. 3) oder die reumütige
Abbitte des Königs (Fig. 4) — stammen aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Ihr stilistischer
Befund, der von dem der besprochenen Teppiche erheblich abweicht, deutet wie der bayrisch-öster-
reichische Dialekt der Handschrift1 auf eine Entstehung im östlichen Süddeutschland. Ein Zusammen-
hang mit den Illustrationen der Teppiche
ist nicht nachzuweisen.
Stil und Lokalisierung dieser festzu-
stellen, bietet bei weitem größere Schwierig-
keiten. Hier kann erst die systematische
Durchforschung und Aufarbeitung des ge-
samten Materials nicht allein an Denkmälern,
sondern auch an Quellen und Archivalien
endgültige Resultate bringen. Im Rahmen
vorliegender Arbeit kann ich mit gutem Ge-
wissen nichts anderes als einige Hinweise
auf den Weg unserer Nachforschung geben,
Hinweise, die wir aus den besprochenen
Werken selbst zu schöpfen vermögen. Doch
sei der hypothetische Charakter nachfolgen-
der Ausführungen geziemend betont.
Vor allem lehrt der Vergleich der bei-
den besprochenen Teppiche deren nahe sti-
listische Verwandtschaft untereinander. Nicht
als ob die Kartons von demselben Künstler
ausgeführt wären. Davon kann keine Rede
sein. Aber beide Werke scheinen demselben
Kunstkreis, derselben Stilgruppe anzugehö-
ren. Dafür spricht vor allem die ähnliche Be-
handlung des Bodens, der Pflanzen, Gräser
und Bäume, die Ähnlichkeit im Kopftypus
Fig. 9. Abschnitt des Teppichs mit Darstellungen der Figuren, in der Faltenbehandlung, in
aus der Geschichte des Busant.
. . . der gezierten Haltung der überschlanken
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum. ° °
Hände, die Verwandtschaft der Kompositions-
methode; man vergleiche nur das Festmahl hier (Fig. 2) und dort (Fig. 12). Schließlich stimmt auch die
technische Behandlung überein.2 Auf beiden Teppichen findet sich neben Verwendung von Gold- und
Seidenfäden die Eigentümlichkeit, daß einzelne Stellen in Knüpfarbeit ausgeführt sind. So trägt einer
der Vögte auf dem Fragment in London (Fig. 1 A) sowie der nach links schreitende Lanzenträger auf
dem Fragment in Nürnberg (Fig. 1 D) eine in roter Wolle geknüpfte Kopfbedeckung, die in ganz ana-
loger Weise und in der nämlichen Farbe beim Köhler auf der zweiten Darstellung der Königin von
Frankreich (Fig. 2) wiederkehrt.
Wenn aber die beiden Teppiche stilistisch zusammengehören, so ist auch die Frage der Datierung
wohl für beide leicht zu lösen, da der eine von ihnen ein Datum trägt. Das Fragment mit der Königin
von Frankreich zeigt auf der ersten Darstellung links von dem Fenster der Krämerin, unterhalb des
Daches die zwei Ziffern 92.3 Wahrscheinlich stand auf der Gegenseite 14, was aber nicht mehr erhalten
1 Vgl. Curt Rassek, op. cit.
2 Der Teppich mit der Königin von Frankreich ist allerdings bedeutend gröber in der Wirkerei als der mit dem
Busant. Während dieser letztere 7—8 Kettfäden auf den Quadratzentimeter zeigt, zählte ich bei jenem nur 5 Fäden.
3 So liest Hampe, op. cit., Nr. 678; vgl. auch Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1855, Sp. 3lj ff.