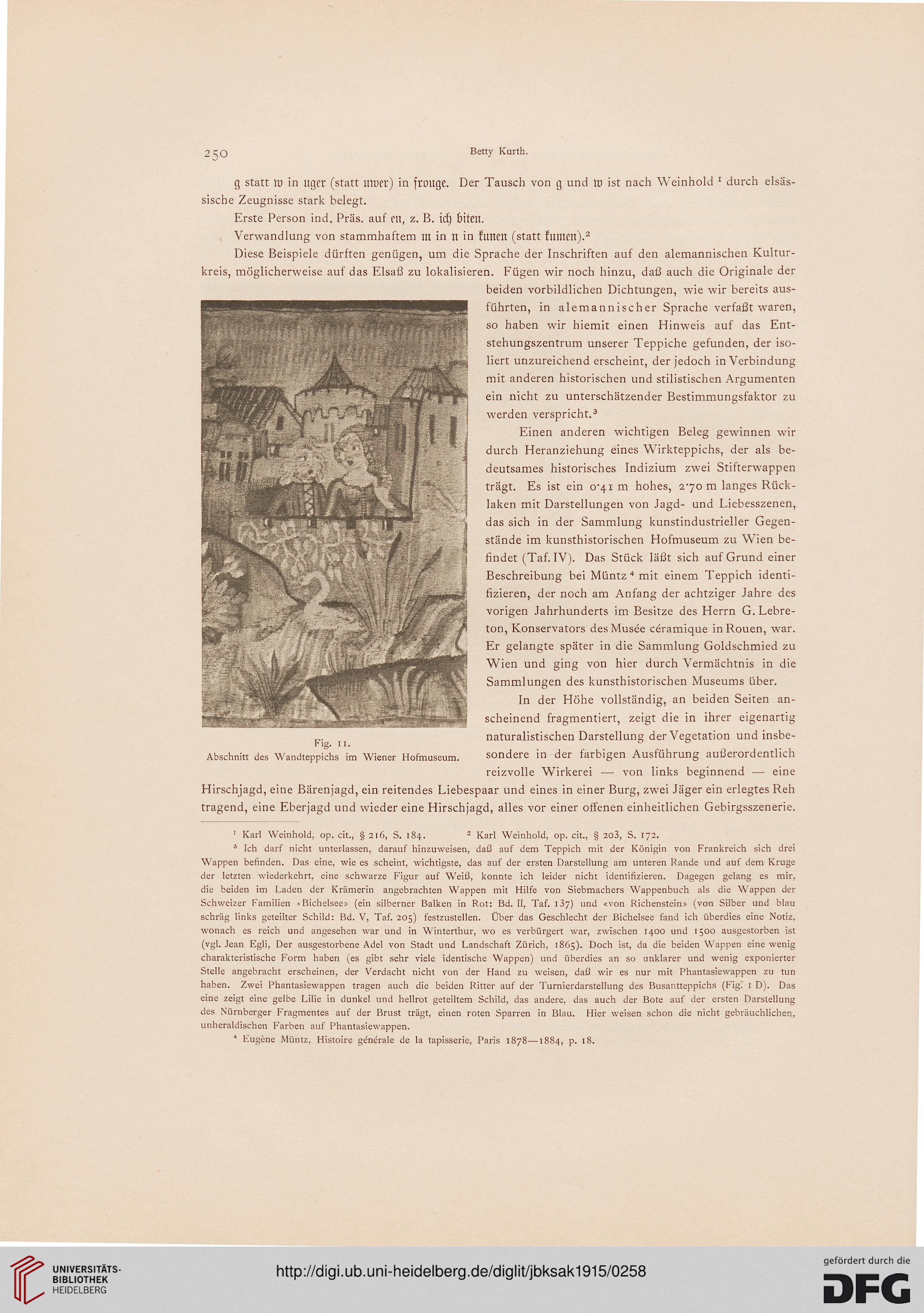250
Betty Kurth.
g statt 10 in ugcr (statt utuer) in froitge. Der Tausch von g und tu ist nach Weinhold 1 durch elsäs-
sische Zeugnisse stark belegt.
Erste Person ind. Präs. auf fit, z. B. id) btten.
Verwandlung von stammhaftem m in tt in futtert (statt funtctt).2
Diese Beispiele dürften genügen, um die Sprache der Inschriften auf den alemannischen Kultur-
kreis, möglicherweise auf das Elsaß zu lokalisieren. Fügen wir noch hinzu, daß auch die Originale der
beiden vorbildlichen Dichtungen, wie wir bereits aus-
führten, in alemannischer Sprache verfaßt waren,
so haben wir hiemit einen Hinweis auf das Ent-
stehungszentrum unserer Teppiche gefunden, der iso-
liert unzureichend erscheint, der jedoch in Verbindung
mit anderen historischen und stilistischen Argumenten
ein nicht zu unterschätzender Bestimmungsfaktor zu
werden verspricht.3
Einen anderen wichtigen Beleg gewinnen wir
durch Heranziehung eines Wirkteppichs, der als be-
deutsames historisches Indizium zwei Stifterwappen
trägt. Es ist ein 0-41 m hohes, 270 m langes Rück-
laken mit Darstellungen von Jagd- und Liebesszenen,
das sich in der Sammlung kunstindustrieller Gegen-
stände im kunsthistorischen Hofmuseum zu Wien be-
findet (Taf. IV). Das Stück läßt sich auf Grund einer
Beschreibung bei Müntz 4 mit einem Teppich identi-
fizieren, der noch am Anfang der achtziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts im Besitze des Herrn G. Lebre-
ton, Konservators desMusee ceramique inRouen, war.
Er gelangte später in die Sammlung Goldschmied zu
Wien und ging von hier durch Vermächtnis in die
Sammlungen des kunsthistorischen Museums über.
In der Höhe vollständig, an beiden Seiten an-
scheinend fragmentiert, zeigt die in ihrer eigenartig
naturalistischen Darstellung der Vegetation und insbe-
sondere in der farbigen Ausführung außerordentlich
reizvolle Wirkerei — von links beginnend — eine
Hirschjagd, eine Bärenjagd, ein reitendes Liebespaar und eines in einer Burg, zwei Jäger ein erlegtes Reh
tragend, eine Eberjagd und wieder eine Hirschjagd, alles vor einer offenen einheitlichen Gebirgsszenerie.
1 Karl Weinhold, op. cit., § 216, S. 184. • Karl Weinhold, op. cit., § 203, S. 172.
3 Ich darf nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß auf dem Teppich mit der Königin von Frankreich sich drei
Wappen befinden. Das eine, wie es scheint, wichtigste, das auf der ersten Darstellung am unteren Rande und auf dem Kruge
der letzten wiederkehrt, eine schwarze Figur auf Weiß, konnte ich leider nicht identifizieren. Dagegen gelang es mir,
die beiden im Laden der Krämerin angebrachten Wappen mit Hilfe von Siebmachers Wappenbuch als die Wappen der
Schweizer Familien «Bichelsee» (ein silberner Balken in Rot: Bd. II, Taf. 137) und «von Richenstein» (von Silber und blau
schräg links geteilter Schild: Bd. V, Taf. 205) festzustellen. Ober das Geschlecht der Bichelsee fand ich überdies eine Notiz,
wonach es reich und angesehen war und in Winterthur, wo es verbürgert war, zwischen 1400 und 1500 ausgestorben ist
(vgl. Jean Egli, Der ausgestorbene Adel von Stadt und Landschaft Zürich, 1865). Doch ist, da die beiden Wappen eine wenig
charakteristische Form haben (es gibt sehr viele identische Wappen) und überdies an so unklarer und wenig exponierter
Stelle angebracht erscheinen, der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, daß wir es nur mit Phantasiewappen zu tun
haben. Zwei Phantasiewappen tragen auch die beiden Ritter auf der Turnierdarstellung des Busantteppichs (Fig. 1 D). Das
eine zeigt eine gelbe Lilie in dunkel und hellrot geteiltem Schild, das andere, das auch der Bote auf der ersten Darstellung
des Nürnberger Fragmentes auf der Brust trägt, einen roten Sparren in Blau. Hier weisen schon die nicht gebräuchlichen,
unheraldischen Farben auf Phantasiewappen.
4 Eugene Müntz, Histoire generale de la tapisserie, Paris 1878—1884, p. 18.
Abschnitt des Wandteppichs im Wiener Hofmuseum.
Betty Kurth.
g statt 10 in ugcr (statt utuer) in froitge. Der Tausch von g und tu ist nach Weinhold 1 durch elsäs-
sische Zeugnisse stark belegt.
Erste Person ind. Präs. auf fit, z. B. id) btten.
Verwandlung von stammhaftem m in tt in futtert (statt funtctt).2
Diese Beispiele dürften genügen, um die Sprache der Inschriften auf den alemannischen Kultur-
kreis, möglicherweise auf das Elsaß zu lokalisieren. Fügen wir noch hinzu, daß auch die Originale der
beiden vorbildlichen Dichtungen, wie wir bereits aus-
führten, in alemannischer Sprache verfaßt waren,
so haben wir hiemit einen Hinweis auf das Ent-
stehungszentrum unserer Teppiche gefunden, der iso-
liert unzureichend erscheint, der jedoch in Verbindung
mit anderen historischen und stilistischen Argumenten
ein nicht zu unterschätzender Bestimmungsfaktor zu
werden verspricht.3
Einen anderen wichtigen Beleg gewinnen wir
durch Heranziehung eines Wirkteppichs, der als be-
deutsames historisches Indizium zwei Stifterwappen
trägt. Es ist ein 0-41 m hohes, 270 m langes Rück-
laken mit Darstellungen von Jagd- und Liebesszenen,
das sich in der Sammlung kunstindustrieller Gegen-
stände im kunsthistorischen Hofmuseum zu Wien be-
findet (Taf. IV). Das Stück läßt sich auf Grund einer
Beschreibung bei Müntz 4 mit einem Teppich identi-
fizieren, der noch am Anfang der achtziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts im Besitze des Herrn G. Lebre-
ton, Konservators desMusee ceramique inRouen, war.
Er gelangte später in die Sammlung Goldschmied zu
Wien und ging von hier durch Vermächtnis in die
Sammlungen des kunsthistorischen Museums über.
In der Höhe vollständig, an beiden Seiten an-
scheinend fragmentiert, zeigt die in ihrer eigenartig
naturalistischen Darstellung der Vegetation und insbe-
sondere in der farbigen Ausführung außerordentlich
reizvolle Wirkerei — von links beginnend — eine
Hirschjagd, eine Bärenjagd, ein reitendes Liebespaar und eines in einer Burg, zwei Jäger ein erlegtes Reh
tragend, eine Eberjagd und wieder eine Hirschjagd, alles vor einer offenen einheitlichen Gebirgsszenerie.
1 Karl Weinhold, op. cit., § 216, S. 184. • Karl Weinhold, op. cit., § 203, S. 172.
3 Ich darf nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß auf dem Teppich mit der Königin von Frankreich sich drei
Wappen befinden. Das eine, wie es scheint, wichtigste, das auf der ersten Darstellung am unteren Rande und auf dem Kruge
der letzten wiederkehrt, eine schwarze Figur auf Weiß, konnte ich leider nicht identifizieren. Dagegen gelang es mir,
die beiden im Laden der Krämerin angebrachten Wappen mit Hilfe von Siebmachers Wappenbuch als die Wappen der
Schweizer Familien «Bichelsee» (ein silberner Balken in Rot: Bd. II, Taf. 137) und «von Richenstein» (von Silber und blau
schräg links geteilter Schild: Bd. V, Taf. 205) festzustellen. Ober das Geschlecht der Bichelsee fand ich überdies eine Notiz,
wonach es reich und angesehen war und in Winterthur, wo es verbürgert war, zwischen 1400 und 1500 ausgestorben ist
(vgl. Jean Egli, Der ausgestorbene Adel von Stadt und Landschaft Zürich, 1865). Doch ist, da die beiden Wappen eine wenig
charakteristische Form haben (es gibt sehr viele identische Wappen) und überdies an so unklarer und wenig exponierter
Stelle angebracht erscheinen, der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, daß wir es nur mit Phantasiewappen zu tun
haben. Zwei Phantasiewappen tragen auch die beiden Ritter auf der Turnierdarstellung des Busantteppichs (Fig. 1 D). Das
eine zeigt eine gelbe Lilie in dunkel und hellrot geteiltem Schild, das andere, das auch der Bote auf der ersten Darstellung
des Nürnberger Fragmentes auf der Brust trägt, einen roten Sparren in Blau. Hier weisen schon die nicht gebräuchlichen,
unheraldischen Farben auf Phantasiewappen.
4 Eugene Müntz, Histoire generale de la tapisserie, Paris 1878—1884, p. 18.
Abschnitt des Wandteppichs im Wiener Hofmuseum.