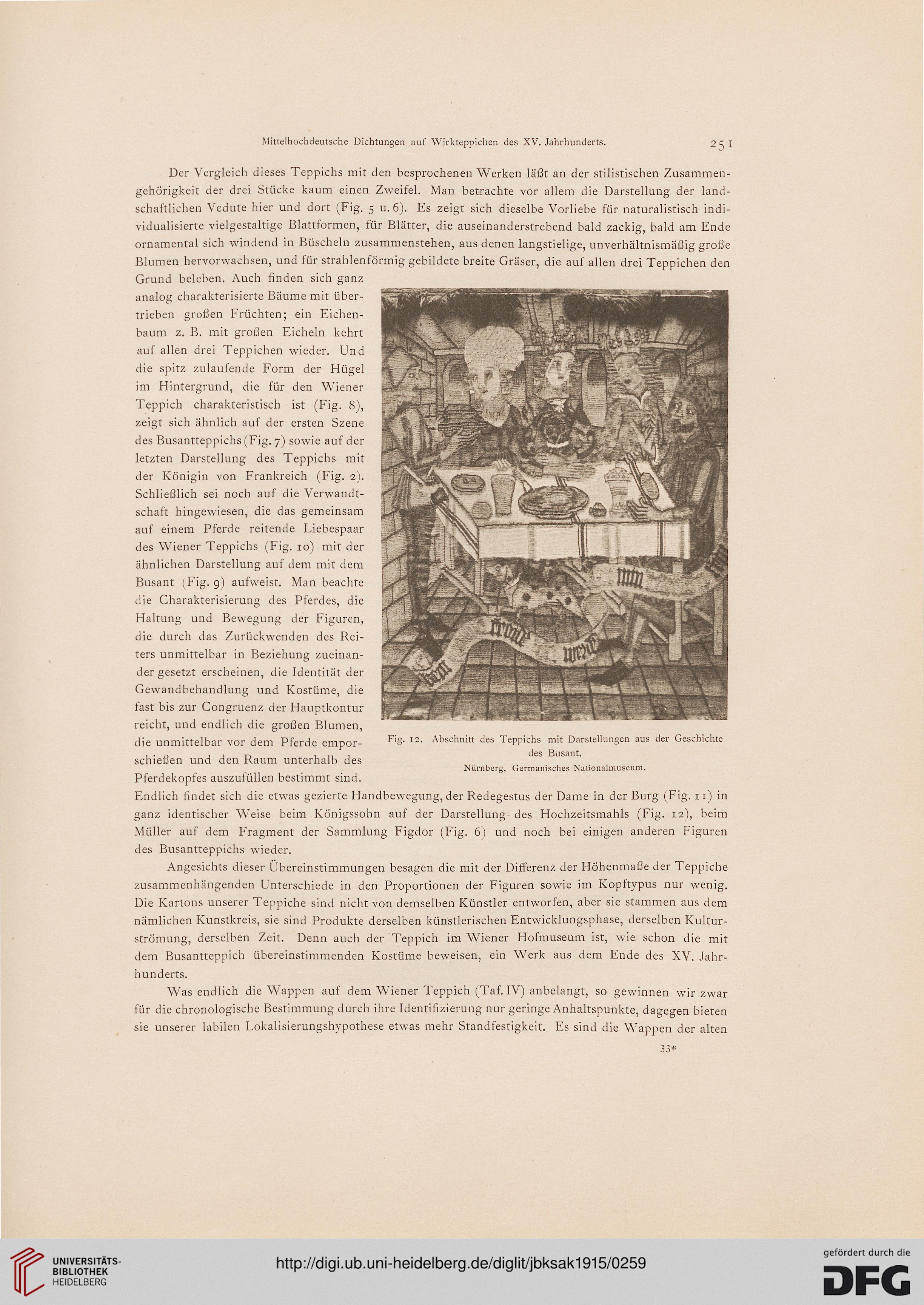Mittelhochdeutsche Dichtungen auf Wirkteppichen des XV. Jahrhunderts.
Der Vergleich dieses Teppichs mit den besprochenen Werken läßt an der stilistischen Zusammen-
gehörigkeit der drei Stücke kaum einen Zweifel. Man betrachte vor allem die Darstellung der land-
schaftlichen Vedute hier und dort (Fig. 5 u. 6). Es zeigt sich dieselbe Vorliebe für naturalistisch indi-
vidualisierte vielgestaltige Blattformen, für Blätter, die auseinanderstrebend bald zackig, bald am Ende
ornamental sich windend in Büscheln zusammenstehen, aus denen langstielige, unverhältnismäßig große
Blumen hervorwachsen, und für strahlenförmig gebildete breite Gräser, die auf allen drei Teppichen den
Grund beleben. Auch finden sich ganz
analog charakterisierte Bäume mit über-
trieben großen Früchten; ein Eichen-
baum z. B. mit großen Eicheln kehrt
auf allen drei Teppichen wieder. Und
die spitz zulaufende Form der Hügel
im Hintergrund, die für den Wiener
Teppich charakteristisch ist (Fig. 8),
zeigt sich ähnlich auf der ersten Szene
des Busantteppichs (Fig. 7) sowie auf der
letzten Darstellung des Teppichs mit
der Königin von Frankreich (Fig. 2).
Schließlich sei noch auf die Verwandt-
schaft hingewiesen, die das gemeinsam
auf einem Pferde reitende Liebespaar
des Wiener Teppichs (Fig. 10) mit der
ähnlichen Darstellung auf dem mit dem
Busant (Fig. 9) aufweist. Man beachte
die Charakterisierung des Pferdes, die
Haltung und Bewegung der Figuren,
die durch das Zurückwenden des Rei-
ters unmittelbar in Beziehung zueinan-
der gesetzt erscheinen, die Identität der
Gewandbehandlung und Kostüme, die
fast bis zur Congruenz der Hauptkontur
reicht, und endlich die großen Blumen,
die unmittelbar vor dem Pferde empor-
schießen und den Raum unterhalb des
Pferdekopfes auszufüllen bestimmt sind.
Endlich findet sich die etwas gezierte Handbewegung, der Redegestus der Dame in der Burg (Fig. 11) in
ganz identischer Weise beim Königssohn auf der Darstellung- des Hochzeitsmahls (Fig. 12), beim
Müller auf dem Fragment der Sammlung Figdor (Fig. 6) und noch bei einigen anderen Figuren
des Busantteppichs wieder.
Angesichts dieser Übereinstimmungen besagen die mit der Differenz der Höhenmaße der Teppiche
zusammenhängenden Unterschiede in den Proportionen der Figuren sowie im Kopftypus nur wenig.
Die Kartons unserer Teppiche sind nicht von demselben Künstler entworfen, aber sie stammen aus dem
nämlichen Kunstkreis, sie sind Produkte derselben künstlerischen Entwicklungsphase, derselben Kultur-
strömung, derselben Zeit. Denn auch der Teppich im Wiener Hofmuseum ist, wie schon die mit
dem Busantteppich übereinstimmenden Kostüme beweisen, ein Werk aus dem Ende des XV. Jahr-
hunderts.
Was endlich die Wappen auf dem Wiener Teppich (Taf. IV) anbelangt, so gewinnen wir zwar
für die chronologische Bestimmung durch ihre Identifizierung nur geringe Anhaltspunkte, dagegen bieten
sie unserer labilen Lokalisierungshypothese etwas mehr Standfestigkeit. Es sind die Wappen der alten
33*
Fig. 12. Abschnitt des Teppichs mit Darstellungen aus der Geschichte
des Busant.
Nürnberg, Germanisches Nutionalmuseum.
Der Vergleich dieses Teppichs mit den besprochenen Werken läßt an der stilistischen Zusammen-
gehörigkeit der drei Stücke kaum einen Zweifel. Man betrachte vor allem die Darstellung der land-
schaftlichen Vedute hier und dort (Fig. 5 u. 6). Es zeigt sich dieselbe Vorliebe für naturalistisch indi-
vidualisierte vielgestaltige Blattformen, für Blätter, die auseinanderstrebend bald zackig, bald am Ende
ornamental sich windend in Büscheln zusammenstehen, aus denen langstielige, unverhältnismäßig große
Blumen hervorwachsen, und für strahlenförmig gebildete breite Gräser, die auf allen drei Teppichen den
Grund beleben. Auch finden sich ganz
analog charakterisierte Bäume mit über-
trieben großen Früchten; ein Eichen-
baum z. B. mit großen Eicheln kehrt
auf allen drei Teppichen wieder. Und
die spitz zulaufende Form der Hügel
im Hintergrund, die für den Wiener
Teppich charakteristisch ist (Fig. 8),
zeigt sich ähnlich auf der ersten Szene
des Busantteppichs (Fig. 7) sowie auf der
letzten Darstellung des Teppichs mit
der Königin von Frankreich (Fig. 2).
Schließlich sei noch auf die Verwandt-
schaft hingewiesen, die das gemeinsam
auf einem Pferde reitende Liebespaar
des Wiener Teppichs (Fig. 10) mit der
ähnlichen Darstellung auf dem mit dem
Busant (Fig. 9) aufweist. Man beachte
die Charakterisierung des Pferdes, die
Haltung und Bewegung der Figuren,
die durch das Zurückwenden des Rei-
ters unmittelbar in Beziehung zueinan-
der gesetzt erscheinen, die Identität der
Gewandbehandlung und Kostüme, die
fast bis zur Congruenz der Hauptkontur
reicht, und endlich die großen Blumen,
die unmittelbar vor dem Pferde empor-
schießen und den Raum unterhalb des
Pferdekopfes auszufüllen bestimmt sind.
Endlich findet sich die etwas gezierte Handbewegung, der Redegestus der Dame in der Burg (Fig. 11) in
ganz identischer Weise beim Königssohn auf der Darstellung- des Hochzeitsmahls (Fig. 12), beim
Müller auf dem Fragment der Sammlung Figdor (Fig. 6) und noch bei einigen anderen Figuren
des Busantteppichs wieder.
Angesichts dieser Übereinstimmungen besagen die mit der Differenz der Höhenmaße der Teppiche
zusammenhängenden Unterschiede in den Proportionen der Figuren sowie im Kopftypus nur wenig.
Die Kartons unserer Teppiche sind nicht von demselben Künstler entworfen, aber sie stammen aus dem
nämlichen Kunstkreis, sie sind Produkte derselben künstlerischen Entwicklungsphase, derselben Kultur-
strömung, derselben Zeit. Denn auch der Teppich im Wiener Hofmuseum ist, wie schon die mit
dem Busantteppich übereinstimmenden Kostüme beweisen, ein Werk aus dem Ende des XV. Jahr-
hunderts.
Was endlich die Wappen auf dem Wiener Teppich (Taf. IV) anbelangt, so gewinnen wir zwar
für die chronologische Bestimmung durch ihre Identifizierung nur geringe Anhaltspunkte, dagegen bieten
sie unserer labilen Lokalisierungshypothese etwas mehr Standfestigkeit. Es sind die Wappen der alten
33*
Fig. 12. Abschnitt des Teppichs mit Darstellungen aus der Geschichte
des Busant.
Nürnberg, Germanisches Nutionalmuseum.