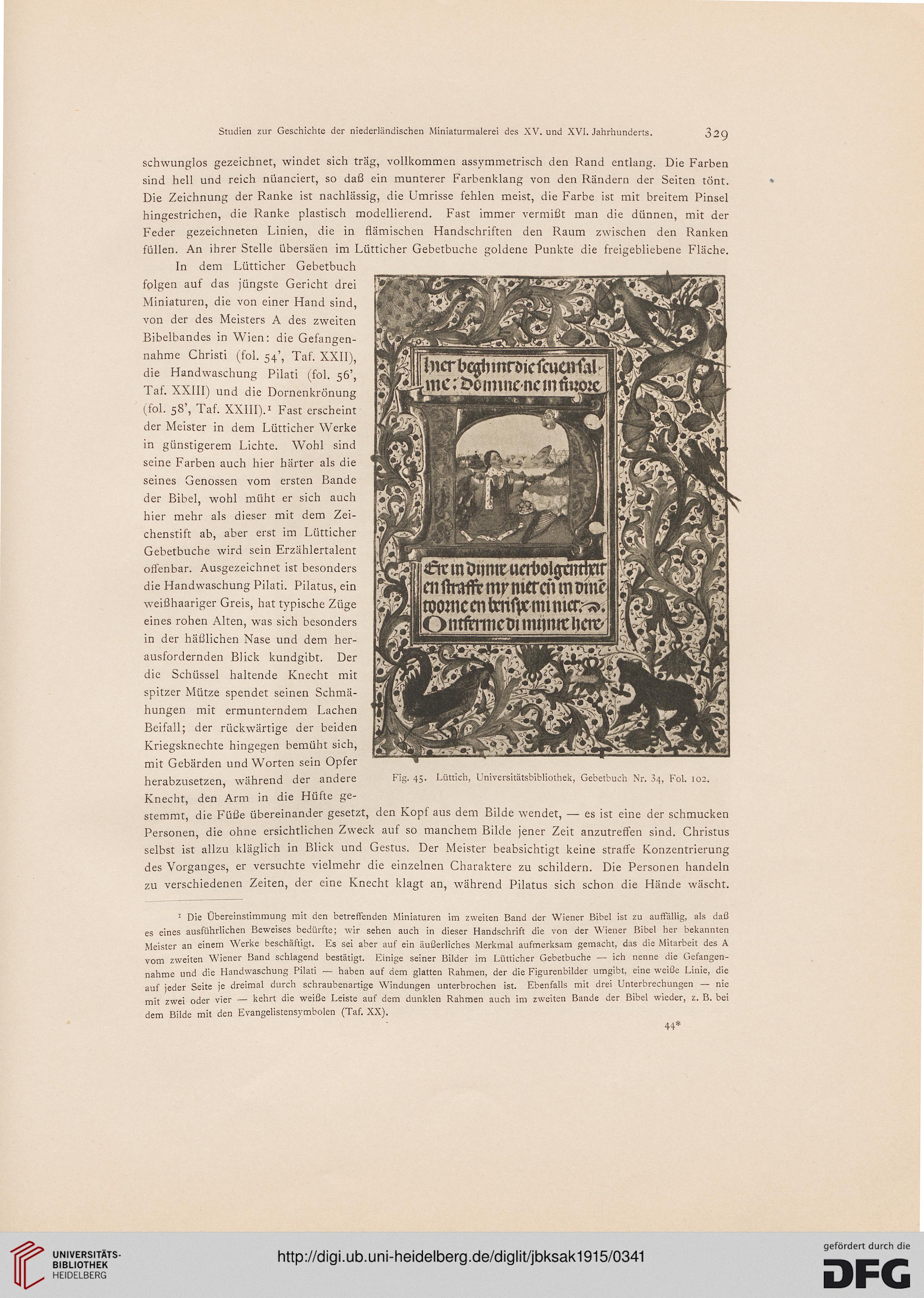Studien zur Geschichte der niederliindischen Miniaturmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts.
329
schwunglos gezeichnet, windet sich trag, vollkommen assymmetrisch den Rand entlang. Die Farben
sind hell und reich nuanciert, so daß ein munterer Farbenklang von den Rändern der Seiten tönt.
Die Zeichnung der Ranke ist nachlässig, die Umrisse fehlen meist, die Farbe ist mit breitem Pinsel
hingestrichen, die Ranke plastisch modellierend. Fast immer vermißt man die dünnen, mit der
Feder gezeichneten Linien, die in flämischen Handschriften den Raum zwischen den Ranken
füllen. An ihrer Stelle übersäen im Lütticher Gebetbuche goldene Punkte die freigebliebene Fläche.
In dem Lütticher Gebetbuch
folgen auf das jüngste Gericht drei [*a5HSr*5
Miniaturen, die von einer Hand sind,
von der des Meisters A des zweiten
Bibelbandes in Wien: die Gefangen-
nahme Christi (fol. 54', Taf. XXII),
die Handwaschung Pilati (fol. 56',
Taf. XXIII) und die Dornenkrönung
(fol. 58', Taf. XXIII).1 Fast erscheint
der Meister in dem Lütticher Werke
in günstigerem Lichte. Wohl sind
seine Farben auch hier härter als die
seines Genossen vom ersten Bande
der Bibel, wohl müht er sich auch
hier mehr als dieser mit dem Zei-
chenstift ab, aber erst im Lütticher
Gebetbuche wird sein Erzählertalent
offenbar. Ausgezeichnet ist besonders
die Handwaschung Pilati. Pilatus, ein
weißhaariger Greis, hat typische Züge
eines rohen Alten, was sich besonders
in der häßlichen Nase und dem her-
ausfordernden Blick kundgibt. Der
die Schüssel haltende Knecht mit
spitzer Mütze spendet seinen Schmä-
hungen mit ermunterndem Lachen
Beifall; der rückwärtige der beiden
Kriegsknechte hingegen bemüht sich,
mit Gebärden und Worten sein Opfer
herabzusetzen, während der andere
Knecht, den Arm in die Hüfte ge-
stemmt, die Füße übereinander gesetzt, den Kopf aus dem Bilde wendet, — es ist eine der schmucken
Personen, die ohne ersichtlichen Zweck auf so manchem Bilde jener Zeit anzutreffen sind. Christus
selbst ist allzu kläglich in Blick und Gestus. Der Meister beabsichtigt keine straffe Konzentrierung
des Vorganges, er versuchte vielmehr die einzelnen Charaktere zu schildern. Die Personen handeln
zu verschiedenen Zeiten, der eine Knecht klagt an, während Pilatus sich schon die Hände wäscht.
Fig. 45. Lüttich, Universitätsbibliothek, Gebetbuch Nr. 3d, Fol. 102.
1 Die Obereinstimmung mit den betreffenden Miniaturen im zweiten Band der Wiener Bibel ist zu auffällig, als daß
es eines ausführlichen Beweises bedürfte; wir sehen auch in dieser Handschrift die von der Wiener Bibel her bekannten
Meister an einem Werke beschäftigt. Es sei aber auf ein äußerliches Merkmal aufmerksam gemacht, das die Mitarbeit des A
vom zweiten Wiener Band schlagend bestätigt. Einige seiner Bilder im Lütticher Gebetbuche — ich nenne die Gefangen-
nahme und die Handwaschung Pilati — haben auf dem glatten Rahmen, der die Figurenbilder umgibt, eine weiße Linie, die
auf jeder Seite je dreimal durch schraubenartige Windungen unterbrochen ist. Ebenfalls mit drei Unterbrechungen — nie
mit zwei oder vier — kehrt die weiße Leiste auf dem dunklen Rahmen auch im zweiten Bande der Bibel wieder, z. B. bei
dem Bilde mit den Evangelistensymbolen (Taf. XX).
44*
329
schwunglos gezeichnet, windet sich trag, vollkommen assymmetrisch den Rand entlang. Die Farben
sind hell und reich nuanciert, so daß ein munterer Farbenklang von den Rändern der Seiten tönt.
Die Zeichnung der Ranke ist nachlässig, die Umrisse fehlen meist, die Farbe ist mit breitem Pinsel
hingestrichen, die Ranke plastisch modellierend. Fast immer vermißt man die dünnen, mit der
Feder gezeichneten Linien, die in flämischen Handschriften den Raum zwischen den Ranken
füllen. An ihrer Stelle übersäen im Lütticher Gebetbuche goldene Punkte die freigebliebene Fläche.
In dem Lütticher Gebetbuch
folgen auf das jüngste Gericht drei [*a5HSr*5
Miniaturen, die von einer Hand sind,
von der des Meisters A des zweiten
Bibelbandes in Wien: die Gefangen-
nahme Christi (fol. 54', Taf. XXII),
die Handwaschung Pilati (fol. 56',
Taf. XXIII) und die Dornenkrönung
(fol. 58', Taf. XXIII).1 Fast erscheint
der Meister in dem Lütticher Werke
in günstigerem Lichte. Wohl sind
seine Farben auch hier härter als die
seines Genossen vom ersten Bande
der Bibel, wohl müht er sich auch
hier mehr als dieser mit dem Zei-
chenstift ab, aber erst im Lütticher
Gebetbuche wird sein Erzählertalent
offenbar. Ausgezeichnet ist besonders
die Handwaschung Pilati. Pilatus, ein
weißhaariger Greis, hat typische Züge
eines rohen Alten, was sich besonders
in der häßlichen Nase und dem her-
ausfordernden Blick kundgibt. Der
die Schüssel haltende Knecht mit
spitzer Mütze spendet seinen Schmä-
hungen mit ermunterndem Lachen
Beifall; der rückwärtige der beiden
Kriegsknechte hingegen bemüht sich,
mit Gebärden und Worten sein Opfer
herabzusetzen, während der andere
Knecht, den Arm in die Hüfte ge-
stemmt, die Füße übereinander gesetzt, den Kopf aus dem Bilde wendet, — es ist eine der schmucken
Personen, die ohne ersichtlichen Zweck auf so manchem Bilde jener Zeit anzutreffen sind. Christus
selbst ist allzu kläglich in Blick und Gestus. Der Meister beabsichtigt keine straffe Konzentrierung
des Vorganges, er versuchte vielmehr die einzelnen Charaktere zu schildern. Die Personen handeln
zu verschiedenen Zeiten, der eine Knecht klagt an, während Pilatus sich schon die Hände wäscht.
Fig. 45. Lüttich, Universitätsbibliothek, Gebetbuch Nr. 3d, Fol. 102.
1 Die Obereinstimmung mit den betreffenden Miniaturen im zweiten Band der Wiener Bibel ist zu auffällig, als daß
es eines ausführlichen Beweises bedürfte; wir sehen auch in dieser Handschrift die von der Wiener Bibel her bekannten
Meister an einem Werke beschäftigt. Es sei aber auf ein äußerliches Merkmal aufmerksam gemacht, das die Mitarbeit des A
vom zweiten Wiener Band schlagend bestätigt. Einige seiner Bilder im Lütticher Gebetbuche — ich nenne die Gefangen-
nahme und die Handwaschung Pilati — haben auf dem glatten Rahmen, der die Figurenbilder umgibt, eine weiße Linie, die
auf jeder Seite je dreimal durch schraubenartige Windungen unterbrochen ist. Ebenfalls mit drei Unterbrechungen — nie
mit zwei oder vier — kehrt die weiße Leiste auf dem dunklen Rahmen auch im zweiten Bande der Bibel wieder, z. B. bei
dem Bilde mit den Evangelistensymbolen (Taf. XX).
44*