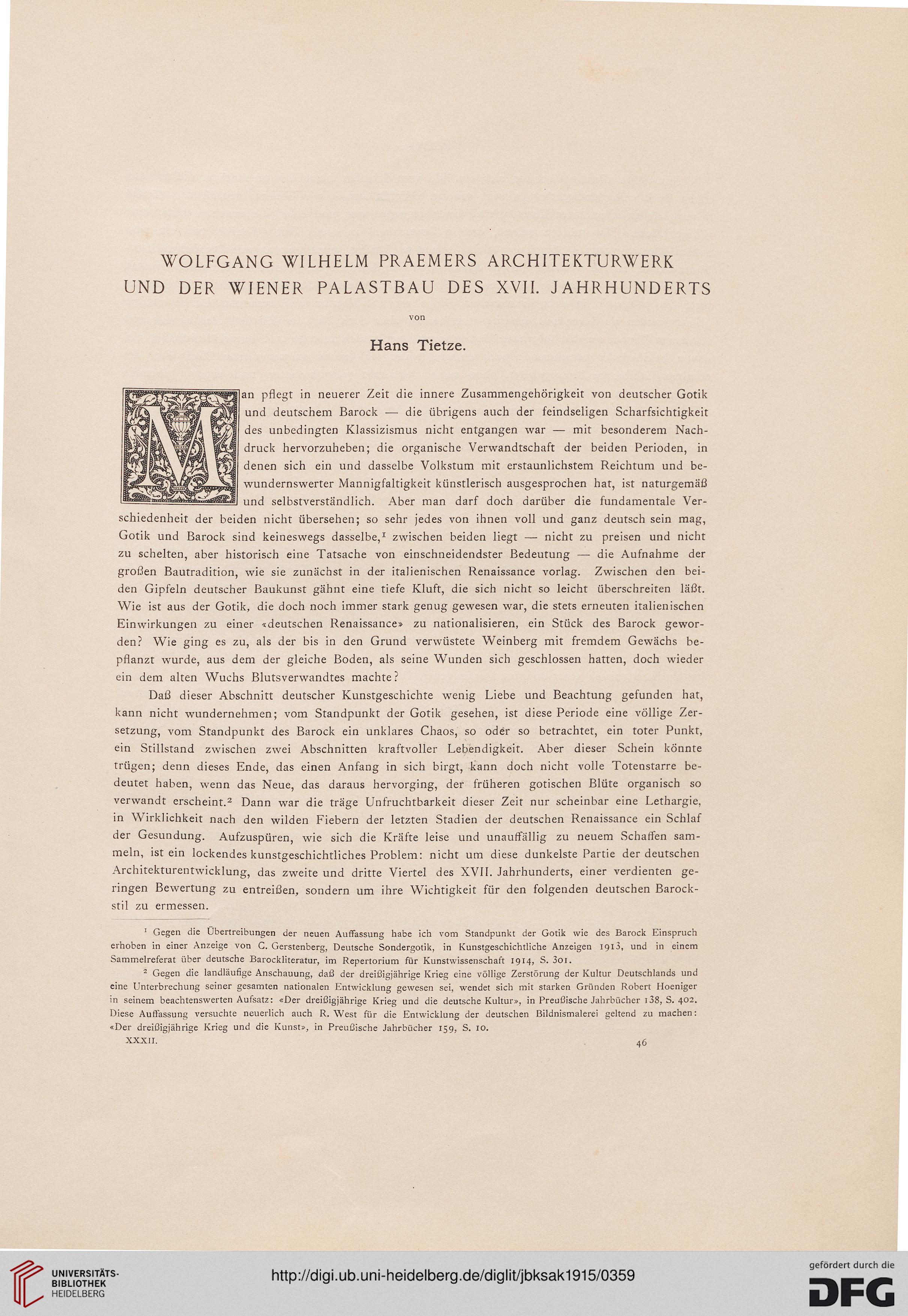WOLFGANG WILHELM PRAEMERS ARCHITEKTURWERK
UND DER WIENER PALASTBAU DES XVII. JAHRHUNDERTS
von
Hans Tietze.
an pflegt in neuerer Zeit die innere Zusammengehörigkeit von deutscher Gotik
und deutschem Barock — die übrigens auch der feindseligen Scharfsichtigkeit
des unbedingten Klassizismus nicht entgangen war — mit besonderem Nach-
druck hervorzuheben; die organische Verwandtschaft der beiden Perioden, in
denen sich ein und dasselbe Volkstum mit erstaunlichstem Reichtum und be-
wundernswerter Mannigfaltigkeit künstlerisch ausgesprochen hat, ist naturgemäß
und selbstverständlich. Aber man darf doch darüber die fundamentale Ver-
schiedenheit der beiden nicht übersehen; so sehr jedes von ihnen voll und ganz deutsch sein mag,
Gotik und Barock sind keineswegs dasselbe,1 zwischen beiden liegt — nicht zu preisen und nicht
zu schelten, aber historisch eine Tatsache von einschneidendster Bedeutung — die Aufnahme der
großen Bautradition, wie sie zunächst in der italienischen Renaissance vorlag. Zwischen den bei-
den Gipfeln deutscher Baukunst gähnt eine tiefe Kluft, die sich nicht so leicht überschreiten läßt.
Wie ist aus der Gotik, die doch noch immer stark genug gewesen war, die stets erneuten italienischen
Einwirkungen zu einer «deutschen Renaissance» zu nationalisieren, ein Stück des Barock gewor-
den? Wie ging es zu, als der bis in den Grund verwüstete Weinberg mit fremdem Gewächs be-
pflanzt wurde, aus dem der gleiche Boden, als seine Wunden sich geschlossen hatten, doch wieder
ein dem alten Wuchs Blutsverwandtes machte?
Daß dieser Abschnitt deutscher Kunstgeschichte wenig Liebe und Beachtung gefunden hat,
kann nicht wundernehmen; vom Standpunkt der Gotik gesehen, ist diese Periode eine völlige Zer-
setzung, vom Standpunkt des Barock ein unklares Chaos, so oder so betrachtet, ein toter Punkt,
ein Stillstand zwischen zwei Abschnitten kraftvoller Lebendigkeit. Aber dieser Schein könnte
trügen; denn dieses Ende, das einen Anfang in sich birgt, kann doch nicht volle Totenstarre be-
deutet haben, wenn das Neue, das daraus hervorging, der früheren gotischen Blüte organisch so
verwandt erscheint.2 Dann war die träge Unfruchtbarkeit dieser Zeit nur scheinbar eine Lethargie,
in Wirklichkeit nach den wilden Fiebern der letzten Stadien der deutschen Renaissance ein Schlaf
der Gesundung. Aufzuspüren, wie sich die Kräfte leise und unauffällig zu neuem Schaffen sam-
meln, ist ein lockendes kunstgeschichtliches Problem: nicht um diese dunkelste Partie der deutschen
Architekturentwicklung, das zweite und dritte Viertel des XVII. Jahrhunderts, einer verdienten ge-
ringen Bewertung zu entreißen, sondern um ihre Wichtigkeit für den folgenden deutschen Barock-
stil zu ermessen.
1 Gegen die Übertreibungen der neuen Auffassung habe ich vom Standpunkt der Gotik wie des Barock Einspruch
erhoben in einer Anzeige von C. Gerstenberg, Deutsche Sondergotik, in Kunstgeschichtliche Anzeigen ioi3, und in einem
Sammelreferat über deutsche Barockliteratur, im Repertorium für Kunstwissenschaft 1914, S. 3oi.
2 Gegen die landläufige Anschauung, daß der dreißigjährige Krieg eine völlige Zerstörung der Kultur Deutschlands und
eine Unterbrechung seiner gesamten nationalen Entwicklung gewesen sei, wendet sich mit starken Gründen Robert Hoeniger
in seinem beachtenswerten Aufsatz: «Der dreißigjährige Krieg und die deutsche Kultur», in Preußische Jahrbücher i38, S. 402.
Diese Auffassung versuchte neuerlich auch R.West für die Entwicklung der deutschen Bildnismalerei geltend zu machen:
«Der dreißigjährige Krieg und die Kunst», in Preußische Jahrbücher 159, S. 10.
xxxii. . 40
UND DER WIENER PALASTBAU DES XVII. JAHRHUNDERTS
von
Hans Tietze.
an pflegt in neuerer Zeit die innere Zusammengehörigkeit von deutscher Gotik
und deutschem Barock — die übrigens auch der feindseligen Scharfsichtigkeit
des unbedingten Klassizismus nicht entgangen war — mit besonderem Nach-
druck hervorzuheben; die organische Verwandtschaft der beiden Perioden, in
denen sich ein und dasselbe Volkstum mit erstaunlichstem Reichtum und be-
wundernswerter Mannigfaltigkeit künstlerisch ausgesprochen hat, ist naturgemäß
und selbstverständlich. Aber man darf doch darüber die fundamentale Ver-
schiedenheit der beiden nicht übersehen; so sehr jedes von ihnen voll und ganz deutsch sein mag,
Gotik und Barock sind keineswegs dasselbe,1 zwischen beiden liegt — nicht zu preisen und nicht
zu schelten, aber historisch eine Tatsache von einschneidendster Bedeutung — die Aufnahme der
großen Bautradition, wie sie zunächst in der italienischen Renaissance vorlag. Zwischen den bei-
den Gipfeln deutscher Baukunst gähnt eine tiefe Kluft, die sich nicht so leicht überschreiten läßt.
Wie ist aus der Gotik, die doch noch immer stark genug gewesen war, die stets erneuten italienischen
Einwirkungen zu einer «deutschen Renaissance» zu nationalisieren, ein Stück des Barock gewor-
den? Wie ging es zu, als der bis in den Grund verwüstete Weinberg mit fremdem Gewächs be-
pflanzt wurde, aus dem der gleiche Boden, als seine Wunden sich geschlossen hatten, doch wieder
ein dem alten Wuchs Blutsverwandtes machte?
Daß dieser Abschnitt deutscher Kunstgeschichte wenig Liebe und Beachtung gefunden hat,
kann nicht wundernehmen; vom Standpunkt der Gotik gesehen, ist diese Periode eine völlige Zer-
setzung, vom Standpunkt des Barock ein unklares Chaos, so oder so betrachtet, ein toter Punkt,
ein Stillstand zwischen zwei Abschnitten kraftvoller Lebendigkeit. Aber dieser Schein könnte
trügen; denn dieses Ende, das einen Anfang in sich birgt, kann doch nicht volle Totenstarre be-
deutet haben, wenn das Neue, das daraus hervorging, der früheren gotischen Blüte organisch so
verwandt erscheint.2 Dann war die träge Unfruchtbarkeit dieser Zeit nur scheinbar eine Lethargie,
in Wirklichkeit nach den wilden Fiebern der letzten Stadien der deutschen Renaissance ein Schlaf
der Gesundung. Aufzuspüren, wie sich die Kräfte leise und unauffällig zu neuem Schaffen sam-
meln, ist ein lockendes kunstgeschichtliches Problem: nicht um diese dunkelste Partie der deutschen
Architekturentwicklung, das zweite und dritte Viertel des XVII. Jahrhunderts, einer verdienten ge-
ringen Bewertung zu entreißen, sondern um ihre Wichtigkeit für den folgenden deutschen Barock-
stil zu ermessen.
1 Gegen die Übertreibungen der neuen Auffassung habe ich vom Standpunkt der Gotik wie des Barock Einspruch
erhoben in einer Anzeige von C. Gerstenberg, Deutsche Sondergotik, in Kunstgeschichtliche Anzeigen ioi3, und in einem
Sammelreferat über deutsche Barockliteratur, im Repertorium für Kunstwissenschaft 1914, S. 3oi.
2 Gegen die landläufige Anschauung, daß der dreißigjährige Krieg eine völlige Zerstörung der Kultur Deutschlands und
eine Unterbrechung seiner gesamten nationalen Entwicklung gewesen sei, wendet sich mit starken Gründen Robert Hoeniger
in seinem beachtenswerten Aufsatz: «Der dreißigjährige Krieg und die deutsche Kultur», in Preußische Jahrbücher i38, S. 402.
Diese Auffassung versuchte neuerlich auch R.West für die Entwicklung der deutschen Bildnismalerei geltend zu machen:
«Der dreißigjährige Krieg und die Kunst», in Preußische Jahrbücher 159, S. 10.
xxxii. . 40