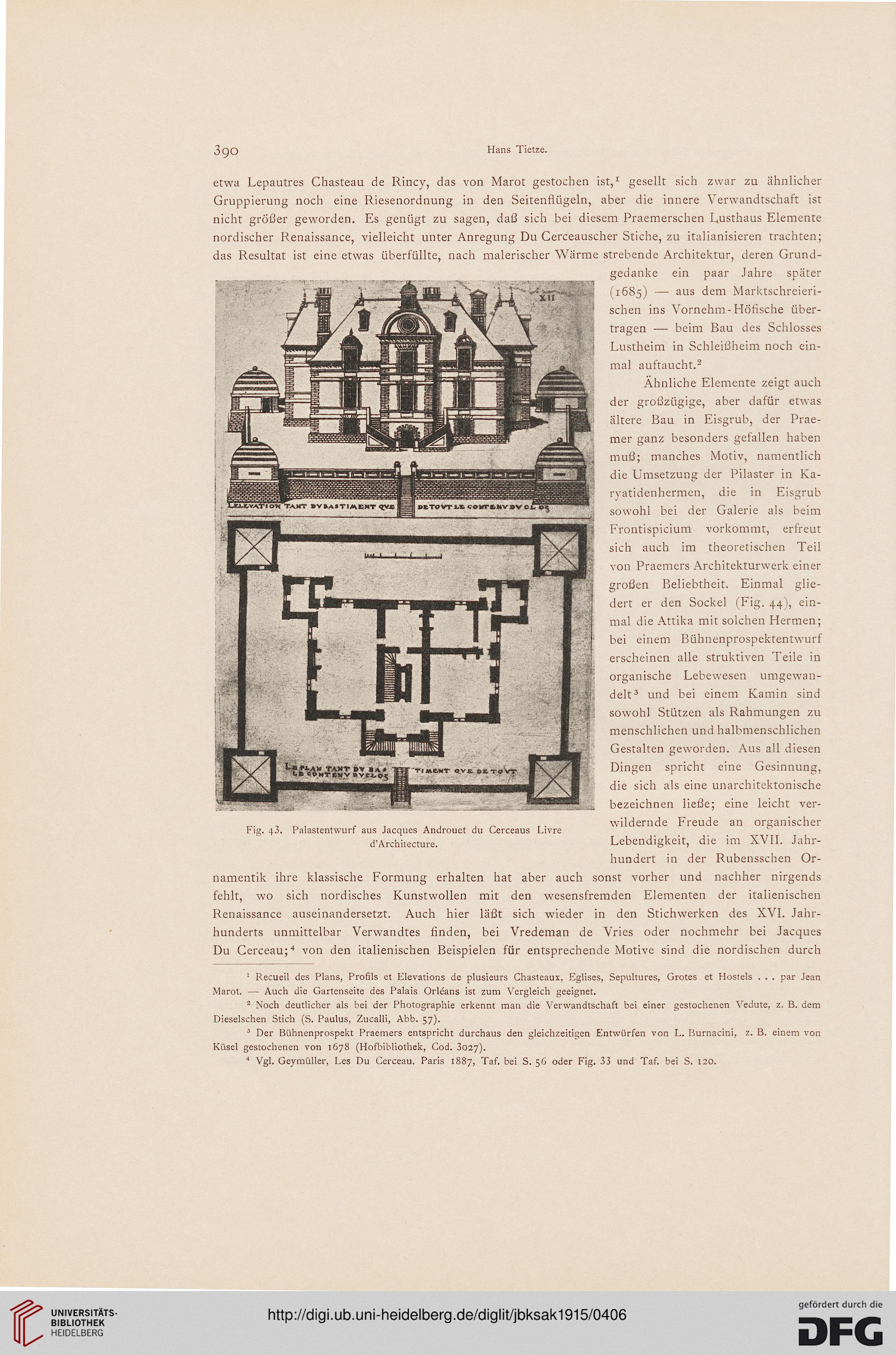3go
Hans Tietze.
etwa Lepautres Chasteau de Rincy, das von Marot gestochen ist,1 gesellt sich zwar zu ähnlicher
Gruppierung noch eine Riesenordnung in den Seitenflügeln, aber die innere Verwandtschaft ist
nicht größer geworden. Es genügt zu sagen, daß sich bei diesem Praemerschen Lusthaus Elemente
nordischer Renaissance, vielleicht unter Anregung Du Cerceauscher Stiche, zu italianisieren trachten;
das Resultat ist eine etwas überfüllte, nach malerischer Wärme strebende Architektur, deren Grund-
gedanke ein paar Jahre später
(1685) — aus dem Marktschreieri-
schen ins Vornehm-Höfische über-
tragen — beim Bau des Schlosses
Lustheim in Schleißheim noch ein-
mal auftaucht.2
Ähnliche Elemente zeigt auch
der großzügige, aber dafür etwas
ältere Bau in Eisgrub, der Prae-
mer ganz besonders gefallen haben
muß; manches Motiv, namentlich
die Umsetzung der Pilaster in Ka-
ryatidenhermen, die in Eisgrub
sowohl bei der Galerie als beim
Frontispicium vorkommt, erfreut
sich auch im theoretischen Teil
von Praemers Architekturwerk einer
großen Beliebtheit.
Einmal glie-
dert er den Sockel (Fig. 44), ein-
mal die Attika mit solchen Hermen;
bei einem Bühnenprospektentwurf
erscheinen alle struktiven Teile in
organische Lebewesen umgewan-
delt3 und bei einem Kamin sind
sowohl Stützen als Rahmungen zu
menschlichen und halbmenschlichen
Gestalten geworden. Aus all diesen
Dingen spricht eine Gesinnung,
die sich als eine unarchitektonische
bezeichnen ließe; eine leicht ver-
wildernde Freude an organischer
Lebendigkeit, die im XVII. Jahr-
hundert in der Rubensschen Or-
namentik ihre klassische Formung erhalten hat aber auch sonst vorher und nachher nirgends
fehlt, wo sich nordisches Kunstwollen mit den wesensfremden Elementen der italienischen
Renaissance auseinandersetzt. Auch hier läßt sich wieder in den Stichwerken des XVI. Jahr-
hunderts unmittelbar Verwandtes finden, bei Vredeman de Vries oder nochmehr bei Jacques
Du Cerceau;4 von den italienischen Beispielen für entsprechende Motive sind die nordischen durch
1 Recucil des Plans, Profils et Elevations de plusieurs Chasteaux, Eglises, Sepultures, Grotes et Hostels . . . par Jean
Marot. — Auch die Gartenseite des Palais Orleans ist zum Vergleich geeignet.
2 Noch deutlicher als bei der Photographie erkennt man die Verwandtschaft bei einer gestochenen Vedute, z. B. dem
Dieselschen Stich (S. Paulus, Zucalli, Abb. 57).
3 Der Bühnenprospekt Praemers entspricht durchaus den gleichzeitigen Entwürfen von L. llurnacini, z. B. einem von
Küsel gestochenen von 1678 (Hofbibliothek, Cod. 3027).
4 Vgl. Geymüller, Les Du Cerceau, Paris 1887, Taf. bei S. 56 oder Fig. 33 und Taf. bei S. 120.
43. Palastentwurf aus Jacques Androuet du Cerceaus Livre
d'Architecture.
Hans Tietze.
etwa Lepautres Chasteau de Rincy, das von Marot gestochen ist,1 gesellt sich zwar zu ähnlicher
Gruppierung noch eine Riesenordnung in den Seitenflügeln, aber die innere Verwandtschaft ist
nicht größer geworden. Es genügt zu sagen, daß sich bei diesem Praemerschen Lusthaus Elemente
nordischer Renaissance, vielleicht unter Anregung Du Cerceauscher Stiche, zu italianisieren trachten;
das Resultat ist eine etwas überfüllte, nach malerischer Wärme strebende Architektur, deren Grund-
gedanke ein paar Jahre später
(1685) — aus dem Marktschreieri-
schen ins Vornehm-Höfische über-
tragen — beim Bau des Schlosses
Lustheim in Schleißheim noch ein-
mal auftaucht.2
Ähnliche Elemente zeigt auch
der großzügige, aber dafür etwas
ältere Bau in Eisgrub, der Prae-
mer ganz besonders gefallen haben
muß; manches Motiv, namentlich
die Umsetzung der Pilaster in Ka-
ryatidenhermen, die in Eisgrub
sowohl bei der Galerie als beim
Frontispicium vorkommt, erfreut
sich auch im theoretischen Teil
von Praemers Architekturwerk einer
großen Beliebtheit.
Einmal glie-
dert er den Sockel (Fig. 44), ein-
mal die Attika mit solchen Hermen;
bei einem Bühnenprospektentwurf
erscheinen alle struktiven Teile in
organische Lebewesen umgewan-
delt3 und bei einem Kamin sind
sowohl Stützen als Rahmungen zu
menschlichen und halbmenschlichen
Gestalten geworden. Aus all diesen
Dingen spricht eine Gesinnung,
die sich als eine unarchitektonische
bezeichnen ließe; eine leicht ver-
wildernde Freude an organischer
Lebendigkeit, die im XVII. Jahr-
hundert in der Rubensschen Or-
namentik ihre klassische Formung erhalten hat aber auch sonst vorher und nachher nirgends
fehlt, wo sich nordisches Kunstwollen mit den wesensfremden Elementen der italienischen
Renaissance auseinandersetzt. Auch hier läßt sich wieder in den Stichwerken des XVI. Jahr-
hunderts unmittelbar Verwandtes finden, bei Vredeman de Vries oder nochmehr bei Jacques
Du Cerceau;4 von den italienischen Beispielen für entsprechende Motive sind die nordischen durch
1 Recucil des Plans, Profils et Elevations de plusieurs Chasteaux, Eglises, Sepultures, Grotes et Hostels . . . par Jean
Marot. — Auch die Gartenseite des Palais Orleans ist zum Vergleich geeignet.
2 Noch deutlicher als bei der Photographie erkennt man die Verwandtschaft bei einer gestochenen Vedute, z. B. dem
Dieselschen Stich (S. Paulus, Zucalli, Abb. 57).
3 Der Bühnenprospekt Praemers entspricht durchaus den gleichzeitigen Entwürfen von L. llurnacini, z. B. einem von
Küsel gestochenen von 1678 (Hofbibliothek, Cod. 3027).
4 Vgl. Geymüller, Les Du Cerceau, Paris 1887, Taf. bei S. 56 oder Fig. 33 und Taf. bei S. 120.
43. Palastentwurf aus Jacques Androuet du Cerceaus Livre
d'Architecture.