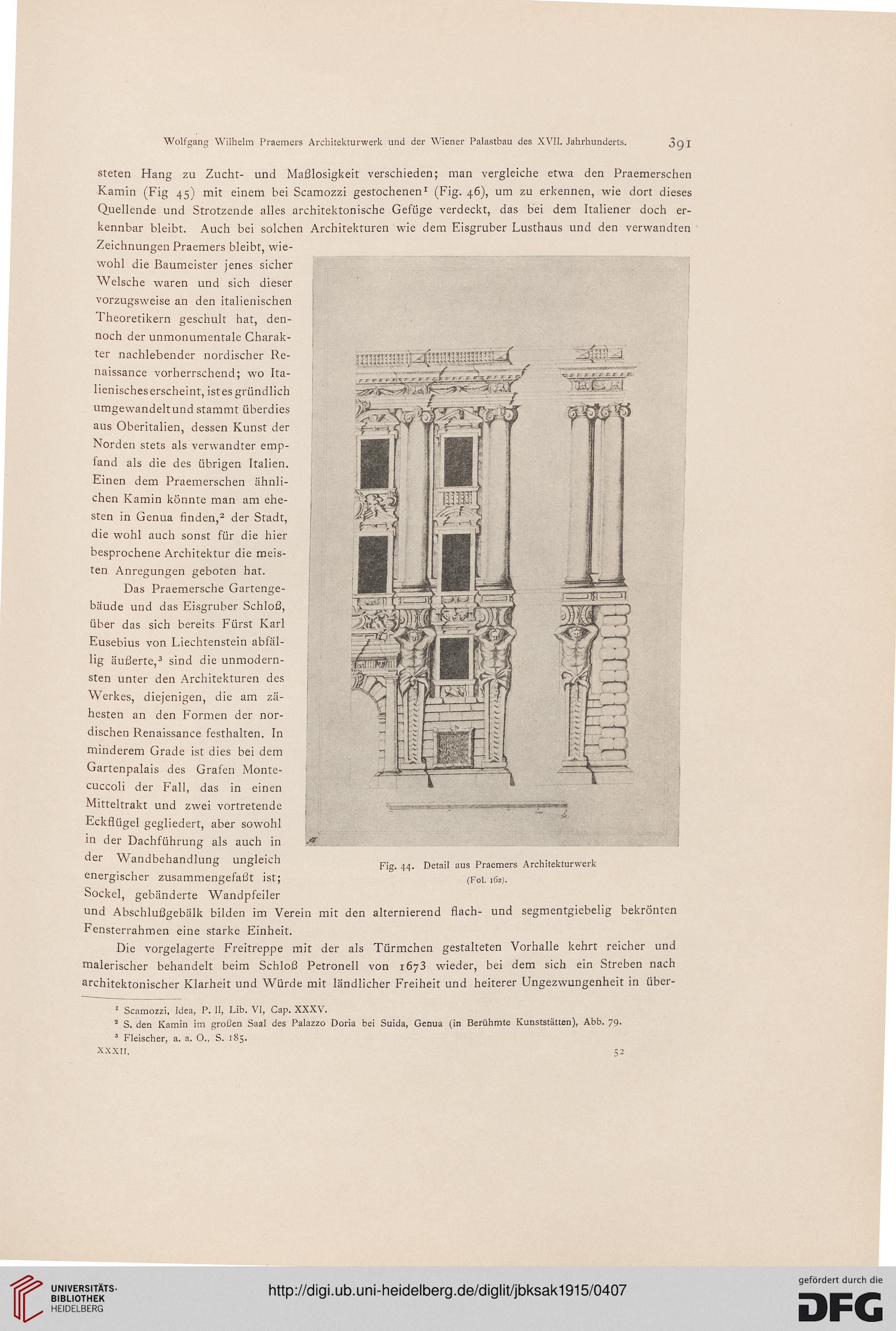Wolfgang Wilhelm Praemers Architekturwerk und der Wiener Palastbau des XVII. Jahrhunderts.
r F r v * wt r r * f\* st'* r : ir^r
steten Hang zu Zucht- und Maßlosigkeit verschieden; man vergleiche etwa den Praemerschen
Kamin (Fig 45) mit einem bei Scamozzi gestochenen1 (Fig. 46), um zu erkennen, wie dort dieses
Quellende und Strotzende alles architektonische Gefüge verdeckt, das bei dem Italiener doch er-
kennbar bleibt. Auch bei solchen Architekturen wie dem Eisgruber Lusthaus und den verwandten
Zeichnungen Praemers bleibt, wie-
wohl die Baumeister jenes sicher
Welsche waren und sich dieser
vorzugsweise an den italienischen
Theoretikern geschult hat, den-
noch der unmonumentale Charak-
ter nachlebender nordischer Re-
naissance vorherrschend; wo Ita-
lienischeserscheint, ist es gründlich
umgewandeltund stammt überdies
aus Oberitalien, dessen Kunst der
Norden stets als verwandter emp-
fand als die des übrigen Italien.
Einen dem Praemerschen ähnli-
chen Kamin könnte man am ehe-
sten in Genua finden,2 der Stadt,
die wohl auch sonst für die hier
besprochene Architektur die meis-
ten Anregungen geboten hat.
Das Praemersche Gartenge-
bäude und das Eisgruber Schloß,
über das sich bereits Fürst Karl
Eusebius von Liechtenstein abfäl-
lig äußerte,3 sind die unmodern-
sten unter den Architekturen des
Werkes, diejenigen, die am zä-
hesten an den Formen der nor-
dischen Renaissance festhalten. In
minderem Grade ist dies bei dem
Gartenpalais des Grafen Monte-
cuccoli der Fall, das in einen
Mitteltrakt und zwei vortretende
Eckflügel gegliedert, aber sowohl
in der Dachführung als auch in
der Wandbehandlung ungleich
energischer zusammengefaßt ist;
Sockel, gebänderte Wandpfeiler
und Abschlußgebälk bilden im Verein mit den alternierend flach- und segmentgiebelig bekrönten
Fensterrahmen eine starke Einheit.
Die vorgelagerte Freitreppe mit der als Türmchen gestalteten Vorhalle kehrt reicher und
malerischer behandelt beim Schloß Petronell von 1673 wieder, bei dem sich ein Streben nach
architektonischer Klarheit und Würde mit ländlicher Freiheit und heiterer Ungezwungenheit in über-
Fig. 44.
Detail aus Praemers Architekturwerk
(Fol. 162).
1 Scamozzi. Idea, P. II, Lib. VI, Cap. XXXV.
2 S. den Kamin im großen Saal des Palazzo Doria bei Suida, Genua (in Berühmte Kunststätten), Abb. 79.
3 Fleischer, a. a. O.. S. 185.
xxxir.
r F r v * wt r r * f\* st'* r : ir^r
steten Hang zu Zucht- und Maßlosigkeit verschieden; man vergleiche etwa den Praemerschen
Kamin (Fig 45) mit einem bei Scamozzi gestochenen1 (Fig. 46), um zu erkennen, wie dort dieses
Quellende und Strotzende alles architektonische Gefüge verdeckt, das bei dem Italiener doch er-
kennbar bleibt. Auch bei solchen Architekturen wie dem Eisgruber Lusthaus und den verwandten
Zeichnungen Praemers bleibt, wie-
wohl die Baumeister jenes sicher
Welsche waren und sich dieser
vorzugsweise an den italienischen
Theoretikern geschult hat, den-
noch der unmonumentale Charak-
ter nachlebender nordischer Re-
naissance vorherrschend; wo Ita-
lienischeserscheint, ist es gründlich
umgewandeltund stammt überdies
aus Oberitalien, dessen Kunst der
Norden stets als verwandter emp-
fand als die des übrigen Italien.
Einen dem Praemerschen ähnli-
chen Kamin könnte man am ehe-
sten in Genua finden,2 der Stadt,
die wohl auch sonst für die hier
besprochene Architektur die meis-
ten Anregungen geboten hat.
Das Praemersche Gartenge-
bäude und das Eisgruber Schloß,
über das sich bereits Fürst Karl
Eusebius von Liechtenstein abfäl-
lig äußerte,3 sind die unmodern-
sten unter den Architekturen des
Werkes, diejenigen, die am zä-
hesten an den Formen der nor-
dischen Renaissance festhalten. In
minderem Grade ist dies bei dem
Gartenpalais des Grafen Monte-
cuccoli der Fall, das in einen
Mitteltrakt und zwei vortretende
Eckflügel gegliedert, aber sowohl
in der Dachführung als auch in
der Wandbehandlung ungleich
energischer zusammengefaßt ist;
Sockel, gebänderte Wandpfeiler
und Abschlußgebälk bilden im Verein mit den alternierend flach- und segmentgiebelig bekrönten
Fensterrahmen eine starke Einheit.
Die vorgelagerte Freitreppe mit der als Türmchen gestalteten Vorhalle kehrt reicher und
malerischer behandelt beim Schloß Petronell von 1673 wieder, bei dem sich ein Streben nach
architektonischer Klarheit und Würde mit ländlicher Freiheit und heiterer Ungezwungenheit in über-
Fig. 44.
Detail aus Praemers Architekturwerk
(Fol. 162).
1 Scamozzi. Idea, P. II, Lib. VI, Cap. XXXV.
2 S. den Kamin im großen Saal des Palazzo Doria bei Suida, Genua (in Berühmte Kunststätten), Abb. 79.
3 Fleischer, a. a. O.. S. 185.
xxxir.