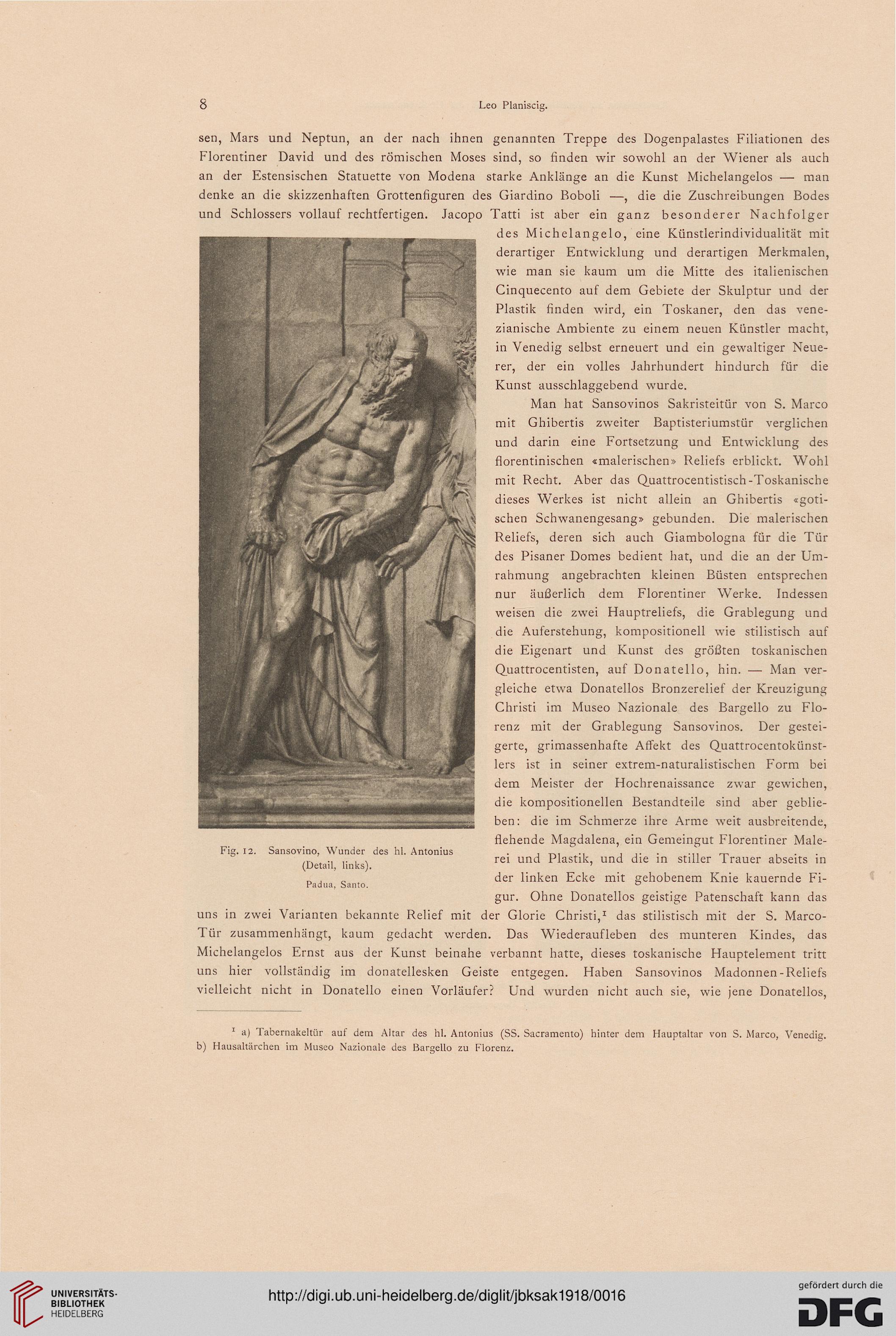8
Leo Planiscig.
sen, Mars und Neptun, an der nach ihnen genannten Treppe des Dogenpalastes Filiationen des
Florentiner David und des römischen Moses sind, so finden wir sowohl an der Wiener als auch
an der Estensischen Statuette von Modena starke Anklänge an die Kunst Michelangelos — man
denke an die skizzenhaften Grottenfiguren des Giardino Roboli —, die die Zuschreibungen Bodes
und Schlossers vollauf rechtfertigen. Jacopo Tatti ist aber ein ganz besonderer Nachfolger
des Michelangelo, eine Künstlerindividualität mit
derartiger Entwicklung und derartigen Merkmalen,
wie man sie kaum um die Mitte des italienischen
Cinquecento auf dem Gebiete der Skulptur und der
Plastik finden wird; ein Toskaner, den das vene-
zianische Ambiente zu einem neuen Künstler macht,
in Venedig selbst erneuert und ein gewaltiger Neue-
rer, der ein volles Jahrhundert hindurch für die
Kunst ausschlaggebend wurde.
Man hat Sansovinos Sakristeitür von S. Marco
mit Ghibertis zweiter Baptisteriumstür verglichen
und darin eine Fortsetzung und Entwicklung des
florentinischen «malerischen» Reliefs erblickt. Wohl
mit Recht. Aber das Quattrocentistisch-Toskanische
dieses Werkes ist nicht allein an Ghibertis «goti-
schen Schwanengesang» gebunden. Die malerischen
Reliefs, deren sich auch Giambologna für die Tür
des Pisaner Domes bedient hat, und die an der Um-
rahmung angebrachten kleinen Büsten entsprechen
nur äußerlich dem Florentiner Werke. Indessen
weisen die zwei Hauptreliefs, die Grablegung und
die Auferstehung, kompositioneil wie stilistisch auf
die Eigenart und Kunst des größten toskanischen
Quattrocentisten, auf Donatello, hin. — Man ver-
gleiche etwa Donatellos Bronzerelief der Kreuzigung
Christi im Museo Nazionale des Bargello zu Flo-
renz mit der Grablegung Sansovinos. Der gestei-
gerte, grimassenhafte Affekt des Quattrocentokünst-
lers ist in seiner extrem-naturalistischen Form bei
dem Meister der Hochrenaissance zwar gewichen,
die kompositionellen Bestandteile sind aber geblie-
ben: die im Schmerze ihre Arme weit ausbreitende,
flehende Magdalena, ein Gemeingut Florentiner Male-
rei und Plastik, und die in stiller Trauer abseits in
der linken Ecke mit gehobenem Knie kauernde Fi-
gur. Ohne Donatellos geistige Patenschaft kann das
uns in zwei Varianten bekannte Relief mit der Glorie Christi,1 das stilistisch mit der S. Marco-
Tür zusammenhängt, kaum gedacht werden. Das Wiederaufleben des munteren Kindes, das
Michelangelos Ernst aus der Kunst beinahe verbannt hatte, dieses toskanische Hauptelement tritt
uns hier vollständig im donatellesken Geiste entgegen. Haben Sansovinos Madonnen-Reliefs
vielleicht nicht in Donatello einen Vorläufer? Und wurden nicht auch sie, wie jene Donatellos,
Fig. 12. Sansovino, Wunder des hl. Antonius
(Detail, links).
Padua. Santo.
1 a) Tabernakeltür auf dem Altar des hl. Antonius (SS. Sacramento) hinter dem Hauptaltar von S. Marco, Venedig,
b) Hausaltärchen im Museo Nazionale des Bargello zu Florenz.
Leo Planiscig.
sen, Mars und Neptun, an der nach ihnen genannten Treppe des Dogenpalastes Filiationen des
Florentiner David und des römischen Moses sind, so finden wir sowohl an der Wiener als auch
an der Estensischen Statuette von Modena starke Anklänge an die Kunst Michelangelos — man
denke an die skizzenhaften Grottenfiguren des Giardino Roboli —, die die Zuschreibungen Bodes
und Schlossers vollauf rechtfertigen. Jacopo Tatti ist aber ein ganz besonderer Nachfolger
des Michelangelo, eine Künstlerindividualität mit
derartiger Entwicklung und derartigen Merkmalen,
wie man sie kaum um die Mitte des italienischen
Cinquecento auf dem Gebiete der Skulptur und der
Plastik finden wird; ein Toskaner, den das vene-
zianische Ambiente zu einem neuen Künstler macht,
in Venedig selbst erneuert und ein gewaltiger Neue-
rer, der ein volles Jahrhundert hindurch für die
Kunst ausschlaggebend wurde.
Man hat Sansovinos Sakristeitür von S. Marco
mit Ghibertis zweiter Baptisteriumstür verglichen
und darin eine Fortsetzung und Entwicklung des
florentinischen «malerischen» Reliefs erblickt. Wohl
mit Recht. Aber das Quattrocentistisch-Toskanische
dieses Werkes ist nicht allein an Ghibertis «goti-
schen Schwanengesang» gebunden. Die malerischen
Reliefs, deren sich auch Giambologna für die Tür
des Pisaner Domes bedient hat, und die an der Um-
rahmung angebrachten kleinen Büsten entsprechen
nur äußerlich dem Florentiner Werke. Indessen
weisen die zwei Hauptreliefs, die Grablegung und
die Auferstehung, kompositioneil wie stilistisch auf
die Eigenart und Kunst des größten toskanischen
Quattrocentisten, auf Donatello, hin. — Man ver-
gleiche etwa Donatellos Bronzerelief der Kreuzigung
Christi im Museo Nazionale des Bargello zu Flo-
renz mit der Grablegung Sansovinos. Der gestei-
gerte, grimassenhafte Affekt des Quattrocentokünst-
lers ist in seiner extrem-naturalistischen Form bei
dem Meister der Hochrenaissance zwar gewichen,
die kompositionellen Bestandteile sind aber geblie-
ben: die im Schmerze ihre Arme weit ausbreitende,
flehende Magdalena, ein Gemeingut Florentiner Male-
rei und Plastik, und die in stiller Trauer abseits in
der linken Ecke mit gehobenem Knie kauernde Fi-
gur. Ohne Donatellos geistige Patenschaft kann das
uns in zwei Varianten bekannte Relief mit der Glorie Christi,1 das stilistisch mit der S. Marco-
Tür zusammenhängt, kaum gedacht werden. Das Wiederaufleben des munteren Kindes, das
Michelangelos Ernst aus der Kunst beinahe verbannt hatte, dieses toskanische Hauptelement tritt
uns hier vollständig im donatellesken Geiste entgegen. Haben Sansovinos Madonnen-Reliefs
vielleicht nicht in Donatello einen Vorläufer? Und wurden nicht auch sie, wie jene Donatellos,
Fig. 12. Sansovino, Wunder des hl. Antonius
(Detail, links).
Padua. Santo.
1 a) Tabernakeltür auf dem Altar des hl. Antonius (SS. Sacramento) hinter dem Hauptaltar von S. Marco, Venedig,
b) Hausaltärchen im Museo Nazionale des Bargello zu Florenz.