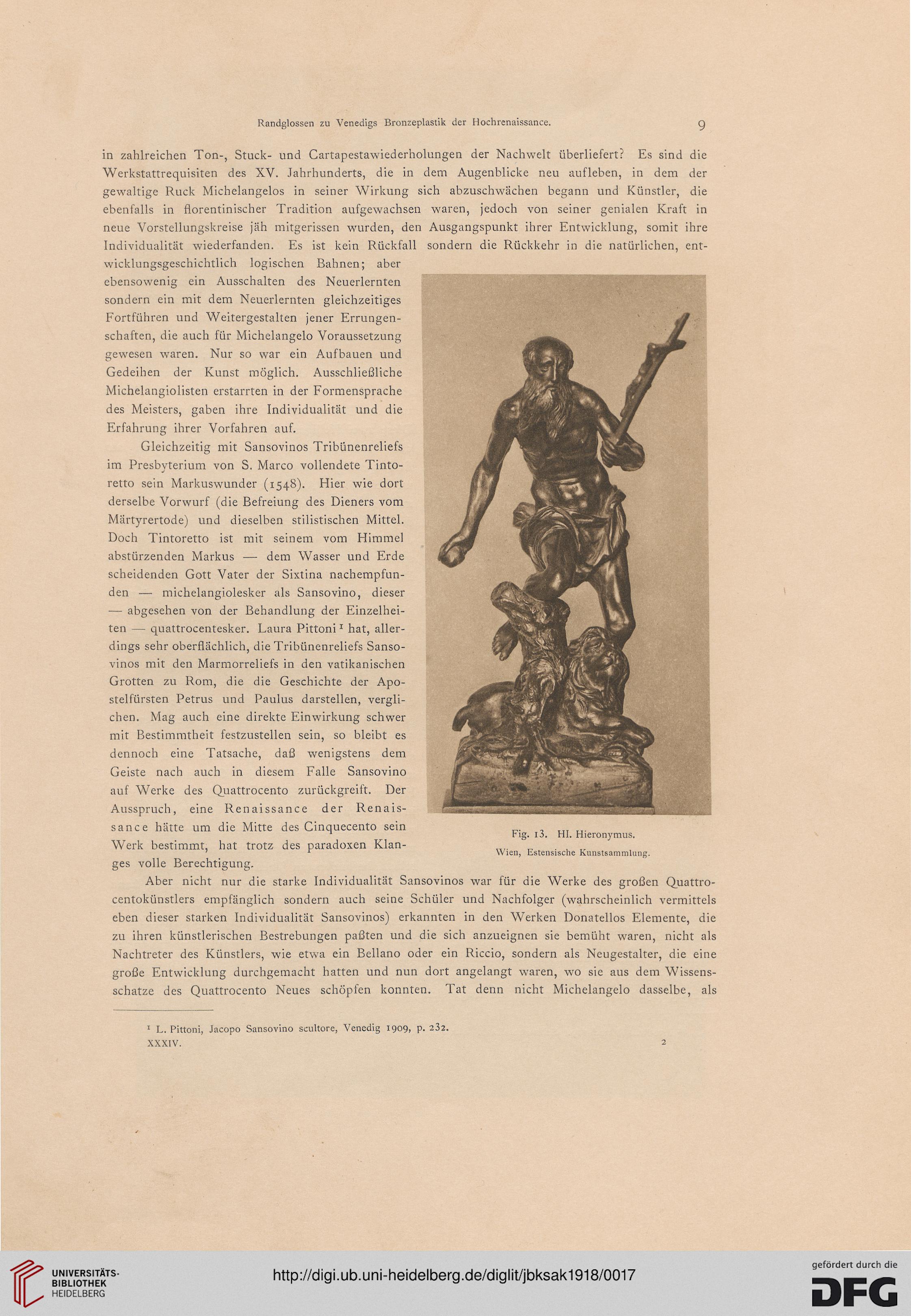Randglossen zu Venedigs Bronzeplastik der Hochrenaissance.
9
in zahlreichen Ton-, Stuck- und Cartapestawiederholungen der Nachwelt überliefert? Es sind die
Werkstattrequisiten des XV. Jahrhunderts, die in dem Augenblicke neu aufleben, in dem der
gewaltige Ruck Michelangelos in seiner Wirkung sich abzuschwächen begann und Künstler, die
ebenfalls in florentinischer Tradition aufgewachsen waren, jedoch von seiner genialen Kraft in
neue Vorstellungskreise jäh mitgerissen wurden, den Ausgangspunkt ihrer Entwicklung, somit ihre
Individualität wiederfanden. Es ist kein Rückfall sondern die Rückkehr in die natürlichen, ent-
wicklungsgeschichtlich logischen Bahnen; aber
ebensowenig ein Ausschalten des Neuerlernten
sondern ein mit dem Neuerlernten gleichzeitiges
Fortführen und Weitergestalten jener Errungen-
schaften, die auch für Michelangelo Voraussetzung
gewesen waren. Nur so war ein Aufbauen und
Gedeihen der Kunst möglich. Ausschließliche
Michelangiolisten erstarrten in der Formensprache
des Meisters, gaben ihre Individualität und die
Erfahrung ihrer Vorfahren auf.
Gleichzeitig mit Sansovinos Tribünenreliefs
im Presbyterium von S. Marco vollendete Tinto-
retto sein Markuswunder (1548). Hier wie dort
derselbe Vorwurf (die Befreiung des Dieners vom
Märtyrertode) und dieselben stilistischen Mittel.
Doch Tintoretto ist mit seinem vom Himmel
abstürzenden Markus — dem Wasser und Erde
scheidenden Gott Vater der Sixtina nachempfun-
den — michelangiolesker als Sansovino, dieser
— abgesehen von der Behandlung der Einzelhei-
ten — quattrocentesker. Laura Pittoni1 hat, aller-
dings sehr oberflächlich, die Tribünenreliefs Sanso-
vinos mit den Marmorreliefs in den vatikanischen
Grotten zu Rom, die die Geschichte der Apo-
stelfürsten Petrus und Paulus darstellen, vergli-
chen. Mag auch eine direkte Einwirkung schwer
mit Bestimmtheit festzustellen sein, so bleibt es
dennoch eine Tatsache, daß wenigstens dem
Geiste nach auch in diesem Falle Sansovino
auf Werke des Quattrocento zurückgreift. Der
Ausspruch, eine Renaissance der Renais-
sance hätte um die Mitte des Cinquecento sein
Werk bestimmt, hat trotz des paradoxen Klan-
ges volle Berechtigung.
Aber nicht nur die starke Individualität Sansovinos war für die Werke des großen Quattro-
centokünstlers empfänglich sondern auch seine Schüler und Nachfolger (wahrscheinlich vermittels
eben dieser starken Individualität Sansovinos) erkannten in den Werken Donatellos Elemente, die
zu ihren künstlerischen Bestrebungen paßten und die sich anzueignen sie bemüht waren, nicht als
Nachtreter des Künstlers, wie etwa ein Bellano oder ein Riccio, sondern als Neugestalter, die eine
große Entwicklung durchgemacht hatten und nun dort angelangt waren, wo sie aus dem Wissens-
schatze des Quattrocento Neues schöpfen konnten. Tat denn nicht Michelangelo dasselbe, als
Fig. i3. HI. Hieronymus.
Wien, Estensische Kunstsammlung.
1 L. Pittoni, Jacopo Sansovino scultore, Venedig 1909, p. 232.
XXXIV.
2
9
in zahlreichen Ton-, Stuck- und Cartapestawiederholungen der Nachwelt überliefert? Es sind die
Werkstattrequisiten des XV. Jahrhunderts, die in dem Augenblicke neu aufleben, in dem der
gewaltige Ruck Michelangelos in seiner Wirkung sich abzuschwächen begann und Künstler, die
ebenfalls in florentinischer Tradition aufgewachsen waren, jedoch von seiner genialen Kraft in
neue Vorstellungskreise jäh mitgerissen wurden, den Ausgangspunkt ihrer Entwicklung, somit ihre
Individualität wiederfanden. Es ist kein Rückfall sondern die Rückkehr in die natürlichen, ent-
wicklungsgeschichtlich logischen Bahnen; aber
ebensowenig ein Ausschalten des Neuerlernten
sondern ein mit dem Neuerlernten gleichzeitiges
Fortführen und Weitergestalten jener Errungen-
schaften, die auch für Michelangelo Voraussetzung
gewesen waren. Nur so war ein Aufbauen und
Gedeihen der Kunst möglich. Ausschließliche
Michelangiolisten erstarrten in der Formensprache
des Meisters, gaben ihre Individualität und die
Erfahrung ihrer Vorfahren auf.
Gleichzeitig mit Sansovinos Tribünenreliefs
im Presbyterium von S. Marco vollendete Tinto-
retto sein Markuswunder (1548). Hier wie dort
derselbe Vorwurf (die Befreiung des Dieners vom
Märtyrertode) und dieselben stilistischen Mittel.
Doch Tintoretto ist mit seinem vom Himmel
abstürzenden Markus — dem Wasser und Erde
scheidenden Gott Vater der Sixtina nachempfun-
den — michelangiolesker als Sansovino, dieser
— abgesehen von der Behandlung der Einzelhei-
ten — quattrocentesker. Laura Pittoni1 hat, aller-
dings sehr oberflächlich, die Tribünenreliefs Sanso-
vinos mit den Marmorreliefs in den vatikanischen
Grotten zu Rom, die die Geschichte der Apo-
stelfürsten Petrus und Paulus darstellen, vergli-
chen. Mag auch eine direkte Einwirkung schwer
mit Bestimmtheit festzustellen sein, so bleibt es
dennoch eine Tatsache, daß wenigstens dem
Geiste nach auch in diesem Falle Sansovino
auf Werke des Quattrocento zurückgreift. Der
Ausspruch, eine Renaissance der Renais-
sance hätte um die Mitte des Cinquecento sein
Werk bestimmt, hat trotz des paradoxen Klan-
ges volle Berechtigung.
Aber nicht nur die starke Individualität Sansovinos war für die Werke des großen Quattro-
centokünstlers empfänglich sondern auch seine Schüler und Nachfolger (wahrscheinlich vermittels
eben dieser starken Individualität Sansovinos) erkannten in den Werken Donatellos Elemente, die
zu ihren künstlerischen Bestrebungen paßten und die sich anzueignen sie bemüht waren, nicht als
Nachtreter des Künstlers, wie etwa ein Bellano oder ein Riccio, sondern als Neugestalter, die eine
große Entwicklung durchgemacht hatten und nun dort angelangt waren, wo sie aus dem Wissens-
schatze des Quattrocento Neues schöpfen konnten. Tat denn nicht Michelangelo dasselbe, als
Fig. i3. HI. Hieronymus.
Wien, Estensische Kunstsammlung.
1 L. Pittoni, Jacopo Sansovino scultore, Venedig 1909, p. 232.
XXXIV.
2