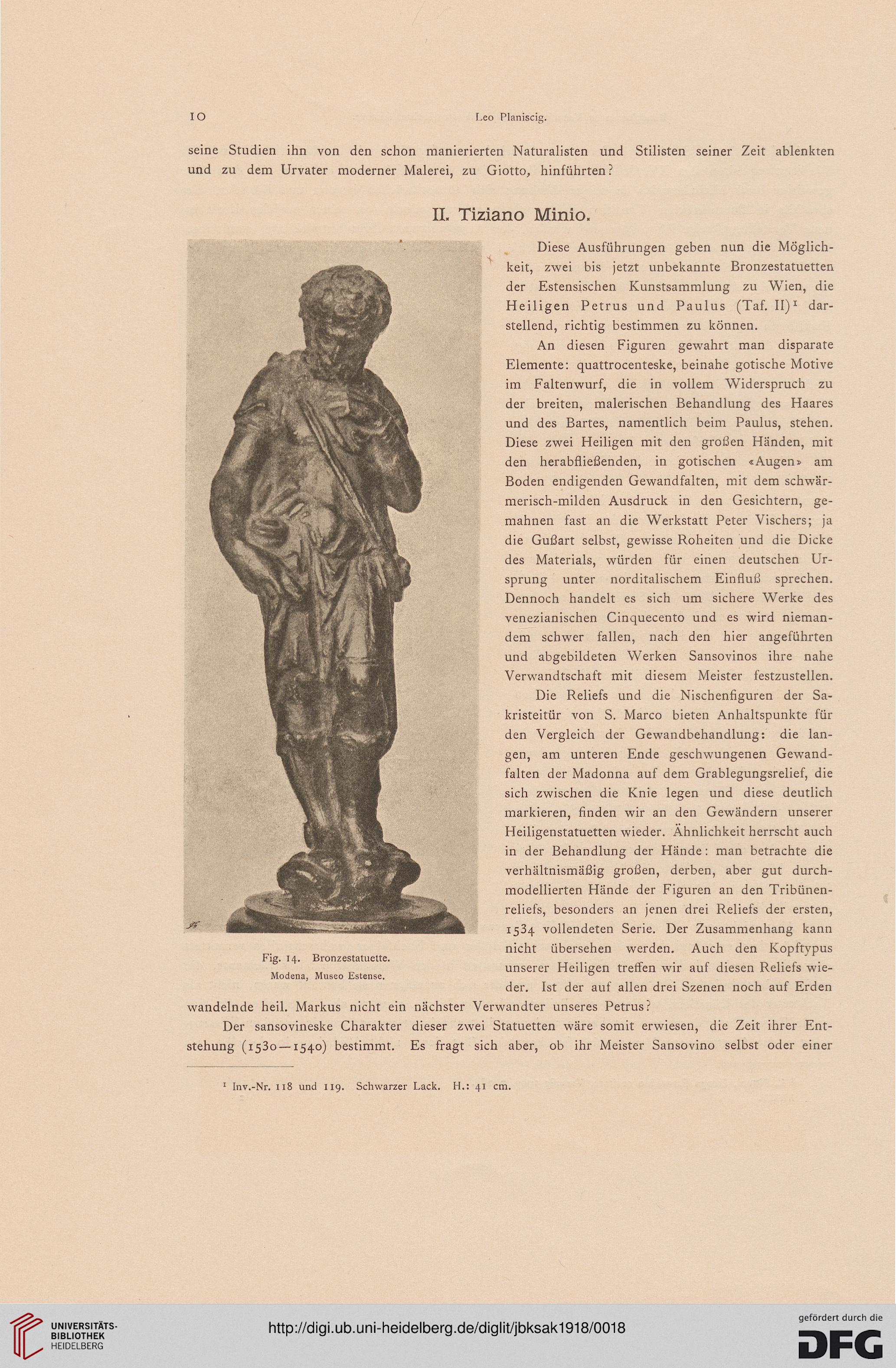IO
F.co Planiscig.
seine Studien ihn von den schon manierierten Naturalisten und Stilisten seiner Zeit ablenkten
und zu dem Urvater moderner Malerei, zu Giotto, hinführten?
II. Tiziano Minio.
Diese Ausführungen geben nun die Möglich-
keit, zwei bis jetzt unbekannte Bronzestatuetten
der Estensischen Kunstsammlung zu Wien, die
Heiligen Petrus und Paulus (Taf. II)1 dar-
stellend, richtig bestimmen zu können.
An diesen Figuren gewahrt man disparate
Elemente: quattrocenteske, beinahe gotische Motive
im Faltenwurf, die in vollem Widerspruch zu
der breiten, malerischen Behandlung des Haares
und des Bartes, namentlich beim Paulus, stehen.
Diese zwei Heiligen mit den großen Händen, mit
den herabfließenden, in gotischen «Augen» am
Boden endigenden Gewandfalten, mit dem schwär-
merisch-milden Ausdruck in den Gesichtern, ge-
mahnen fast an die Werkstatt Peter Vischers; ja
die Gußart selbst, gewisse Roheiten und die Dicke
des Materials, würden für einen deutschen Ur-
sprung unter norditalischem Einfluß sprechen.
Dennoch handelt es sich um sichere Werke des
venezianischen Cinquecento und es wird nieman-
dem schwer fallen, nach den hier angeführten
und abgebildeten Werken Sansovinos ihre nahe
Verwandtschaft mit diesem Meister festzustellen.
Die Reliefs und die Nischenfiguren der Sa-
kristeitür von S. Marco bieten Anhaltspunkte für
den Vergleich der Gewandbehandlung: die lan-
gen, am unteren Ende geschwungenen Gewand-
falten der Madonna auf dem Grablegungsrelief, die
sich zwischen die Knie legen und diese deutlich
markieren, finden wir an den Gewändern unserer
Heiligenstatuetten wieder. Ähnlichkeit herrscht auch
in der Behandlung der Hände: man betrachte die
verhältnismäßig großen, derben, aber gut durch-
modellierten Hände der Figuren an den Tribünen-
reliefs, besonders an jenen drei Reliefs der ersten,
1534 vollendeten Serie. Der Zusammenhang kann
nicht übersehen werden. Auch den Kopftypus
unserer Heiligen treffen wir auf diesen Reliefs wie-
der. Ist der auf allen drei Szenen noch auf Erden
wandelnde heil. Markus nicht ein nächster Verwandter unseres Petrus?
Der sansovineske Charakter dieser zwei Statuetten wäre somit erwiesen, die Zeit ihrer Ent-
stehung (i53o —1540) bestimmt. Es fragt sich aber, ob ihr Meister Sansovino selbst oder einer
Fig. 14. Bronzestatuette.
Modena, Museo Estense.
1 Inv.-Nr. 118 und 119. Schwarzer Lack. H.: 41 cm.
F.co Planiscig.
seine Studien ihn von den schon manierierten Naturalisten und Stilisten seiner Zeit ablenkten
und zu dem Urvater moderner Malerei, zu Giotto, hinführten?
II. Tiziano Minio.
Diese Ausführungen geben nun die Möglich-
keit, zwei bis jetzt unbekannte Bronzestatuetten
der Estensischen Kunstsammlung zu Wien, die
Heiligen Petrus und Paulus (Taf. II)1 dar-
stellend, richtig bestimmen zu können.
An diesen Figuren gewahrt man disparate
Elemente: quattrocenteske, beinahe gotische Motive
im Faltenwurf, die in vollem Widerspruch zu
der breiten, malerischen Behandlung des Haares
und des Bartes, namentlich beim Paulus, stehen.
Diese zwei Heiligen mit den großen Händen, mit
den herabfließenden, in gotischen «Augen» am
Boden endigenden Gewandfalten, mit dem schwär-
merisch-milden Ausdruck in den Gesichtern, ge-
mahnen fast an die Werkstatt Peter Vischers; ja
die Gußart selbst, gewisse Roheiten und die Dicke
des Materials, würden für einen deutschen Ur-
sprung unter norditalischem Einfluß sprechen.
Dennoch handelt es sich um sichere Werke des
venezianischen Cinquecento und es wird nieman-
dem schwer fallen, nach den hier angeführten
und abgebildeten Werken Sansovinos ihre nahe
Verwandtschaft mit diesem Meister festzustellen.
Die Reliefs und die Nischenfiguren der Sa-
kristeitür von S. Marco bieten Anhaltspunkte für
den Vergleich der Gewandbehandlung: die lan-
gen, am unteren Ende geschwungenen Gewand-
falten der Madonna auf dem Grablegungsrelief, die
sich zwischen die Knie legen und diese deutlich
markieren, finden wir an den Gewändern unserer
Heiligenstatuetten wieder. Ähnlichkeit herrscht auch
in der Behandlung der Hände: man betrachte die
verhältnismäßig großen, derben, aber gut durch-
modellierten Hände der Figuren an den Tribünen-
reliefs, besonders an jenen drei Reliefs der ersten,
1534 vollendeten Serie. Der Zusammenhang kann
nicht übersehen werden. Auch den Kopftypus
unserer Heiligen treffen wir auf diesen Reliefs wie-
der. Ist der auf allen drei Szenen noch auf Erden
wandelnde heil. Markus nicht ein nächster Verwandter unseres Petrus?
Der sansovineske Charakter dieser zwei Statuetten wäre somit erwiesen, die Zeit ihrer Ent-
stehung (i53o —1540) bestimmt. Es fragt sich aber, ob ihr Meister Sansovino selbst oder einer
Fig. 14. Bronzestatuette.
Modena, Museo Estense.
1 Inv.-Nr. 118 und 119. Schwarzer Lack. H.: 41 cm.