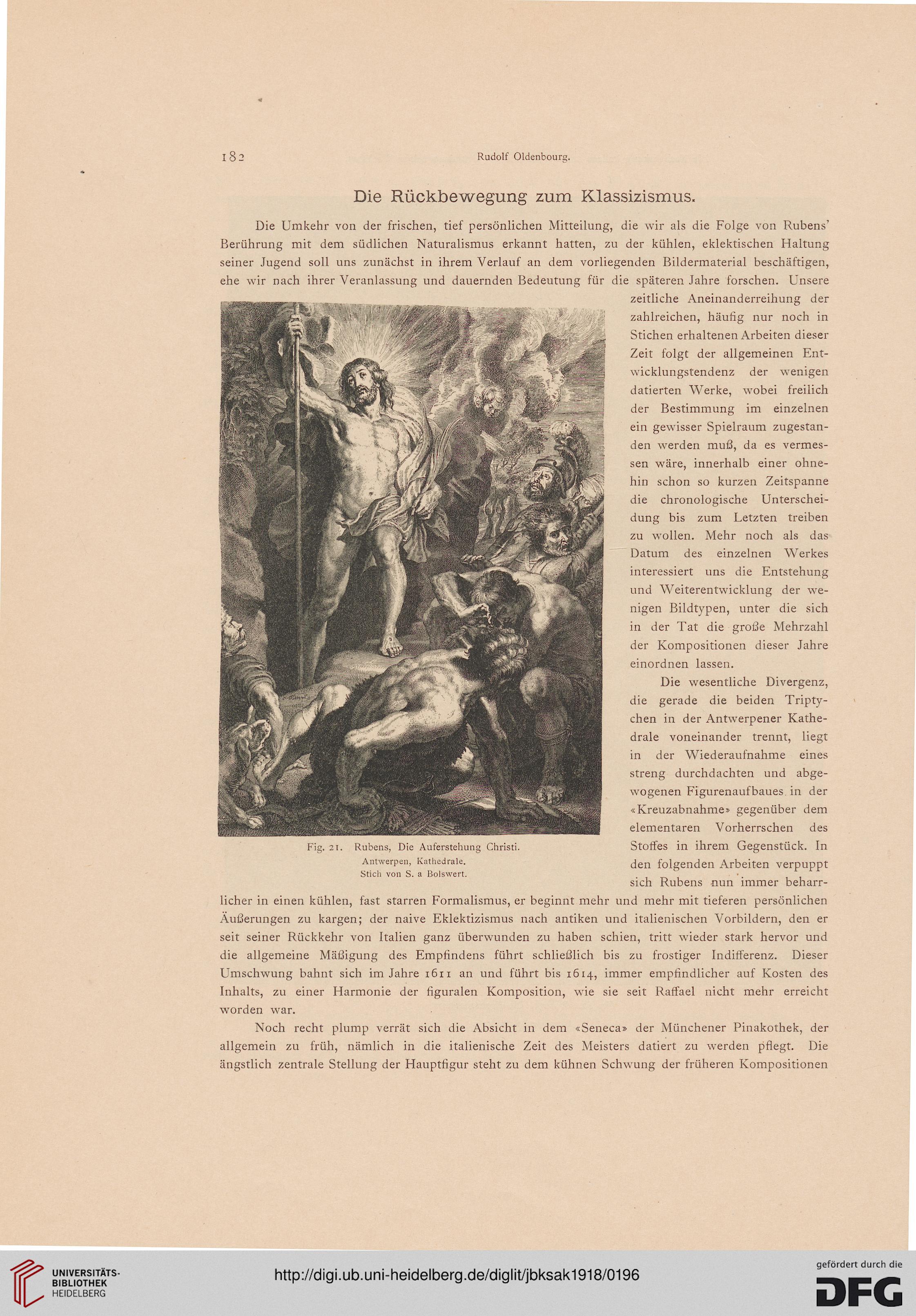182
Rudolf Oldenbourg.
Die Rückbewegung zum Klassizismus.
Die Umkehr von der frischen, tief persönlichen Mitteilung, die wir als die Folge von Rubens'
Berührung mit dem südlichen Naturalismus erkannt hatten, zu der kühlen, eklektischen Haltung
seiner Jugend soll uns zunächst in ihrem Verlauf an dem vorliegenden Bildermaterial beschäftigen,
ehe wir nach ihrer Veranlassung und dauernden Bedeutung für die späteren Jahre forschen. Unsere
zeitliche Aneinanderreihung der
zahlreichen, häufig nur noch in
Stichen erhaltenen Arbeiten dieser
Zeit folgt der allgemeinen Ent-
wicklungstendenz der wenigen
datierten Werke, wobei freilich
der Bestimmung im einzelnen
ein gewisser Spielraum zugestan-
den werden muß, da es vermes-
sen wäre, innerhalb einer ohne-
hin schon so kurzen Zeitspanne
die chronologische Unterschei-
dung bis zum Letzten treiben
zu wollen. Mehr noch als das
Datum des einzelnen Werkes
interessiert uns die Entstehung
und Weiterentwicklung der we-
nigen Bildtypen, unter die sich
in der Tat die große Mehrzahl
der Kompositionen dieser Jahre
einordnen lassen.
Die wesentliche Divergenz,
die gerade die beiden Tripty-
chen in der Antwerpener Kathe-
drale voneinander trennt, liegt
in der Wiederaufnahme eines
streng durchdachten und abge-
wogenen Plgurenaufbaues in der
«Kreuzabnahme» gegenüber dem
elementaren Vorherrschen des
Stoffes in ihrem Gegenstück. In
den folgenden Arbeiten verpuppt
sich Rubens nun immer beharr-
licher in einen kühlen, fast starren Formalismus, er beginnt mehr und mehr mit tieferen persönlichen
Äußerungen zu kargen; der naive Eklektizismus nach antiken und italienischen Vorbildern, den er
seit seiner Rückkehr von Italien ganz überwunden zu haben schien, tritt wieder stark hervor und
die allgemeine Mäßigung des Empfindens führt schließlich bis zu frostiger Indifferenz. Dieser
Umschwung bahnt sich im Jahre 1611 an und führt bis 1614, immer empfindlicher auf Kosten des
Inhalts, zu einer Harmonie der figuralen Komposition, wie sie seit Raffael nicht mehr erreicht
worden war.
Noch recht plump verrät sich die Absicht in dem «Seneca» der Münchener Pinakothek, der
allgemein zu früh, nämlich in die italienische Zeit des Meisters datiert zu werden pflegt. Die
ängstlich zentrale Stellung der Hauptfigur steht zu dem kühnen Schwung der früheren Kompositionen
Fig. 21. Rubens, Die Auferstehung Christi.
Antwerpen, Kathedrale.
Stich von S. a Bolswert.
Rudolf Oldenbourg.
Die Rückbewegung zum Klassizismus.
Die Umkehr von der frischen, tief persönlichen Mitteilung, die wir als die Folge von Rubens'
Berührung mit dem südlichen Naturalismus erkannt hatten, zu der kühlen, eklektischen Haltung
seiner Jugend soll uns zunächst in ihrem Verlauf an dem vorliegenden Bildermaterial beschäftigen,
ehe wir nach ihrer Veranlassung und dauernden Bedeutung für die späteren Jahre forschen. Unsere
zeitliche Aneinanderreihung der
zahlreichen, häufig nur noch in
Stichen erhaltenen Arbeiten dieser
Zeit folgt der allgemeinen Ent-
wicklungstendenz der wenigen
datierten Werke, wobei freilich
der Bestimmung im einzelnen
ein gewisser Spielraum zugestan-
den werden muß, da es vermes-
sen wäre, innerhalb einer ohne-
hin schon so kurzen Zeitspanne
die chronologische Unterschei-
dung bis zum Letzten treiben
zu wollen. Mehr noch als das
Datum des einzelnen Werkes
interessiert uns die Entstehung
und Weiterentwicklung der we-
nigen Bildtypen, unter die sich
in der Tat die große Mehrzahl
der Kompositionen dieser Jahre
einordnen lassen.
Die wesentliche Divergenz,
die gerade die beiden Tripty-
chen in der Antwerpener Kathe-
drale voneinander trennt, liegt
in der Wiederaufnahme eines
streng durchdachten und abge-
wogenen Plgurenaufbaues in der
«Kreuzabnahme» gegenüber dem
elementaren Vorherrschen des
Stoffes in ihrem Gegenstück. In
den folgenden Arbeiten verpuppt
sich Rubens nun immer beharr-
licher in einen kühlen, fast starren Formalismus, er beginnt mehr und mehr mit tieferen persönlichen
Äußerungen zu kargen; der naive Eklektizismus nach antiken und italienischen Vorbildern, den er
seit seiner Rückkehr von Italien ganz überwunden zu haben schien, tritt wieder stark hervor und
die allgemeine Mäßigung des Empfindens führt schließlich bis zu frostiger Indifferenz. Dieser
Umschwung bahnt sich im Jahre 1611 an und führt bis 1614, immer empfindlicher auf Kosten des
Inhalts, zu einer Harmonie der figuralen Komposition, wie sie seit Raffael nicht mehr erreicht
worden war.
Noch recht plump verrät sich die Absicht in dem «Seneca» der Münchener Pinakothek, der
allgemein zu früh, nämlich in die italienische Zeit des Meisters datiert zu werden pflegt. Die
ängstlich zentrale Stellung der Hauptfigur steht zu dem kühnen Schwung der früheren Kompositionen
Fig. 21. Rubens, Die Auferstehung Christi.
Antwerpen, Kathedrale.
Stich von S. a Bolswert.