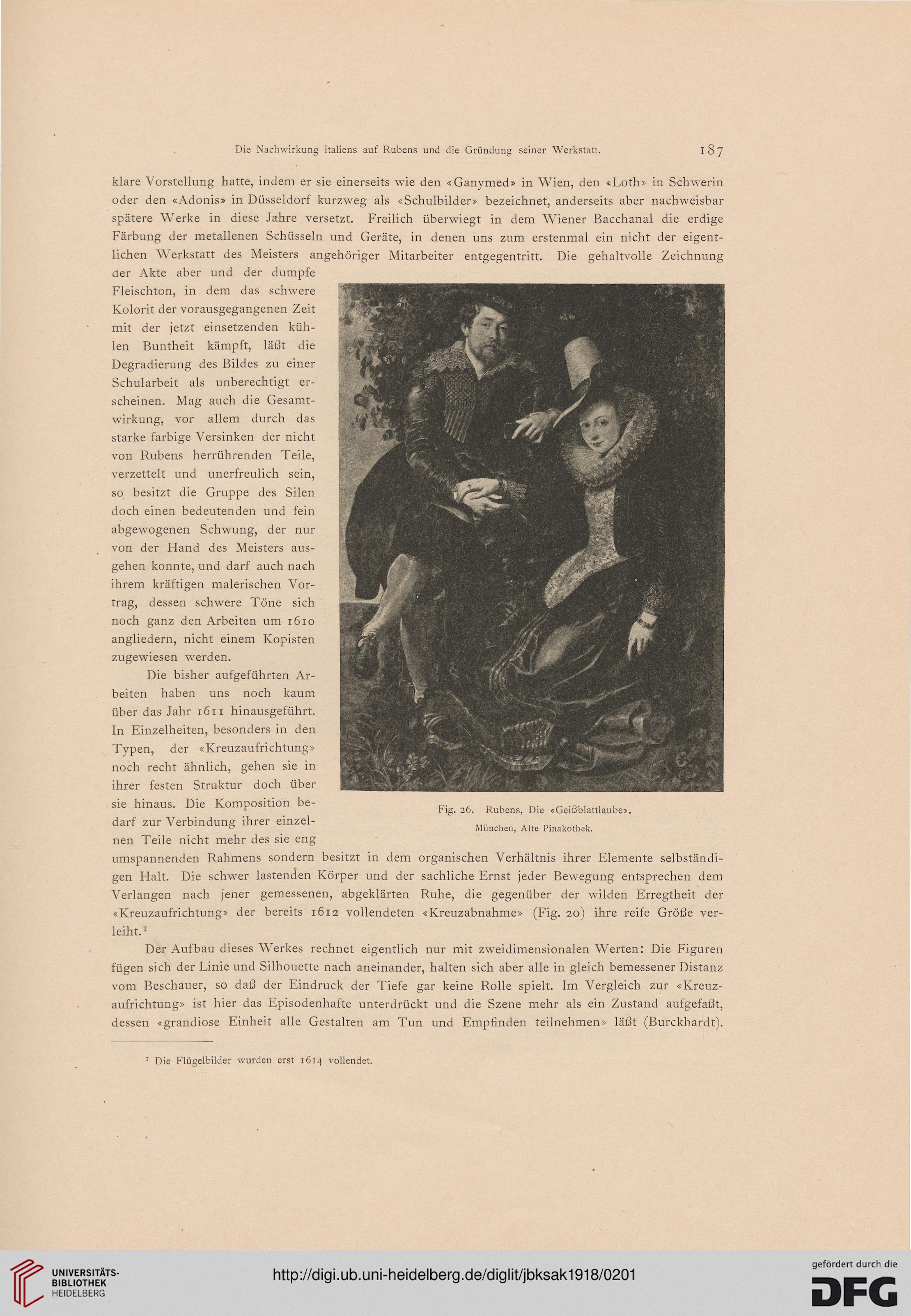Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung seiner Werkstatt.
I87
klare Vorstellung hatte, indem er sie einerseits wie den «Ganymed» in Wien, den «Loth» in Schwerin
oder den «Adonis» in Düsseldorf kurzweg als «Schulbilder» bezeichnet, anderseits aber nachweisbar
spätere Werke in diese Jahre versetzt. Freilich überwiegt in dem Wiener Bacchanal die erdige
Färbung der metallenen Schüsseln und Geräte, in denen uns zum erstenmal ein nicht der eigent-
lichen Werkstatt des Meisters angehöriger Mitarbeiter entgegentritt. Die gehaltvolle Zeichnung
der Akte aber und der dumpfe
Fleischton, in dem das schwere
Kolorit der vorausgegangenen Zeit
mit der jetzt einsetzenden küh-
len Buntheit kämpft, läßt die
Degradierung des Bildes zu einer
Schularbeit als unberechtigt er-
scheinen. Mag auch die Gesamt-
wirkung, vor allem durch das
starke farbige Versinken der nicht
von Rubens herrührenden Teile,
verzettelt und unerfreulich sein,
so besitzt die Gruppe des Silen
doch einen bedeutenden und fein
abgewogenen Schwung, der nur
von der Hand des Meisters aus-
gehen konnte, und darf auch nach
ihrem kräftigen malerischen Vor-
trag, dessen schwere Töne sich
noch ganz den Arbeiten um 1610
angliedern, nicht einem Kopisten
zugewiesen werden.
Die bisher aufgeführten Ar-
beiten haben uns noch kaum
über das Jahr 1611 hinausgeführt.
In Einzelheiten, besonders in den
Typen, der «Kreuzaufrichtung»
noch recht ähnlich, gehen sie in
ihrer festen Struktur doch über
sie hinaus. Die Komposition be-
darf zur Verbindung ihrer einzel-
nen Teile nicht mehr des sie eng
umspannenden Rahmens sondern besitzt in dem organischen Verhältnis ihrer Elemente selbständi-
gen Halt. Die schwer lastenden Körper und der sachliche Ernst jeder Bewegung entsprechen dem
Verlangen nach jener gemessenen, abgeklärten Ruhe, die gegenüber der wilden Erregtheit der
«Kreuzaufrichtung» der bereits 1612 vollendeten «Kreuzabnahme» (Fig. 20) ihre reife Größe ver-
leiht.1
Der Aufbau dieses Werkes rechnet eigentlich nur mit zweidimensionalen Werten: Die Figuren
fügen sich der Linie und Silhouette nach aneinander, halten sich aber alle in gleich bemessener Distanz
vom Beschauer, so daß der Eindruck der Tiefe gar keine Rolle spielt. Im Vergleich zur «Krenz-
aufrichtung» ist hier das Episodenhafte unterdrückt und die Szene mehr als ein Zustand aufgefaßt,
dessen «grandiose Einheit alle Gestalten am Tun und Empfinden teilnehmen» läßt (Burckhardt).
Fig. 26. Rubens, Die «Geißblattlaube».
München, Alte Pinakothek.
1 Die Flügelbilder wurden erst 1614 vollendet.
I87
klare Vorstellung hatte, indem er sie einerseits wie den «Ganymed» in Wien, den «Loth» in Schwerin
oder den «Adonis» in Düsseldorf kurzweg als «Schulbilder» bezeichnet, anderseits aber nachweisbar
spätere Werke in diese Jahre versetzt. Freilich überwiegt in dem Wiener Bacchanal die erdige
Färbung der metallenen Schüsseln und Geräte, in denen uns zum erstenmal ein nicht der eigent-
lichen Werkstatt des Meisters angehöriger Mitarbeiter entgegentritt. Die gehaltvolle Zeichnung
der Akte aber und der dumpfe
Fleischton, in dem das schwere
Kolorit der vorausgegangenen Zeit
mit der jetzt einsetzenden küh-
len Buntheit kämpft, läßt die
Degradierung des Bildes zu einer
Schularbeit als unberechtigt er-
scheinen. Mag auch die Gesamt-
wirkung, vor allem durch das
starke farbige Versinken der nicht
von Rubens herrührenden Teile,
verzettelt und unerfreulich sein,
so besitzt die Gruppe des Silen
doch einen bedeutenden und fein
abgewogenen Schwung, der nur
von der Hand des Meisters aus-
gehen konnte, und darf auch nach
ihrem kräftigen malerischen Vor-
trag, dessen schwere Töne sich
noch ganz den Arbeiten um 1610
angliedern, nicht einem Kopisten
zugewiesen werden.
Die bisher aufgeführten Ar-
beiten haben uns noch kaum
über das Jahr 1611 hinausgeführt.
In Einzelheiten, besonders in den
Typen, der «Kreuzaufrichtung»
noch recht ähnlich, gehen sie in
ihrer festen Struktur doch über
sie hinaus. Die Komposition be-
darf zur Verbindung ihrer einzel-
nen Teile nicht mehr des sie eng
umspannenden Rahmens sondern besitzt in dem organischen Verhältnis ihrer Elemente selbständi-
gen Halt. Die schwer lastenden Körper und der sachliche Ernst jeder Bewegung entsprechen dem
Verlangen nach jener gemessenen, abgeklärten Ruhe, die gegenüber der wilden Erregtheit der
«Kreuzaufrichtung» der bereits 1612 vollendeten «Kreuzabnahme» (Fig. 20) ihre reife Größe ver-
leiht.1
Der Aufbau dieses Werkes rechnet eigentlich nur mit zweidimensionalen Werten: Die Figuren
fügen sich der Linie und Silhouette nach aneinander, halten sich aber alle in gleich bemessener Distanz
vom Beschauer, so daß der Eindruck der Tiefe gar keine Rolle spielt. Im Vergleich zur «Krenz-
aufrichtung» ist hier das Episodenhafte unterdrückt und die Szene mehr als ein Zustand aufgefaßt,
dessen «grandiose Einheit alle Gestalten am Tun und Empfinden teilnehmen» läßt (Burckhardt).
Fig. 26. Rubens, Die «Geißblattlaube».
München, Alte Pinakothek.
1 Die Flügelbilder wurden erst 1614 vollendet.