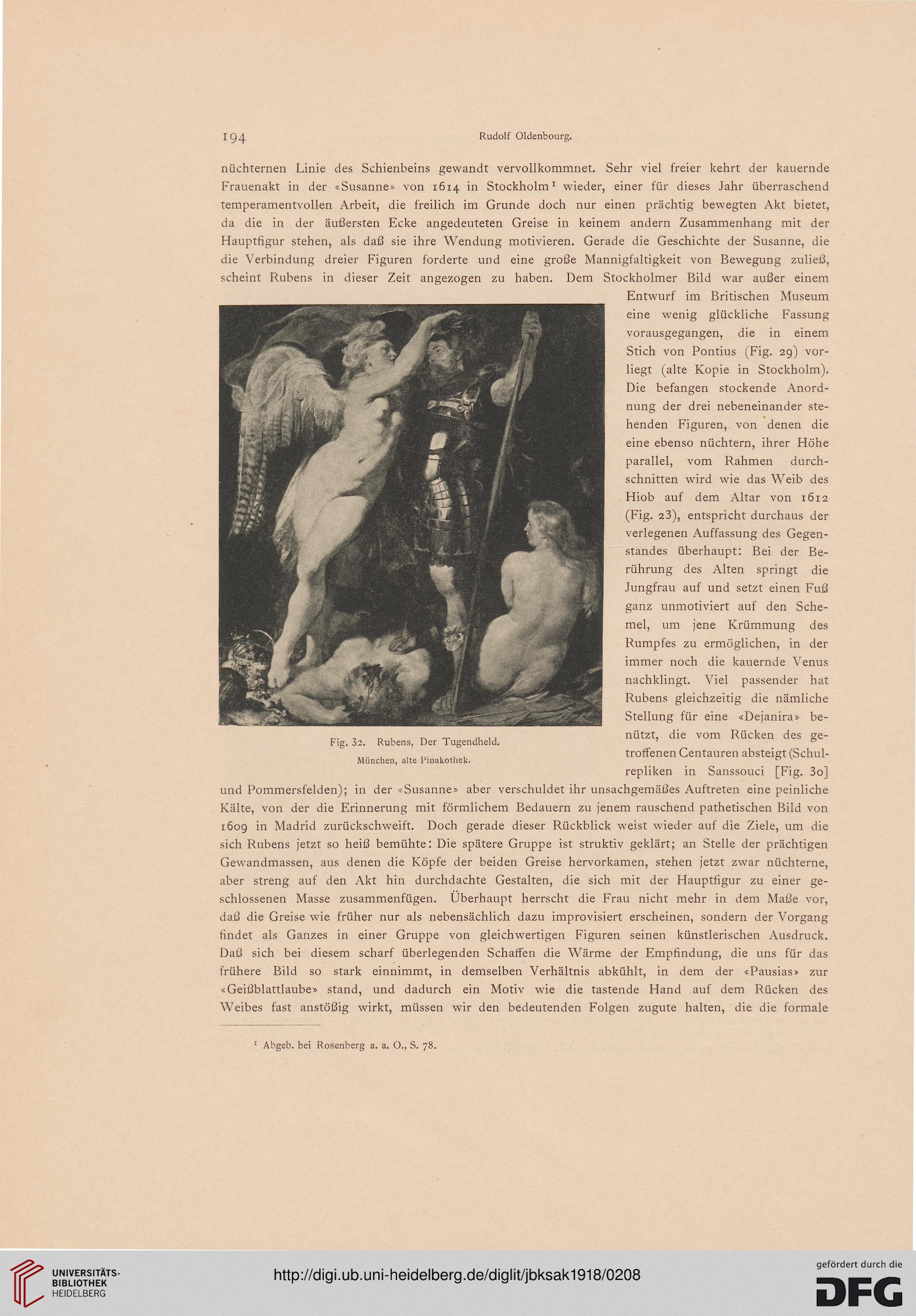194
Rudolf Oldenbourg.
nüchternen Linie des Schienbeins gewandt vervollkommnet. Sehr viel freier kehrt der kauernde
Frauenakt in der «Susanne» von 1614 in Stockholm1 wieder, einer für dieses Jahr überraschend
temperamentvollen Arbeit, die freilich im Grunde doch nur einen prächtig bewegten Akt bietet,
da die in der äußersten Ecke angedeuteten Greise in keinem andern Zusammenhang mit der
Hauptfigur stehen, als daß sie ihre Wendung motivieren. Gerade die Geschichte der Susanne, die
die Verbindung dreier Figuren forderte und eine große Mannigfaltigkeit von Bewegung zuließ,
scheint Rubens in dieser Zeit angezogen zu haben. Dem Stockholmer Bild war außer einem
Entwurf im Britischen Museum
eine wenig glückliche Fassung
vorausgegangen, die in einem
Stich von Pontius (Fig. 29) vor-
liegt (alte Kopie in Stockholm).
Die befangen stockende Anord-
nung der drei nebeneinander ste-
henden Figuren, von denen die
eine ebenso nüchtern, ihrer Höhe
parallel, vom Rahmen durch-
schnitten wird wie das Weib des
Hiob auf dem Altar von 1612
(Fig. 23), entspricht durchaus der
verlegenen Auffassung des Gegen-
standes überhaupt: Bei der Be-
rührung des Alten springt die
Jungfrau auf und setzt einen Fuß
ganz unmotiviert auf den Sche-
mel, um jene Krümmung des
Rumpfes zu ermöglichen, in der
immer noch die kauernde Venus
nachklingt. Viel passender hat
Rubens gleichzeitig die nämliche
Stellung für eine «Dejanira» be-
nützt, die vom Rücken des ge-
troffenen Centauren absteigt (Schul-
repliken in Sanssouci [Fig. 3o]
und Pommersfelden); in der «Susanne» aber verschuldet ihr unsachgemäßes Auftreten eine peinliche
Kälte, von der die Erinnerung mit förmlichem Bedauern zu jenem rauschend pathetischen Bild von
1609 in Madrid zurückschweift. Doch gerade dieser Rückblick weist wieder auf die Ziele, um die
sich Rubens jetzt so heiß bemühte: Die spätere Gruppe ist struktiv geklärt; an Stelle der prächtigen
Gewandmassen, aus denen die Köpfe der beiden Greise hervorkamen, stehen jetzt zwar nüchterne,
aber streng auf den Akt hin durchdachte Gestalten, die sich mit der Hauptfigur zu einer ge-
schlossenen Masse zusammenfügen. Überhaupt herrscht die Frau nicht mehr in dem Maße vor,
daß die Greise wie früher nur als nebensächlich dazu improvisiert erscheinen, sondern der Vorgang
findet als Ganzes in einer Gruppe von gleichwertigen Figuren seinen künstlerischen Ausdruck.
Daß sich bei diesem scharf überlegenden Schaffen die Wärme der Empfindung, die uns für das
frühere Bild so stark einnimmt, in demselben Verhältnis abkühlt, in dem der «Pausias» zur
«Geißblattlaube» stand, und dadurch ein Motiv wie die tastende Hand auf dem Rücken des
Weibes fast anstößig wirkt, müssen wir den bedeutenden Folgen zugute halten, die die formale
Fig. 32. Ruhens, Der Tugendheld.
München, alte Pinakothek.
1 Ahgeb. bei Rosenberg a. a. O., S. 78.
Rudolf Oldenbourg.
nüchternen Linie des Schienbeins gewandt vervollkommnet. Sehr viel freier kehrt der kauernde
Frauenakt in der «Susanne» von 1614 in Stockholm1 wieder, einer für dieses Jahr überraschend
temperamentvollen Arbeit, die freilich im Grunde doch nur einen prächtig bewegten Akt bietet,
da die in der äußersten Ecke angedeuteten Greise in keinem andern Zusammenhang mit der
Hauptfigur stehen, als daß sie ihre Wendung motivieren. Gerade die Geschichte der Susanne, die
die Verbindung dreier Figuren forderte und eine große Mannigfaltigkeit von Bewegung zuließ,
scheint Rubens in dieser Zeit angezogen zu haben. Dem Stockholmer Bild war außer einem
Entwurf im Britischen Museum
eine wenig glückliche Fassung
vorausgegangen, die in einem
Stich von Pontius (Fig. 29) vor-
liegt (alte Kopie in Stockholm).
Die befangen stockende Anord-
nung der drei nebeneinander ste-
henden Figuren, von denen die
eine ebenso nüchtern, ihrer Höhe
parallel, vom Rahmen durch-
schnitten wird wie das Weib des
Hiob auf dem Altar von 1612
(Fig. 23), entspricht durchaus der
verlegenen Auffassung des Gegen-
standes überhaupt: Bei der Be-
rührung des Alten springt die
Jungfrau auf und setzt einen Fuß
ganz unmotiviert auf den Sche-
mel, um jene Krümmung des
Rumpfes zu ermöglichen, in der
immer noch die kauernde Venus
nachklingt. Viel passender hat
Rubens gleichzeitig die nämliche
Stellung für eine «Dejanira» be-
nützt, die vom Rücken des ge-
troffenen Centauren absteigt (Schul-
repliken in Sanssouci [Fig. 3o]
und Pommersfelden); in der «Susanne» aber verschuldet ihr unsachgemäßes Auftreten eine peinliche
Kälte, von der die Erinnerung mit förmlichem Bedauern zu jenem rauschend pathetischen Bild von
1609 in Madrid zurückschweift. Doch gerade dieser Rückblick weist wieder auf die Ziele, um die
sich Rubens jetzt so heiß bemühte: Die spätere Gruppe ist struktiv geklärt; an Stelle der prächtigen
Gewandmassen, aus denen die Köpfe der beiden Greise hervorkamen, stehen jetzt zwar nüchterne,
aber streng auf den Akt hin durchdachte Gestalten, die sich mit der Hauptfigur zu einer ge-
schlossenen Masse zusammenfügen. Überhaupt herrscht die Frau nicht mehr in dem Maße vor,
daß die Greise wie früher nur als nebensächlich dazu improvisiert erscheinen, sondern der Vorgang
findet als Ganzes in einer Gruppe von gleichwertigen Figuren seinen künstlerischen Ausdruck.
Daß sich bei diesem scharf überlegenden Schaffen die Wärme der Empfindung, die uns für das
frühere Bild so stark einnimmt, in demselben Verhältnis abkühlt, in dem der «Pausias» zur
«Geißblattlaube» stand, und dadurch ein Motiv wie die tastende Hand auf dem Rücken des
Weibes fast anstößig wirkt, müssen wir den bedeutenden Folgen zugute halten, die die formale
Fig. 32. Ruhens, Der Tugendheld.
München, alte Pinakothek.
1 Ahgeb. bei Rosenberg a. a. O., S. 78.