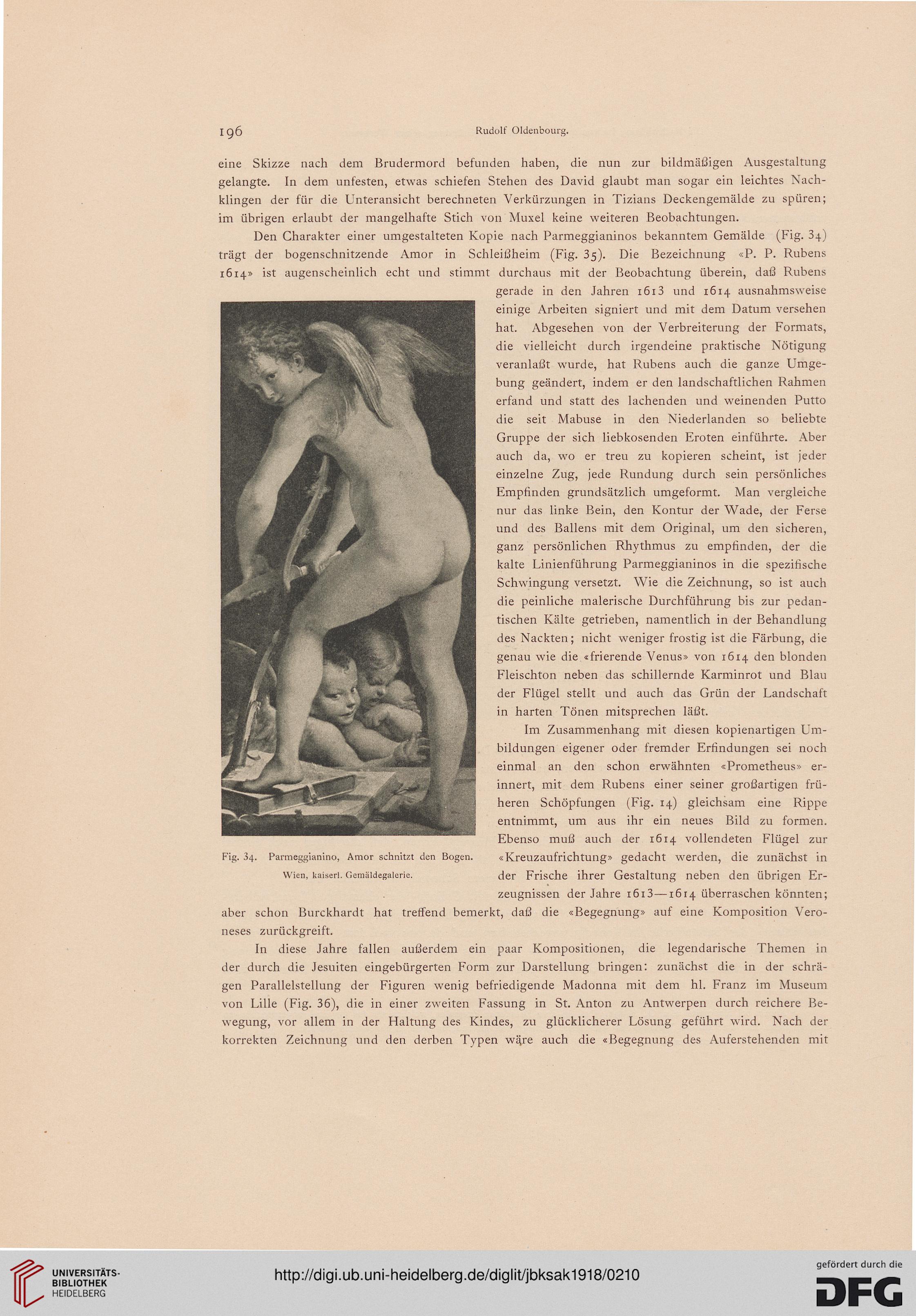196
Rudolf Oldenbourg.
eine Skizze nach dem Brudermord befunden haben, die nun zur bildmäßigen Ausgestaltung
gelangte. In dem unfesten, etwas schiefen Stehen des David glaubt man sogar ein leichtes Nach-
klingen der für die Unteransicht berechneten Verkürzungen in Tizians Deckengemälde zu spüren;
im übrigen erlaubt der mangelhafte Stich von Muxel keine weiteren Beobachtungen.
Den Charakter einer umgestalteten Kopie nach Parmeggianinos bekanntem Gemälde (Fig. 34)
trägt der bogenschnitzende Amor in Schleißheim (Fig. 35). Die Bezeichnung «P. P. Rubens
1614» ist augenscheinlich echt und stimmt durchaus mit der Beobachtung überein, daß Rubens
gerade in den Jahren i6i3 und 1614 ausnahmsweise
einige Arbeiten signiert und mit dem Datum versehen
hat. Abgesehen von der Verbreiterung der Formats,
die vielleicht durch irgendeine praktische Nötigung
veranlaßt wurde, hat Rubens auch die ganze Umge-
bung geändert, indem er den landschaftlichen Rahmen
erfand und statt des lachenden und weinenden Putto
die seit Mabuse in den Niederlanden so beliebte
Gruppe der sich liebkosenden Eroten einführte. Aber
auch da, wo er treu zu kopieren scheint, ist jeder
einzelne Zug, jede Rundung durch sein persönliches
Empfinden grundsätzlich umgeformt. Man vergleiche
nur das linke Bein, den Kontur der Wade, der Ferse
und des Ballens mit dem Original, um den sicheren,
ganz persönlichen Rhythmus zu empfinden, der die
kalte Linienführung Parmeggianinos in die spezifische
Schwingung versetzt. Wie die Zeichnung, so ist auch
die peinliche malerische Durchführung bis zur pedan-
tischen Kälte getrieben, namentlich in der Behandlung
des Nackten; nicht weniger frostig ist die Färbung, die
genau wie die «frierende Venus» von 1614 den blonden
Fleischton neben das schillernde Karminrot und Blau
der Flügel stellt und auch das Grün der Landschaft
in harten Tönen mitsprechen läßt.
Im Zusammenhang mit diesen kopienartigen Um-
bildungen eigener oder fremder Erfindungen sei noch
einmal an den schon erwähnten «Prometheus» er-
innert, mit dem Rubens einer seiner großartigen frü-
heren Schöpfungen (Fig. 14) gleichsam eine Rippe
entnimmt, um aus ihr ein neues Bild zu formen.
Ebenso muß auch der 1614 vollendeten Flügel zur
Fig. 34. Parmeggianino, Amor schnitzt den Bogen. «Kreuzaufrichtung» gedacht werden, die zunächst in
Wien, kaiserl. Gemäldegalerie. der Frische ihrer Gestaltung neben den übrigen Er-
zeugnissen der Jahre i6i3—1614 überraschen könnten;
aber schon Burckhardt hat treffend bemerkt, daß die «Begegnung» auf eine Komposition Vero-
neses zurückgreift.
In diese Jahre fallen außerdem ein paar Kompositionen, die legendarische Themen in
der durch die Jesuiten eingebürgerten Form zur Darstellung bringen: zunächst die in der schrä-
gen Parallelstellung der Figuren wenig befriedigende Madonna mit dem hl. Franz im Museum
von Lille (Fig. 36), die in einer zweiten Fassung in St. Anton zu Antwerpen durch reichere Be-
wegung, vor allem in der Haltung des Kindes, zu glücklicherer Lösung geführt wird. Nach der
korrekten Zeichnung und den derben Typen wä.re auch die «Begegnung des Auferstehenden mit
Rudolf Oldenbourg.
eine Skizze nach dem Brudermord befunden haben, die nun zur bildmäßigen Ausgestaltung
gelangte. In dem unfesten, etwas schiefen Stehen des David glaubt man sogar ein leichtes Nach-
klingen der für die Unteransicht berechneten Verkürzungen in Tizians Deckengemälde zu spüren;
im übrigen erlaubt der mangelhafte Stich von Muxel keine weiteren Beobachtungen.
Den Charakter einer umgestalteten Kopie nach Parmeggianinos bekanntem Gemälde (Fig. 34)
trägt der bogenschnitzende Amor in Schleißheim (Fig. 35). Die Bezeichnung «P. P. Rubens
1614» ist augenscheinlich echt und stimmt durchaus mit der Beobachtung überein, daß Rubens
gerade in den Jahren i6i3 und 1614 ausnahmsweise
einige Arbeiten signiert und mit dem Datum versehen
hat. Abgesehen von der Verbreiterung der Formats,
die vielleicht durch irgendeine praktische Nötigung
veranlaßt wurde, hat Rubens auch die ganze Umge-
bung geändert, indem er den landschaftlichen Rahmen
erfand und statt des lachenden und weinenden Putto
die seit Mabuse in den Niederlanden so beliebte
Gruppe der sich liebkosenden Eroten einführte. Aber
auch da, wo er treu zu kopieren scheint, ist jeder
einzelne Zug, jede Rundung durch sein persönliches
Empfinden grundsätzlich umgeformt. Man vergleiche
nur das linke Bein, den Kontur der Wade, der Ferse
und des Ballens mit dem Original, um den sicheren,
ganz persönlichen Rhythmus zu empfinden, der die
kalte Linienführung Parmeggianinos in die spezifische
Schwingung versetzt. Wie die Zeichnung, so ist auch
die peinliche malerische Durchführung bis zur pedan-
tischen Kälte getrieben, namentlich in der Behandlung
des Nackten; nicht weniger frostig ist die Färbung, die
genau wie die «frierende Venus» von 1614 den blonden
Fleischton neben das schillernde Karminrot und Blau
der Flügel stellt und auch das Grün der Landschaft
in harten Tönen mitsprechen läßt.
Im Zusammenhang mit diesen kopienartigen Um-
bildungen eigener oder fremder Erfindungen sei noch
einmal an den schon erwähnten «Prometheus» er-
innert, mit dem Rubens einer seiner großartigen frü-
heren Schöpfungen (Fig. 14) gleichsam eine Rippe
entnimmt, um aus ihr ein neues Bild zu formen.
Ebenso muß auch der 1614 vollendeten Flügel zur
Fig. 34. Parmeggianino, Amor schnitzt den Bogen. «Kreuzaufrichtung» gedacht werden, die zunächst in
Wien, kaiserl. Gemäldegalerie. der Frische ihrer Gestaltung neben den übrigen Er-
zeugnissen der Jahre i6i3—1614 überraschen könnten;
aber schon Burckhardt hat treffend bemerkt, daß die «Begegnung» auf eine Komposition Vero-
neses zurückgreift.
In diese Jahre fallen außerdem ein paar Kompositionen, die legendarische Themen in
der durch die Jesuiten eingebürgerten Form zur Darstellung bringen: zunächst die in der schrä-
gen Parallelstellung der Figuren wenig befriedigende Madonna mit dem hl. Franz im Museum
von Lille (Fig. 36), die in einer zweiten Fassung in St. Anton zu Antwerpen durch reichere Be-
wegung, vor allem in der Haltung des Kindes, zu glücklicherer Lösung geführt wird. Nach der
korrekten Zeichnung und den derben Typen wä.re auch die «Begegnung des Auferstehenden mit