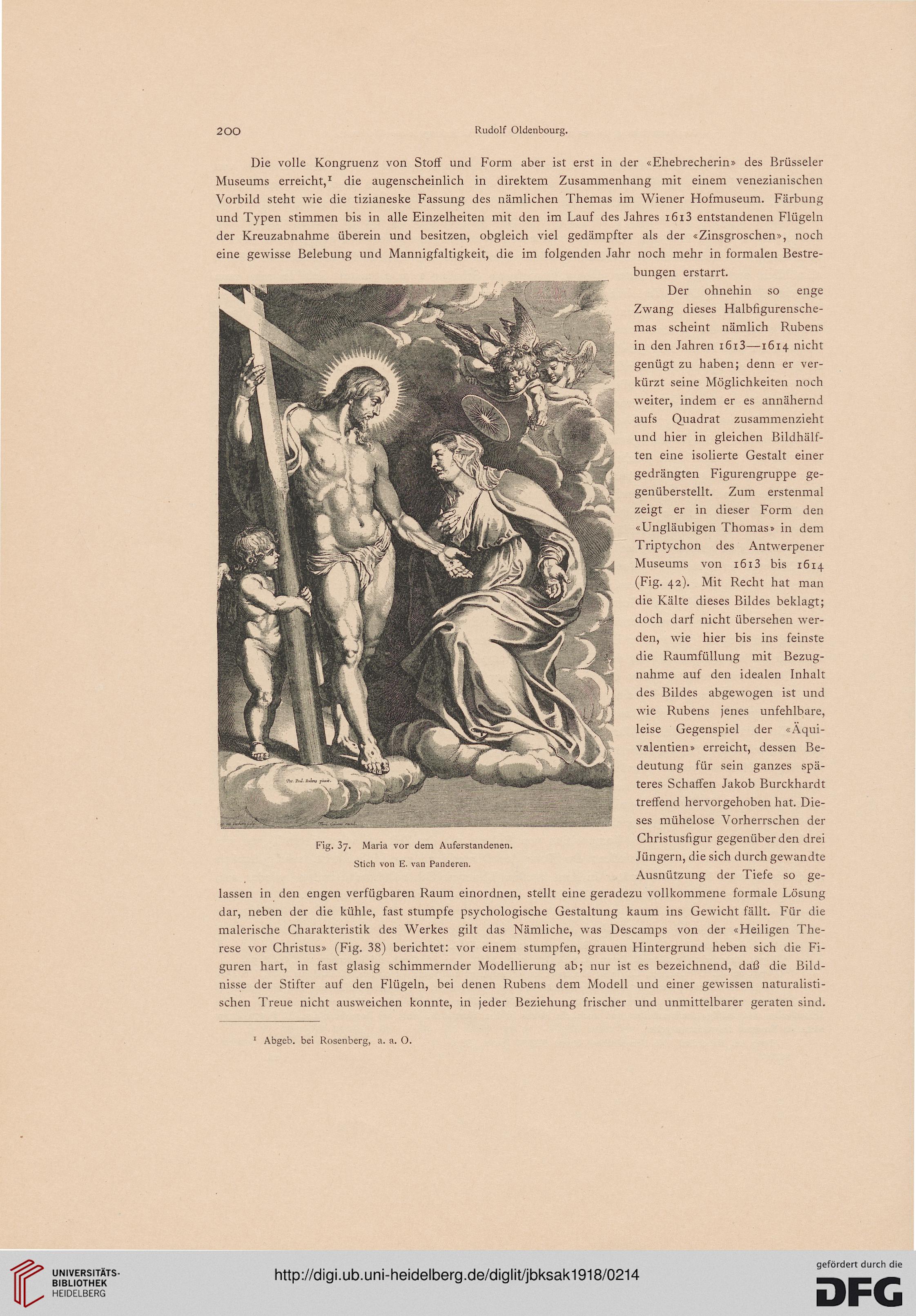200
Rudolf Oldenbourg.
Die volle Kongruenz von Stoff und Form aber ist erst in der «Ehebrecherin» des Brüsseler
Museums erreicht,1 die augenscheinlich in direktem Zusammenhang mit einem venezianischen
Vorbild steht wie die tizianeske Fassung des nämlichen Themas im Wiener Hofmuseum. Färbung
und Typen stimmen bis in alle Einzelheiten mit den im Lauf des Jahres i6i3 entstandenen Flügeln
der Kreuzabnahme überein und besitzen, obgleich viel gedämpfter als der «Zinsgroschen», noch
eine gewisse Belebung und Mannigfaltigkeit, die im folgenden Jahr noch mehr in formalen Bestre-
bungen erstarrt.
Der ohnehin so enge
Zwang dieses Halbfigurensche-
mas scheint nämlich Rubens
in den Jahren i6i3—1614 nicht
genügt zu haben; denn er ver-
kürzt seine Möglichkeiten noch
weiter, indem er es annähernd
aufs Quadrat zusammenzieht
und hier in gleichen Bildhälf-
ten eine isolierte Gestalt einer
gedrängten Figurengruppe ge-
genüberstellt. Zum erstenmal
zeigt er in dieser Form den
«Ungläubigen Thomas» in dem
Triptychon des Antwerpener
Museums von i6i3 bis 1614
(Fig. 42). Mit Recht hat man
die Kälte dieses Bildes beklagt;
doch darf nicht übersehen wer-
den, wie hier bis ins feinste
die Raumfüllung mit Bezug-
nahme auf den idealen Inhalt
des Bildes abgewogen ist und
wie Rubens jenes unfehlbare,
leise Gegenspiel der «Aqui-
valentien» erreicht, dessen Be-
deutung für sein ganzes spä-
teres Schaffen Jakob Burckhardt
treffend hervorgehoben hat. Die-
ses mühelose Vorherrschen der
Christusfigur gegenüber den drei
Jüngern, die sich durch gewandte
Ausnützung der Tiefe so ge-
lassen in den engen verfügbaren Raum einordnen, stellt eine geradezu vollkommene formale Lösung
dar, neben der die kühle, fast stumpfe psychologische Gestaltung kaum ins Gewicht fällt. Für die
malerische Charakteristik des Werkes gilt das Nämliche, was Descamps von der «Heiligen The-
rese vor Christus» (Fig. 38) berichtet: vor einem stumpfen, grauen Hintergrund heben sich die Fi-
guren hart, in fast glasig schimmernder Modellierung ab; nur ist es bezeichnend, daß die Bild-
nisse der Stifter auf den Flügeln, bei denen Rubens dem Modell und einer gewissen naturalisti-
schen Treue nicht ausweichen konnte, in jeder Beziehung frischer und unmittelbarer geraten sind.
Fig. 37.
Maria vor dem Auferstandenen.
Stich von E. van Panderen.
1 Abgeb. bei Rosenberg, a. a. O.
Rudolf Oldenbourg.
Die volle Kongruenz von Stoff und Form aber ist erst in der «Ehebrecherin» des Brüsseler
Museums erreicht,1 die augenscheinlich in direktem Zusammenhang mit einem venezianischen
Vorbild steht wie die tizianeske Fassung des nämlichen Themas im Wiener Hofmuseum. Färbung
und Typen stimmen bis in alle Einzelheiten mit den im Lauf des Jahres i6i3 entstandenen Flügeln
der Kreuzabnahme überein und besitzen, obgleich viel gedämpfter als der «Zinsgroschen», noch
eine gewisse Belebung und Mannigfaltigkeit, die im folgenden Jahr noch mehr in formalen Bestre-
bungen erstarrt.
Der ohnehin so enge
Zwang dieses Halbfigurensche-
mas scheint nämlich Rubens
in den Jahren i6i3—1614 nicht
genügt zu haben; denn er ver-
kürzt seine Möglichkeiten noch
weiter, indem er es annähernd
aufs Quadrat zusammenzieht
und hier in gleichen Bildhälf-
ten eine isolierte Gestalt einer
gedrängten Figurengruppe ge-
genüberstellt. Zum erstenmal
zeigt er in dieser Form den
«Ungläubigen Thomas» in dem
Triptychon des Antwerpener
Museums von i6i3 bis 1614
(Fig. 42). Mit Recht hat man
die Kälte dieses Bildes beklagt;
doch darf nicht übersehen wer-
den, wie hier bis ins feinste
die Raumfüllung mit Bezug-
nahme auf den idealen Inhalt
des Bildes abgewogen ist und
wie Rubens jenes unfehlbare,
leise Gegenspiel der «Aqui-
valentien» erreicht, dessen Be-
deutung für sein ganzes spä-
teres Schaffen Jakob Burckhardt
treffend hervorgehoben hat. Die-
ses mühelose Vorherrschen der
Christusfigur gegenüber den drei
Jüngern, die sich durch gewandte
Ausnützung der Tiefe so ge-
lassen in den engen verfügbaren Raum einordnen, stellt eine geradezu vollkommene formale Lösung
dar, neben der die kühle, fast stumpfe psychologische Gestaltung kaum ins Gewicht fällt. Für die
malerische Charakteristik des Werkes gilt das Nämliche, was Descamps von der «Heiligen The-
rese vor Christus» (Fig. 38) berichtet: vor einem stumpfen, grauen Hintergrund heben sich die Fi-
guren hart, in fast glasig schimmernder Modellierung ab; nur ist es bezeichnend, daß die Bild-
nisse der Stifter auf den Flügeln, bei denen Rubens dem Modell und einer gewissen naturalisti-
schen Treue nicht ausweichen konnte, in jeder Beziehung frischer und unmittelbarer geraten sind.
Fig. 37.
Maria vor dem Auferstandenen.
Stich von E. van Panderen.
1 Abgeb. bei Rosenberg, a. a. O.