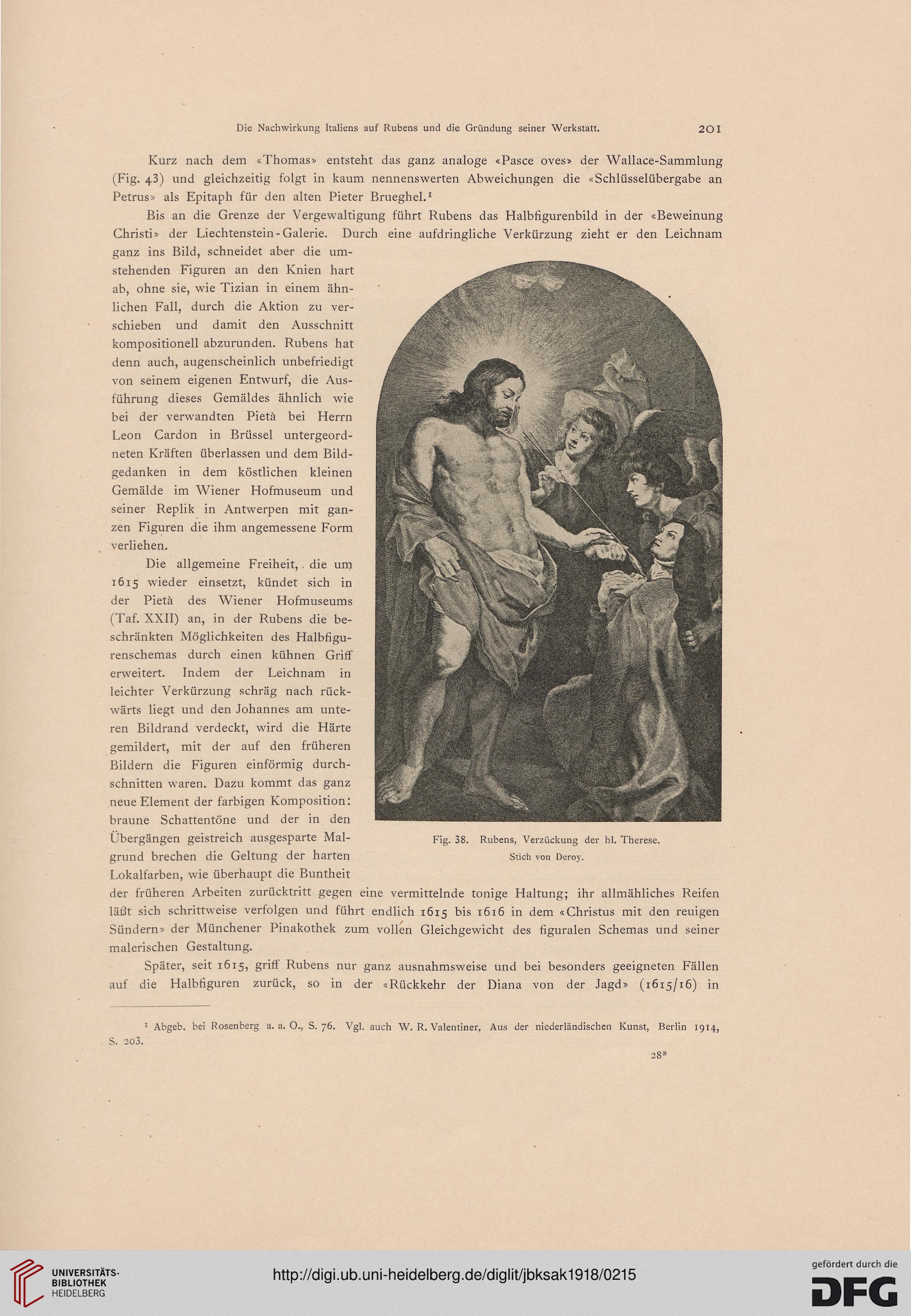Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung seiner Werkstatt.
20I
Kurz nach dem «Thomas» entsteht das ganz analoge «Pasee oves» der Wallace-Sammlung
(Fig. 43) und gleichzeitig folgt in kaum nennenswerten Abweichungen die «Schlüsselübergabe an
Petrus» als Epitaph für den alten Pieter Brueghel.1
Bis an die Grenze der Vergewaltigung führt Rubens das Halbfigurenbild in der «Beweinung
Christi» der Liechtenstein-Galerie. Durch eine aufdringliche Verkürzung zieht er den Leichnam
ganz ins Bild, schneidet aber die um-
stehenden Figuren an den Knien hart
ab, ohne sie, wie Tizian in einem ähn-
lichen Fall, durch die Aktion zu ver-
schieben und damit den Ausschnitt
kompositioneil abzurunden. Rubens hat
denn auch, augenscheinlich unbefriedigt
von seinem eigenen Entwurf, die Aus-
führung dieses Gemäldes ähnlich wie
bei der verwandten Pietä bei Herrn
Leon Cardon in Brüssel untergeord-
neten Kräften überlassen und dem Bild-
gedanken in dem köstlichen kleinen
Gemälde im Wiener Hofmuseum und
seiner Replik in Antwerpen mit gan-
zen Figuren die ihm angemessene Form
verliehen.
Die allgemeine Freiheit, . die um
1615 wieder einsetzt, kündet sich in
der Pietä des Wiener Hofmuseums
(Taf. XXII) an, in der Rubens die be-
schränkten Möglichkeiten des Halbfigu-
renschemas durch einen kühnen Griff
erweitert. Indem der Leichnam in
leichter Verkürzung schräg nach rück-
wärts liegt und den Johannes am unte-
ren Bildrand verdeckt, wird die Härte
gemildert, mit der auf den früheren
Bildern die Figuren einförmig durch-
schnitten waren. Dazu kommt das ganz
neue Element der farbigen Komposition:
braune Schattentöne und der in den
Übergängen geistreich ausgesparte Mal-
grund brechen die Geltung der harten
Lokalfarben, wie überhaupt die Buntheit
der früheren Arbeiten zurücktritt gegen eine vermittelnde tonige Haltung; ihr allmähliches Reifen
läßt sich schrittweise verfolgen und führt endlich 1615 bis 1616 in dem «Christus mit den reuigen
Sündern» der Münchener Pinakothek zum vollen Gleichgewicht des figuralen Schemas und seiner
malerischen Gestaltung.
Später, seit 1615, griff Rubens nur ganz ausnahmsweise und bei besonders geeigneten Fällen
auf die Halbfiguren zurück, so in der «Rückkehr der Diana von der Jagd» (1615/16) in
Fig. 38.
Rubens, Verzückung der hl. Therese.
Stich von Deroy.
1 Abgeb. bei Rosenberg a.a.O., S. 76. Vgl. auch W. R. Valentiner, Aus der niederländischen Kunst, Berlin 1914,
S. 203.
28*
20I
Kurz nach dem «Thomas» entsteht das ganz analoge «Pasee oves» der Wallace-Sammlung
(Fig. 43) und gleichzeitig folgt in kaum nennenswerten Abweichungen die «Schlüsselübergabe an
Petrus» als Epitaph für den alten Pieter Brueghel.1
Bis an die Grenze der Vergewaltigung führt Rubens das Halbfigurenbild in der «Beweinung
Christi» der Liechtenstein-Galerie. Durch eine aufdringliche Verkürzung zieht er den Leichnam
ganz ins Bild, schneidet aber die um-
stehenden Figuren an den Knien hart
ab, ohne sie, wie Tizian in einem ähn-
lichen Fall, durch die Aktion zu ver-
schieben und damit den Ausschnitt
kompositioneil abzurunden. Rubens hat
denn auch, augenscheinlich unbefriedigt
von seinem eigenen Entwurf, die Aus-
führung dieses Gemäldes ähnlich wie
bei der verwandten Pietä bei Herrn
Leon Cardon in Brüssel untergeord-
neten Kräften überlassen und dem Bild-
gedanken in dem köstlichen kleinen
Gemälde im Wiener Hofmuseum und
seiner Replik in Antwerpen mit gan-
zen Figuren die ihm angemessene Form
verliehen.
Die allgemeine Freiheit, . die um
1615 wieder einsetzt, kündet sich in
der Pietä des Wiener Hofmuseums
(Taf. XXII) an, in der Rubens die be-
schränkten Möglichkeiten des Halbfigu-
renschemas durch einen kühnen Griff
erweitert. Indem der Leichnam in
leichter Verkürzung schräg nach rück-
wärts liegt und den Johannes am unte-
ren Bildrand verdeckt, wird die Härte
gemildert, mit der auf den früheren
Bildern die Figuren einförmig durch-
schnitten waren. Dazu kommt das ganz
neue Element der farbigen Komposition:
braune Schattentöne und der in den
Übergängen geistreich ausgesparte Mal-
grund brechen die Geltung der harten
Lokalfarben, wie überhaupt die Buntheit
der früheren Arbeiten zurücktritt gegen eine vermittelnde tonige Haltung; ihr allmähliches Reifen
läßt sich schrittweise verfolgen und führt endlich 1615 bis 1616 in dem «Christus mit den reuigen
Sündern» der Münchener Pinakothek zum vollen Gleichgewicht des figuralen Schemas und seiner
malerischen Gestaltung.
Später, seit 1615, griff Rubens nur ganz ausnahmsweise und bei besonders geeigneten Fällen
auf die Halbfiguren zurück, so in der «Rückkehr der Diana von der Jagd» (1615/16) in
Fig. 38.
Rubens, Verzückung der hl. Therese.
Stich von Deroy.
1 Abgeb. bei Rosenberg a.a.O., S. 76. Vgl. auch W. R. Valentiner, Aus der niederländischen Kunst, Berlin 1914,
S. 203.
28*